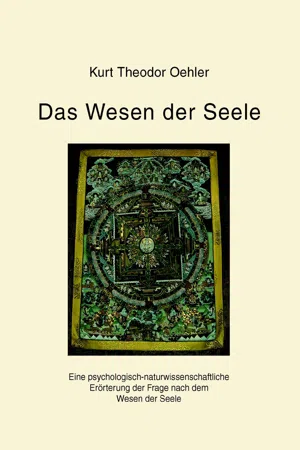
eBook - ePub
Das Wesen der Seele
Eine psychologisch-naturwissenschaftliche Erörterung der Frage nach dem Wesen der Seele
- 220 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Das Wesen der Seele
Eine psychologisch-naturwissenschaftliche Erörterung der Frage nach dem Wesen der Seele
Über dieses Buch
Der Autor hat sich bemüht, sich der Seele vom naturwissenschaftlich-psychologischen Standpunkt aus schrittweise anzunähern. Dabei wurde die Seele nicht als etwas göttlich Gegebenes, sondern als das notwendige Ergebnis der natürlichen Evolution aufgefasst.Welche Bedingungen bez. Anforderungen an die lebende Kreatur haben zwingend zur Herausbildung seelischer Strukturen geführt?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das Wesen der Seele von Kurt Theodor Oehler im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Histoire et théorie en psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
III. Auf der beschwerlichen Suche nach einer Antwort
Diese Abhandlung über das Wesen der Seele soll an einem konkreten Beispiel ansetzen:
Antonio C.* war groß gewachsen, engagiert und immer originell. Alles was er anfasste, geriet zu Bedeutendem. Wenigstens fast alles. Er verabscheute Bedeutungslosigkeit und hasste Mittelmass. Er war reich mit Talenten beschenkt. Er spielte virtuos und stundenlang Klavier, meisterhaft das Vibraphon, exzellent sowohl die Klarinette als auch das Saxophon, schrieb schon als Gymnasiast Gedichte, Aufsätze, Kurzgeschichten, malte talentiert mit Tusche, mit Wasserfarben und mit Öl. Und obwohl er den Turnunterricht mit Abscheu vermied, trat er den Ball nicht ohne Geschick.
Antonio C. schrieb in seinem letzten Lebensjahr einen bemerkenswerten Text:
„Es ist gespenstisch, seit 1992 wird mir jedes Jahr ein Preis zugesprochen, obwohl ich seit jener Zeit nichts Brauchbares mehr produziert habe und nur noch als Ruine auf meine innere Öffentlichkeit starre, Krater, so weit das Auge reicht.“
Dieser Satz dokumentiert, als Gegenstück zum äußeren Erfolg, das grenzenlose, innere Unglück von Antonio C.:
Trotz mehrjähriger psychiatrischer Behandlung mit Unmengen von Medikamenten und unregelmäßigen therapeutischen Gesprächen verschlimmerte sich sein Zustand zusehends. Mehr und mehr wurde er von tiefen Depressionen und unvorhersehbaren manischen Zuständen geplagt, die mehrmals zwingend Internierungen in psychiatrischen Kliniken notwendig machten.
Aber was meinte Antonio C., wenn er schrieb, dass er sich innerlich wie eine „Ruine“ fühle? Er wies auf seinen Gefühlszustand hin, den er in folgenden Charakterisierungen weiter akzentuierte:
„Eigentlich war ich schon lange beeinträchtigt, scheintot, oder besser eher scheinlebendig.“ „Der Scheintote wird während der Dauer seines Scheintodes für tot gehalten, lebt aber. Der Scheinlebendige wird äußerlich zu den Lebendigen gezählt, während er innerlich gestorben ist.“ „Der Scheinlebendige stirbt (also) keinen Tod, denn ein Leben, das nie ein wirkliches war, kann nicht gestorben werden.“ „Genaugenommen stirbt er zu einem unbestimmten Zeitpunkt einen inneren Tod, der an Endgültigkeit dem medizinischen Tod in keiner Weise nachsteht.“
Das sind Zitate aus der Feder von Antonio C.. Anscheinend hatte er seit langem schon das Gefühl, innerlich nicht mehr zu leben, nicht mehr lebendig zu sein. Etwas schien tot oder abgestorben zu sein. Etwas, was existenziell wichtig und für eine glückliche Lebensführung unerlässlich ist. Was bedeutete aber dieser „innere Tod“? Und warum war C. der Meinung, dass dieser „innere Tod“ einem „medizinischen Tod“ in keiner Weise nachstehe?
Handelt es sich bei diesem Gefühlten um die „Persönlichkeit“, um das „Mentale“, etwa um das sogenannte Ich, oder gar um das „Innerste“ des Menschen, um die eigentliche Seele? Oder kann man einfach sagen, dass nicht die Seele, sondern ganz einfach die Hoffnung, die Zuversicht und das Selbstvertrauen gestorben waren?
Wenn es aber die Seele war, die sterben konnte oder bereits gestorben war, dann könnte man daraus folgende Hypothesen ableiten:
• Die Seele erscheint uns neben dem Ich als ein relativ abgegrenztes mentales Organ.
• Die Seele ist ein sensibles und verletzliches Organ.
• Die Seele kann unter ganz bestimmten inneren oder äußeren Bedingungen Schaden nehmen oder sterben, auch wenn der Körper weiter lebt.
• Wenn die Seele stirbt, entfallen Lebenssinn und Lebensfreude.
Vielleicht gibt es mehrere Antworten von verschiedenen Menschen. Vielleicht gibt es mehrere Erklärungen für den Begriff der Seele. Vielleicht gibt es Definitionen, die Naturwissenschaftler akzeptieren, weitere, die Philosophen lieben, dritte, an die Theologen glauben und eine vierte für das „Volk“.
Alle diese Fragen können an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Sie werden uns aber durch den ganzen Text hindurch begleiten. Es genügt, wenn wir an dieser Stelle festhalten, dass dieses „Innerste“ für den Menschen von grundsätzlicher Bedeutung ist. Wenn dieses „Innerste“ fehlt, dann scheint das Leben sinnlos, nutzlos und vertan. Dann scheint sich das Leben nicht mehr zu lohnen. Tatsächlich nahm sich Antonio C. im Frühjahr 1989, trotz großer schriftstellerischer Erfolge und zunehmender gesellschaftlicher Beachtung, das Leben.
Die Frage, ob es mehrere Auffassungen zur Definition der Seele gebe, zwingt uns, bei verschiedenen Wissenschaftszweigen getrennt nachzuforschen. Möglicherweise kann man erst dann verstehen, wie diese Menschen denken und fühlen.
Die Antwort eines Philosophen
Der Anfang soll mit einem Philosophen, mit Colin McGINN, gemacht werden, weil die Fakultät der Philosophen immer schon die Mutter aller Wissenschaften war, und weil sich die Philosophen über Jahrhunderte hinweg mit dem menschlichen Geist, mit dem Geheimnis des Bewusstseins und mit dem Mysterium der Seele auseinandergesetzt haben.
Obwohl McGinn eine ausgesprochen akzentuierte und sehr persönliche Meinung vertritt und eigentlich für sich allein sprechen müsste, soll er am Anfang dieser Ausführungen stehen. Denn vor wenigen Monaten hatte er über das Thema „Bewusstsein“ ein bemerkenswertes Buch geschrieben.
Der Zirkelschluss von Colin McGinn
Unter dem erwartungsvollen deutschsprachigen Titel „Wie kommt der Geist in die Materie?“, und unter dem noch Hoffnung verheißenderen Untertitel „das Rätsel des Bewusstseins“ legt uns der Philosoph Colin McGINN (2001) eine vielversprechende Abhandlung vor. Dabei vertritt und verteidigt er vehement die These, dass die Verknüpfung zwischen Geist und Gehirn ein tiefes Mysterium darstelle. Er meint, als Quintessenz seiner Überlegungen, dass man das Wesen des Bewusstseins mit dem Instrument des menschlichen Verstandes niemals begreifen könne, weil letzterer, von seiner inneren Logik her, nie in der Lage sei, sein eigenes Wesen zu erkennen. Er meint, eine logische Barriere, eine sachlogische, letzte und unüberwindbare Grenze entdeckt zu haben, die ein für alle Male verhindere, dass das Rätsel der Seele gelöst werden könnte. Deshalb würde sich eine weitergehende Diskussion zu diesem großen Thema grundsätzlich erübrigen.
Aber einen einzigen wichtigen Gedankenblitz wagt McGINN noch zu denken, wenn er schreibt, dass wenigstens „die Gene wissen müssten, was lebendiger Geist bedeute“, denn aus dem rein chemisch determinierten, genetischen Code entstehe schließlich ein menschlicher, lebendiger Geist! Mit einem abschätzigen Wisch schiebt er aber den für ihn halsbrecherischen Gedanken wieder vom Tisch, mit der etwas zirkelschlüssigen Bemerkung, dass ein Computerprogramm eben niemals lebendigen Geist hervorbringen könne.
Dieses Beispiel gibt zu denken. Einerseits sind McGINNs Gedankengänge überaus faszinierend. Die wichtigsten Fortschritte in der Philosophie wurden aber in erster Linie durch die bahnbrechenden Erkenntnisse in naturwissenschaftlichen Disziplinen hervorgebracht. Deshalb soll die etwas gewagte Meinungsäußerung von McGINN nicht endgültiger Schlusspunkt, sondern eher ein Anfang sein.
Die Suche nach dem Wesen der Seele soll aber in einer anderen Fakultät fortgesetzt werden, die sich stärker als die Philosophie an den messbaren und sichtbaren Fakten orientiert, dort, wo man zuallererst größtmöglichen Sachverstand relativ ungefragt voraussetzt: Bei den Naturwissenschaften. Da läuft man, so hofft man wenigstens, weniger Gefahr, von befremdenden Annahmen auszugehen, die diese Überlegungen zum vorneherein ad absurdum führen, wo unüberbrückbare Widerstände und Spekulationen schon in den Voraussetzungen implizit enthalten sind. Aber Wissenschaftlichkeit, Messbarkeit und Exaktheit haben, wie wir noch sehen werden, ihren Preis!
Der naturwissenschaftliche Ansatz
Was hat die Seele im Weltbild eines Naturwissenschaftlers überhaupt zu suchen? Ist es nicht so, dass dieses eigenartige Phänomen in der naturwissenschaftlich orientierten Psychologie gar nicht existiert? Ist es nicht so, dass es wegen seiner Widersprüchlichkeit und Komplexität aus dem naturwissenschaftlichen Repertoire fast gänzlich hinausgekippt wurde? Und ist es nicht so, dass auch Daniel HELL (2002), Ordinarius für klinische Psychiatrie, in seiner sorgfältigen Abhandlung über den „Seelenhunger“, niemals von der Seele, sondern höchstens, und extrem vorsichtig, vom sogenannt „Seelischen“ spricht?
Die Naturwissenschaftler aller Disziplinen bemühen sich stets um strikte Beweisbarkeit der gefundenen Ergebnisse und um kritische Überprüfung der gemachten Hypothesen. So geraten sie weniger in Versuchung, sich in unbewiesenen Mutmaßungen zu verstricken und in weitschweifigen Theorien zu verlieren. Es ist zu hoffen, dass mit diesem strengen Vorgehen ein genügend festes Fundament gelegt werden kann, auf die die nachfolgenden Thesen weiter aufgebaut und schrittweise entfaltet werden können.
Seele bedeutet „Psyche“. Aus diesen Gründen sollen als nächstes die „Experten der Seele“, die „Psycho“-logen, zu Wort kommen, die schon anhand ihrer Berufsbezeichnung ausdrücklich versprechen, im Hinblick auf die Seele kompetent zu sein.
Die seelenlose Psychologie
Als Antwort auf die etwas sehr spekulative und wenig überprüfbare Gemüts- und Ausdruckspsychologie des 19. Jahrhunderts wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Augenmerk ganz bewusst nicht mehr auf die inneren Gefühle, Regungen, Motive, sondern nur noch auf die auf das Individuum einwirkenden, gut kontrollierbaren äußeren Reize und auf die beobacht- und messbaren Antwortreaktionen gerichtet. Alle inneren Prozesse und Beweggründe wurden bewusst außer Auge gelassen. Sie wurden symbolisch in eine sogenannte „schwarze Kiste“, in eine „Blackbox“ gepackt, die von außen weder einsehbar noch kontrollierbar war. Damit wurde die Seele sozusagen, gemeinsam mit allen anderen mentalen Prozessen, in ein gemeinsames Paket geschnürt. Diese Vereinfachung machte es zwar möglich, einfache und kontrollierte Lernexperimente, zum Beispiel mit Hunden, Affen, Ratten oder Tauben, durchzuführen. Die berühmte Versuchanordnung von PAWLOW, der die Speichelabsonderung eines Hundes nicht nur in Abhängigkeit von der konkreten Fütterung, sondern auch, nach einigen Versuchen, in Erwartung der Fütterung auf ein Glockenzeichen auszulösen vermochte, demonstrierte auf eindrückliche Weise die zunehmende Vernetzung der Neuronen und damit den Grundmechanismus des allgemeinen Lernens. Ausgehend von diesem Reiz-Reaktions-Schema der Behavioristen (WATSON, 1913, SKINNER, 1978) konnte das allgemeine Verständnis für die lernpsychologischen Gesetzmäßigkeiten geweckt und die Schlussfolgerungen zu einer erweiterten Theorie der Entwicklungsprozesse ausgebaut werden.
Plötzlich waren erstens die Anpassung des Individuums an die sich verändernden Umweltbedingungen, die Variabilität der lebenden Kreatur im Speziellen und die überragende Bedeutung des Lernens im Allgemeinen einsichtig geworden. Es war nun keine Frage mehr, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich ein Kind, ausgehend von den angeborenen genetischen Anlagen und dem erbgenetischen Programm, geistig und körperlich zu einem erwachsenen Menschen entwickeln würde. Es war nun mit einem Mal verständlich, wie man Krabbeln, Gehen und Rennen lernt, und der Weg, auch das Denken, Fühlen und Empfinden annähernd zu verstehen, schien nicht mehr weit. Aber kann das Konstrukt der „schwarzen Kiste“ das Forschungsobjekt Seele adäquat ersetzen?
Das Modell der Behavioristen war einerseits bestechend einfach und erleichterte den Aufbau einfacher Versuchsanordnungen. Das Pawlow’sche Lernexperiment war Anfang und Ausgangspunkt für eine Unzahl weiterführender Tierexperimente. Diese konnten aber der gesteigerten Neugierde der interessierten Wissenschaftler an den zentralnervösen Verarbeitungsprozessen bald nicht mehr genügen. Die Erforschung sogenannter „intervenierender Variablen“, der „kognitiven Karten“ (TOLMAN, 1948), der Entwicklung von Assimilations-Schemata nach PIAGET (1946) und schließlich der regelkreisgesteuerten Verhaltenseinheiten und deren Simulation mit dem Computer haben das Schwarze in der „Blackbox“ zwar erhellt. Damit waren einfache Lernprozesse simulierbar, steuerbar und Verhaltenssysteme in Grenzen manipulierbar geworden. Das Gehirn ist aber insofern mehr als ein Computer, als unser Wissen, das wir mit einem Computer verbinden, immer noch von dessen sehr begrenzten Möglichkeiten bestimmt wird. Seine Leistungen sind, wenn man sie mit denjenigen des zentralen Nervensystems vergleicht, immer noch sehr bescheiden, sehr mechanistisch, monodimensional, oberflächlich und einfach strukturiert. Sie sind noch weit entfernt von der überwältigenden Komplexität zentralnervöser Prozesse. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Verhaltenswissenschaftler den Begriff der Seele nicht akzeptieren, oder zumindest, etwas ängstlich aus dem Bewusstsein verdrängen.
Der Ansatz der Bevavioristen war zwar außerordentlich nützlich. Er zwang die Psychologen zu höchster wissenschaftlicher Disziplin. Er lehrte sie ferner, was es heißt, auf alle unbewiesenen Behauptungen beziehungsweise spekulativen Schlussfolgerungen konsequent zu verzichten. Er lehrte sie weiter die Folgerichtigkeit im Denken, die Sauberkeit in der Beachtung der gesetzten Grenzen und die Beachtung der vorsichtigen Interpretation. Und er machte letztlich deutlich, dass die Psychologen, besonders mit diesem Ansatz, bald an ihre Grenzen stoßen würden, wenn sie die Natur der mentalen Prozesse weiter erforschen wollten. Denn der Ansatz der Behavioristen zeigte deutlich noch etwas anderes, nämlich, dass die selbstgewählte Zurückhaltung sie nicht vor schwerwiegenden Irrtümern bewahren würde. Diese Zurückhaltung sollte nämlich für lange Zeit verhindern, dass vor allem die Praktiker, die klinisch orientierten Psychologen, auf dringende Fragen relevante Antworten erhielten.
Man ist nach diesem etwas weitschweifigen Exkurs so klug wie eh zuvor. Sowohl die Behavioristen wie auch McGinn können und wollen auf die Fragen nach dem Wesen der Seele, zwar aus ganz unterschiedlichen Motiven, keine Antwort geben. Während McGinn überzeugt ist, dass man aus der prinzipiellen Logik des Sachverhalts heraus das Wesen des Bewusstseins, und erst recht der Seele, niemals wird ergründen können, verzichten die Bevavioristen konsequent darauf, in diese Richtung zu forschen. Wenn sie sich in ihren Forschungsergebnissen und den entsprechenden Interpretationen dieser Ergebnisse nicht 100 %ig sicher sind, vermeiden sie Aussagen, und im Hinblick auf die Ausgangsfrage ist eben gar nichts sicher. Im Gegenteil, die Behavioristen verzichten nicht nur auf irgendwelche Stellungnahmen zum Wesen der Seele, sondern verzichten konsequenterweise sogar auf den Begriff. Was sie nicht messen und beweisen können, verliert ihren Sinn. Für sie ist die Seele ein relativ spekulatives, ideologieverdächtiges und entsprechend theoretisches Konstrukt, das erstens zum Verständnis des menschlichen Verhaltens wenig beitrage, und auf das man, aus besagten Gründen, ganz verzichten könne.
Dass es die Seele für die naturwissenschaftlich orientierte Forschung und Theoriebildung aber gar nicht gibt, hört sich geradezu grotesk an. Wie ist es möglich, dass ein Phänomen, das fast alle Menschen in ihrem Leben als etwas Zentrales und Wesentliches begreifen, und das auch in der Umgangssprache einen bedeutenden Begriff darstellt, nicht zu den bevorzugten Forschungsobjekten der Psychologie gehört? Man muss deshalb etwas ernüchtert feststellen, dass die Behavioristen eine klärende Antwort schuldig bleiben. Der Weg über die von ihnen vertretene experimentelle Psychologie bleibt den interessierten Lesern aus obgenannten Gründen vorläufig versperrt. Mit diesem Ergebnis konnte nicht gerechnet werden, und wir stehen zum zweiten Mal „am Anfang unseres Lateins“!
Zwei Schritte vor und einen zurück? Die Thesen von John C. ECCLES (1989)
Vielleicht findet sich aber ein anderer, erfolgsverheißenderer Zugang zu unserem Problem. Die Seele kann ja in ihren Strukturen nicht von eine...
Inhaltsverzeichnis
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Bemerkungen zum methodischen Vorgehen und zur konkreten Fragestellung
- III. Auf der beschwerlichen Suche nach einer Antwort
- IV. Die Bildung der seelischen Strukturen
- V. Die Seele ist in Gefahr!
- VI. Die Pflege der seelischen Gesundheit
- VII. Die Heilung der verletzten Seele
- VIII. Epilog
- Dank
- Literatur
- Werksverzeichnis