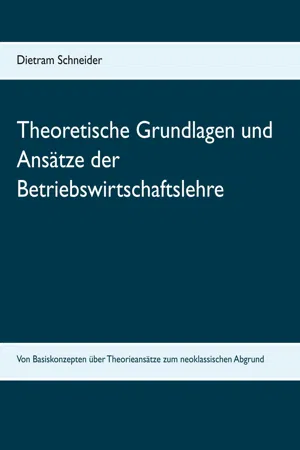![]()
II Theoretische Ansätze der Betriebswirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre kann sowohl als Wissenschaft als auch in ihrer praktischen Ausprägung im alltäglichen Managementhandeln aus unterschiedlichen Denkhaltungen, Traditionen und Perspektiven heraus betrachtet, gelehrt und betrieben werden. Je nach ansatzspezifischer Sichtweise erscheinen die im vorherigen Grundlagenkapitel I ausgeführten Gegenstandsbereiche, Aussagen, Methoden, Modelle usw. in anderer Ausprägung, Tiefe und Beziehungsstruktur.
Die Wahl des betriebswirtschaftlichen Ansatzes ist grundsätzlich frei. Einflussfaktoren sind beispielsweise subjektive Standpunkte und die – explizite oder implizite – Zugehörigkeit zu wissenschaftlichen Gruppierungen von Forschern bzw. Managern. Darüber hinaus spielt für die Wahl des Ansatzes – bzw. eines entsprechenden Bündels aus unterschiedlichen Ansätzen – die spezielle Forschungs- bzw. Sachfrage, die erörtert werden soll, eine wichtige Rolle. So empfiehlt es sich beispielsweise, die Beleuchtung von organisatorischen und/ oder personalwirtschaftlichen Phänomenen eher aus einer situativen und/oder sozial- und verhaltensorientierten (zusätzlich angereichert beispielsweise mit transaktionskostentheoretischen oder der Principal-Agent-Theorie entsprechenden Bezugspunkten) Betrachtungsweise vorzunehmen. Denn die Reichweite und die Reichhaltigkeit der Neoklassik oder des mechanistischen Ansatzes wären für organisatorische und personalwirtschaftliche Fragen sehr eingeschränkt. Denn beide Theorieansätze gehen von vergleichsweise realitätsfremden bzw. die Realität nur sehr vereinfacht darstellenden Organisations- und Menschenbildern aus.
Auch der historische Kontext spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei der Auswahl bzw. Bevorzugung theoretischer Ansätze. Die in diesem Kapitel dargestellten betriebswirtschaftlichen Theorieansätze sind weitgehend chronologisch geordnet und zeichnen damit auch die historischen Entwicklungslinien der Betriebswirtschaftslehre nach – auch wenn partielle zeitliche Überschneidungen bestehen. Je nachdem, in welchem zeitlichen Kontext beispielsweise gelehrt, geforscht und studiert wurde (bzw. wird), ergibt sich somit für Wissenschaftler, Lehrende, Studierende und Praktiker eine unterschiedliche „Ansatzbleiche“.
Der vorherrschende Zeitgeist und der Zwang, dem bzw. einem wissenschaftlichen Mainstream (der womöglich nur temporär Bestand hat) entsprechen zu wollen oder zu müssen, sind weitere Einflussgrößen bei der Wahl der theoretischen Ansätze.
Insgesamt betrachtet ist jede – und selbstverständlich auch die in diesem Kapitel getroffene – Auswahl betriebswirtschaftlicher Theorieansätze mit derartigen „Selektionsverzerrungen“ behaftet, die häufig implizit oder unbewusst ihre Wirkung entfalten. Ein solches Urteil trifft auch den Autor. Er sieht sich zwar grundsätzlich der Ansatzpluralität verpflichtet. Den einzelnen Ansätzen werden allerdings für ihre jeweilige Behandlung unterschiedliche Umfänge eingeräumt, wodurch man auf die genannten „Selektionsverzerrungen“ und persönliche Präferenzen des Autors schließen könnte.
Im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens und den dabei anzulegenden Kriterien (Systematik, Nachprüfbarkeit, Nachvollziebarkeit usw., vgl. dazu Kapitel I Punkt 2.2) spricht vieles dafür, die jeweils zugrundegelegten Theorieansätze entsprechend zu begründen und offen darzulegen. Diese Forderung stellt sich nicht nur für Forschungsprojekte, Habilitationen oder Dissertationen, sondern – wenn auch im verringerten Maße – ebenso für Diplomarbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten.
Zu beachten ist ferner, dass den hier im Vordergrund des Interesses stehenden betriebswirtschaftlichen Ansätzen allgemeine und übergeordnete wirtschaftswissenschaftliche Lehrmeinungen und Entwicklungslinien vorgelagert sind, deren Ausgangspunkte schon in der Antike gesehen werden können. Bereits in der griechischen Staatslehre finden sich wirtschaftliche Bezugsquellen und Wurzeln. Plato sah beispielsweise neben den Kriegern (Gewährleistung eines sicheren Staates) und den Philosophen (politische Leitung des Staates) in den Gewerbetreibenden (Gestaltung der wirtschaftlichen Strukturen des Staates) eine tragende Säule des Staates. Und vermutlich Aristoteles hat der Ökonomie schon rd. 350 Jahre vor Christus ihren Namen gegeben („oikonomia“). Ein sehr übersichtliches Werk über die wirtschaftswissenschaftliche Entwicklungsgeschichte – von der Antike und der Scholastik über den Absolutismus, Merkantilismus und Physiokratismus bis zur Klassischen Schule, dem Liberalismus sowie der Historischen und Sozialistischen Schule – liegt zum Beispiel von Breilmann (1999) vor.
![]()
1 Neoklassischer Ansatz
1.1 Allgemeines
Die Neoklassik fußt u. a. auf Arbeiten von Jevons (1871/1970) in England, Walras (1874) in Frankreich und Menger (1923) in Österreich. Die durch sie vorangetriebene Grenznutzenschule führte ab etwa 1870 zu einer Etablierung der Neoklassik, unter der die klassische Nationalökonomie schrittweise zu bröckeln begann. Die Neoklassik lieferte ein marginalanalytisches Instrument für eine mathematisch orientierte Modelltheorie. Sie bildet heute den weitgehend akzeptierten „Mainstream“ der Volkswirtschaftslehre, der sowohl auf die Betriebswirtschaftslehre als auch auf die betriebliche Praxis – teilweise sogar normativ – ausstrahlt (z. B. Forderungen nach Deregulierung, Privatisierung und nach „mehr Markt und weniger Staat“). Bei der Neoklassik steht vor allem das wirtschaftliche Paradigma und die Erreichung (bzw. Erhaltung) von Marktgleichgewichten unter den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz im Vordergrund (z. B. Seraphim 1963, Stavenhagen 1969).
Die Realität wird dabei sehr idealtypisch beschrieben. In der neoklassischen Welt – ein Begriff, der sofort verdeutlicht, dass die Neoklassik mit der realen Welt nichts gemein hat (vgl. dazu Tietzel 1985) – wird ein atomistischer Markt unterstellt. Es existieren viele Nachfrager und vielen Anbieter (Polypol). Die Anbieter verfolgen aus verschiedenen Gründen (hohe Konkurrenz, homogene Produkte, vollkommene Transparenz) keine Strategien, wie sie aus der Praxis bekannt sind (z. B. Qualitätsführerschaft, Kostensenkungsstrategie). Vielmehr verhalten sie sich in Anlehnung an das Mengenanpasserprinzip strategisch machtlos und passiv. Es herrscht ein vollkommener Markt (Homogenität der Güter und vollständige Markttransparenz). Außerdem wird ein freier Marktzutritt unterstellt. Dies bedeutet, dass keine institutionellen, informatorischen oder machtbedingten Marktzutrittsbarrieren bestehen und Tauschprozesse keine Kosten auslösen (dazu im Überblick z. B. Schneider 1988).
In dieser Modellwelt übernehmen Preise die Diffusion sämtlicher Informationen, die für Tauschprozesse erforderlich sind. Sie bilden die zuverlässigen Indikatoren für Güterknappheiten, über die alle Akteure genau informiert sind, weil von vollkommener Information ausgegangen wird – es gibt keine unentdeckte Knappheit und keine Informationsprobleme, weshalb auch auf Informationsvorteilen basierende Macht ausgeschlossen ist. Preisdifferenziale signalisieren Ungleichgewichte und unabgestimmte Märkte. Solange sie bestehen, ist noch kein Marktgleichgewicht eingetreten, weshalb weitere Tauschakte auf den Märkten erforderlich sind.
Der Mensch in seinen emotionalen, schöpferischen, findigen, intuitiven, zerstörerischen, aggressiven, unzulänglichen, verwundbaren usw. Charakterisierungen degeneriert in der Neoklassik durch das Menschenbild des homo oeconomicus zu einem maximierenden Reaktionsautomaten. Auch aufgrund des vollkommen informierten homo oeconomicus gibt es in der Welt der Neoklassik keinerlei Informationsvorteile, die gegenüber Tauschpartnern ausnutzbar wären (jeder ist schließlich homo oeconomicus). Niemand hat Informationsbeschaffungs-, -selektions-, -verarbeitungs- und/ oder -speicherprobleme. Und alle sind gleich mächtig bzw. gleich ohnmächtig.
Das Unternehmen wird mit einer Produktionsfunktion gleichgesetzt. Der Output eines Unternehmens ergibt sich in deterministischer Weise auf der Basis einer mathematischen Funktion (Output = f(Input)). Daher sind zum Beispiel Unter- und Überordnungsverhältnisse sowie Informations- und Kommunikationsprobleme und die daraus in der Praxis nicht selten resultierenden Reibungsverluste, Machtverhältnisse und Konflikte ausgeschlossen.
1.2 Kritik
Viele Autoren haben sich den Unzulänglichkeiten der Neoklassik gewidmet (z. B. Albert 1963, Kirzner 1978, Röpke 1980, Reekie 1984, Kunz 1985, überblickartig Schneider 1988). Neuerdings bekommt die Kritik an ihr durch Vertreter der so genannten „pluralen Ökonomie“ bzw. der „post-autistischen Ökonomie“ wieder verstärkt Auftrieb (vgl. z. B. Dürmeier u. a. 2006). Sie sprechen sich für eine Abkehr von der neoklassischen „Mainstreamökonomie“ aus und setzen sich u. a. für eine ökonomische Lehre ein, die auf vielfältigen ökonomischen Fundierungen und Richtungen basiert („plurale Ökonomie“).
Die Kritik an der Neoklassik entzündet sich zum Beispiel an der Vorstellung des Unternehmens als Produktionsfunktion. Denn sie abstrahiert von arbeitsteilig organisierten sozio-technischen Systemeigenschaften sowie von internen und die Unternehmensgrenzen überschreitenden Austausch- und Informationsprozessen. Damit geht der Blick sowohl für die Innenwelt als auch für die Außenwelt von Unternehmen verloren. Die Einbettungen von Unternehmen und ihrer Belegschaftsmitglieder in vertikal, horizontal und diagonal angeordnete Wertketten- und Organisationsstrukturen sowie deren ständige Veränderung im Zeitablauf, sind keine Themen. Gleiches gilt für die interne Organisation und interpersonale Austausch- und Führungsprozesse in Unternehmen, die Quellen für Konflikte darstellen und sich meist über längere Zeiträume erstrecken und von Machtbezügen überlagert sind. Dies hat der Neoklassik u. a. den Vorwurf eingebracht, dass sie das Unternehmen als „black box“ ansieht und Zeit als basale Dimension des Lebens und Wirtschaftens der Statik bzw. dem augenblickbezogenen Gegenwartsbezug opfert.
Der Hauptgegenstand der Betriebswirtschaftslehre, das Unternehmen (bzw. der Betrieb) in seiner pluralen Ausgestaltung, bleibt demnach in der Neoklassik unbeleuchtet. Die vielschichtigen Inputprozesse, die arbeitsteilig organisiert, geplant, gesteuert und disponiert werden und ausgehend von den Rohstoffen über zeitintensive und zahlreiche Veredelungsstufen erst zu Endprodukten führen, mutieren in der Neoklassik zu einer mathematisch determinierten Funktion, die den Output quasi automatisch und ohne Zeitverzögerung auswirft. Wie dieser Output entsteht – und welche vorgelagerten kreativen Forschungs- und Entwicklungsschritte sowie intuitiven (menschlichen) Fähigkeiten dazu erforderlich waren –, interessiert ebenso wenig, wie die Zeit als Grunddimension. Innovation und Produktion, die dem Output in der Realität vorgelagerten und in aller Regel sehr zeitintensiven Stufen, bleiben außerhalb der Betrachtung. Nur der gegenwärtige Output, für den über den Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve die Preisfestlegung auf den Märkten in Sekundenschnelle erfolgt, steht im Mittelpunkt. Nicht die Handlungen interessieren, sondern nur die Ergebnisse des Handelns im Sinne ihrer marktlichen Verwertung. Überspitzt ließe sich daher formulieren: „Output frisst Inhalt und Gegenwart frisst Vergangenheit und Zukunft“.
Der kurzfristige (Spot-) Markt gilt als einziges Koordinationsmedium, der in rasender Geschwindigkeit Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht bringt (darüber können auch die Search-Behaviour-Modelle nicht hinwegtäuschen, weil sie grundsätzlich in der Analysestruktur der Neoklassik verbleiben). Er ist Weltmarkt und zugleich völlig transparenter Punktmarkt, ohne dass die Wirtschaftssubjekte räumliche Präferenzen hä...