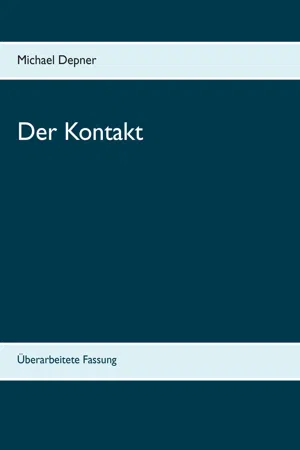![]()
III. Regeln
1. Die Struktur des „reinen“ Kontakts
1.1. Der Homunkulus kämpft um die Entscheidung
Die Psychotherapie befasst sich mit der Psyche. Sie geht meist davon aus, dass das Wesen der Seinsform „Psyche“ grundsätzlich bekannt ist und dass nur seine jeweils individuellen Charakteristika weiterer Erforschung bedürfen.
Wie das Denken der Menschen von alters her, so ist auch das unsere konkretistisch. Wir neigen dazu, Abstraktes zu substantivieren. In Ermangelung differenzierter Vorstellungen versehen wir komplexe dynamische Phänomene mit einem „der“, einem „die“ oder einem „das“ und sprechen dann von „der Liebe“, „der Psyche“, „der Seele“, „der Beziehung“ und „der Depression“. Ohne uns über diesen Husarenstreich der Einfalt zu wundern, tun wir so, als seien die nun zu Substantiellem deklarierten Dynamiken genauso zu handhaben, wie jene materiellen Dinge, die tatsächlich aus Substanz bestehen und daher ohne Verkürzung durch Substantive benannt werden können. Wir haben dann eine Seele, eine Beziehung und eine Depression. Wir suchen nach der große Liebe wie nach einer verlorenen Wertsache - Verflucht noch mal! Wo ist sie denn? - und wir trennen uns von ihr, wenn sie unseren Ansprüchen nicht mehr entspricht.
Das Wort „Substantiv“ kommt von lateinisch „sub-stare = darunterstehen“. Wer mit Dingen zu tun hat, die darunter stehen, meint, dass er selbst darüber steht und den Umfang, die Ausdehnung und den Horizont des Substantiellen, über das er sich erhebt, von oben überblickt. Solange man erkenntnistheoretisch keine Perfektion verlangt, trifft dieser Anspruch tatsächlich Sächlichem gegenüber in ausreichendem Maße zu. Leichtsinnig35 wird man aber, wenn man mit den von der menschlichen Einfalt verdinglichten Phänomenen genauso verfährt - und wer tut das nicht? Dann redet man über die Liebe, als wisse man, was das ist, und über die Psyche, als sei schon lange klar, dass es sich bei der Psyche um einen virtuellen Homunkulus namens „Ich“ handelt, der im menschlichen Gewebe sitzt und sich mit mehr oder weniger Fortüne an der Produktion erfolgreicher Verhaltensweisen versucht. Hat sich der Homunkulus ein neues Projekt ausgedacht, für das er einen Mitmenschen braucht, gibt er seinen Sprechwerkzeugen den Befehl ‘Bitte Kontakt zu Zielperson A aufnehmen’ und wenn er bekommt, was er will, geht es ihm gut. Leider sind die Fähigkeiten des Homunkulus, erfolgreiche Handlungsprogramme zu entwerfen, fruchtbare Geschäftsverbindungen zu anderen Homunkuli zu knüpfen und die eigene Software ans Laufen zu bringen jedoch beschränkt; oder das Umfeld wirft ihm in boshafter Weise zu viele Knüppel in den Weg! Dann wendet er sich an einen Psychotherapeuten, damit der am psychischen Apparat die suboptimalen Funktionen maximiert.
Irgendwie ist es so. Jedenfalls kann man mit diesem Denkmodell eine Menge erreichen. Wahrscheinlich ist es aber auch anders. Der Homunkulus „Ich“, der einmal mehr das Herz und einmal mehr das Hirn seines Wirtskörpers bewohnt, betrachtet sich in diesem Denkmodell als ein Individuum, das bis auf ein paar lästige Abstriche autonom seine Existenz verwaltet und im Rahmen seiner egozentrischen Verwaltungstätigkeit mehr oder weniger lebhafte Außenkontakte unterhält, über deren Kanäle es die Vorgänge seiner Lebendigkeit abwickelt. Allgemein akzeptiertes Ziel dieser Umtriebigkeit ist es heutzutage, das Dasein des Ichs möglichst angenehm zu gestalten; jedenfalls steht es so in so mancher modernen Verfassung. In diesem Modell glaubt das Ich, es sei da, wo sein Körper ist und nehme von diesem aus Kontakt zu anderen Ichs auf, die sich dort in den benachbarten Körpern befinden. Verschiedene Burgherren schicken sich über die trennenden Abgründe individueller Einzelexistenzen hinweg mit gelehrigen Brieftauben Botschaften zu und niemand käme auf den Gedanken, die Tauben dabei als Teile ihrer Herren zu betrachten. Souverän knüpft ein Burgherr diplomatische Beziehungen zum Souverän der benachbarten Autarkie und zum derart definierten Ich gehört nur, worauf nichts anderes direkten Einfluss hat.
Obwohl dieses Modell zur Absicherung der legitimen Rechte des Einzelnen unerlässlich ist, greift es zur Erklärung des menschlichen Wesens zu kurz. Egal welche Gaben Kindern nämlich genetisch bereits in die Wiege gelegt werden, wenn man sie ohne Kontakte zu Menschen aufwachsen lässt, werden aus ihnen bestenfalls unglückliche Kreaturen, aber keine Individuen in unserem Sinne.
Von Geburt an lebt man in einem Gefüge von Kontakten wachsender Komplexität. Die erwachsene Persönlichkeit entwickelt sich erst als besonderer Pol aus dieser Beziehungsdynamik heraus. Die Annahme einer autonomen Individualität innerhalb der Grenzen des Ichs wird aus einem fluktuierenden Muster von Begegnungen herausabstrahiert. Dies legitimiert sich zwar durch den relativ guten Erfolg dieser Arbeitshypothese im täglichen Leben, führt aber zu unrealistischen Vorstellungen, wenn man unkritisch meint, die Existenz dieses alltäglich erfahrbaren Ichs gehe ihrer Kontaktaufnahme mit anderen Ichs zeitlich voraus und belege damit das Ich als den strukturellen Träger der individuellen Autonomie36. Das Ich ist zu seiner Existenz jedoch auf die Begegnung mit dem Du angewiesen und über Ichs, die ohne Kontakt zu einem Gegenüber etwas von sich wüssten, ist nichts bekannt. Es ist also anscheinend so, dass die Brieftauben nicht nur Werkzeuge, sondern Organe der Burgherren sind und dass das Ich und das Muster seiner Begegnungen eine untrennbare Einheit bilden.
Meist erlebt das Ich sich selbst unklar. Zum einen glaubt es, bereits eine autonome Entität zu sein. Zum anderen identifiziert es sich heftig mit dem Netzwerk seiner egozentrischen und innerweltlichen Interessen, die nur in unauflösbarer Verzahnung mit der Welt - also dem Nicht-Ich - als faktische Realitäten wahrgenommen werden können und deren Akzeptanz als Selbstobjekte37 damit jeder echten Autonomie widerspricht. Dieser Widerspruch löst sich nur auf, wenn man die Pole der seelischen Existenz38 nicht mehr durcheinanderwirft. Denn einerseits gibt es das Selbst als wirklich autonome Einheit, die befreit von jeder Beengung keine konkurrierenden Partikularinteressen in der Welt vertritt, andererseits gibt es ein Ich, das sich zwar so egozentrisch gebärdet, als sei es der Nabel der Welt, das bei genauer Betrachtung jedoch kaum so viel echte Autonomie besitzt, als dass all seine egozentrischen Bemühungen letztendlich nicht doch den angestrebten Thron verfehlten und das deshalb nur als ein unterworfenes Teilstück des Weltgefüges aufgefasst werden kann. So ist man bloß ein Teil des Ganzen, solange man sich für das eigene Ego entscheidet und erst wenn man sich dem Ganzen ohne definiertes Interesse überließe, würde man tatsächlich zu sich selbst. Wirklich autonom erlebt sich das Bewusstsein also nur, wenn es absolut auf all das verzichtet, worin es sein Ich von anderen grundsätzlich zu unterscheiden glaubt. Zwischen diesen Polen seiner Existenz bemüht sich der Homunkulus um die Entscheidung, wer er wirklich ist.
Natürlich heißt das nicht, dass ein Ich permanent im Blickkontakt zu jemand anderem stehen müsste, um zu existieren. Üblicherweise sagt man: Erst wenn eine Vielzahl von gelungenen Kontakten verinnerlicht ist und das Ich über stabile Objektrepräsentanzen39 verfügt, wird es fähig, von sich dergestalt abzulassen, dass es sich selbst begegnet. Erst dann wird das Ich selbst-bewusst - also dessen bewusst, dass es über alle Flüchtigkeit des Seins hinweg von seinem Selbst getragen wird - und erst als ein seiner selbst und seiner Grenzen bewusstes Wesen kann das Ich sich reflektiert und sachgerecht Problemen widmen, ohne vom Erfordernis der Probleme fremdbestimmt zu sein.
Aber man kann es auch so sagen: Das Ich wächst durch differenzierende Kontakte, sodass die Kontakte nicht nur seine Funktion und Zeichen seiner seelischen Aktivität, sondern ein wesentlicher Teil seines Gewebes sind. Und wenn Kontakt als Organ zum Organismus der Psyche gehört, dann ist es ein Organ, das verschiedenen Ichs gemeinsam ist und es ist jenes Organ, über dessen Formbarkeit ein Psychotherapeut die Psyche des Klienten erreicht.
1.2. Psychopathologie als Kontaktpathologie
Die Quelle aller psychologischen Erkenntnis ist der Kontakt. So prägnant darf man es sagen, wenn man die wenigen Ausnahmen einmal ausklammert, ohne sie ganz aus dem Gedächtnis zu streichen. Zwar stammen einige Erkenntnisse tatsächlich aus Verhaltensbeobachtungen isolierter Personen - zum Beispiel halluzinierender oder katatoner Psychotiker - oder aus ausgeklügelten Versuchsanordnungen der experimentellen Psychologie, doch sind die so gesammelten Einsichten in die Dynamik des Seelenlebens dürftig. Der ganz überwiegende Teil des psychologischen Wissens stammt aus der Betrachtung zwischenmenschlicher Kontaktsequenzen, und die Ausnahmen davon bestätigen die Regel.
Selten stehen die Untersucher dabei außerhalb, zum Beispiel hinter einer Einwegscheibe und beobachten aus der Ferne, was andere miteinander machen. Meist ist der Untersucher selbst Teil des Kontakts, aus dem er seine Erkenntnisse schöpft. Entweder indem er die Strukturen des aktuellen Kontakts erfasst, oder indem er den Kontakt dazu benutzt, andere zwischenmenschliche Begegnungen zu analysieren.
Einen wesentlichen Teil seiner Erkenntnisse gewinnt der Untersucher introspektiv. Zum einen weil er in der Selbsterfahrung die Rolle des Klienten übernimmt, der an Hand erinnerter oder phantasierter Kontaktsequenzen seine seelischen Reaktionen studiert und zum anderen, weil er sich selbst in der Rolle als Therapeut nicht als eine objektive Größe verkennt. Er trägt dort vielmehr der Tatsache Rechnung, dass er selbst in jeder Begegnung von der ihr innewohnenden Dynamik erfasst wird und er sich zum besseren Verständnis des Geschehens in die Untersuchung miteinbezieht.
Das Wesentliche jedenfalls ist, dass das Kontaktverhalten des Klienten Hauptinhalt jeder Therapie ist und dass die Untersuchung „intrapsychischer“ Vorgänge zwar logische Konsequenz, aber nur sekundäre Folge der Fokussierung des Kontaktverhaltens ist. Zwar kommt so mancher Klient mit Symptomen in die Therapie, die auf den ersten Blick nichts mit anderen Menschen zu tun haben - Phobien oder Panikattacken, Zwänge oder depressive Verstimmungen zum Beispiel - doch kommt man immer, wenn man diesen Dingen auf den Grund geht, zu einem Muster gestörter Sozialbeziehungen und pathologischer Kontakte.
Diese Tatsache und die oben versuchte Beschreibung einer einheitlichen Genese von Psyche und Beziehung führen zur These, dass man Psychopathologie auch als Kontaktpathologie beschreiben kann. Wenn man das tut und davon ausgeht, dass Kontakt nicht nur eine schillernde Funktion sozial aktiver Einzelseelen ist, sondern ein übergeordnetes ontisches Phänomen, geht man implizit auch davon aus, dass es eine gesunde, adäquate und im bestem Falle mit der eigenen inneren Gesetzmäßigkeit stimmige Form des Kontakts gibt und dass die krankhaften Variationen mehr oder weniger von diesem Ideal abweichen.
Allerdings, so muss betont werden, soll diese archetypische Sonderform des Kontakts, deren Beschreibung hier versucht wird, nicht als einheitliches Ideal aller gesunden Formen zwischenmenschlicher Beziehungen postuliert werden. Die Gesundheit einer Beziehung misst sich nicht daran, ob durchgehend ein Höchstmaß an Begegnungsintensität erreicht wird. Das könnte niemand aushalten. In der gesunden Beziehung sind aber solche Momente intensiver Begegnung möglich und in ein wechselndes Muster positiver Variationen geringerer Intensität eingebettet. Kranke Beziehungen zeichnen sich durch starre Muster negativer Variationen aus und echte Begegnungen intensiver Art fehlen. Was im kranken Kontakt als intensiv imponiert, ist nicht die Begegnung, sondern das Ausagieren pathologischer Muster, die immer mehr oder weniger autistisch bleiben.
Die reine ( = ausgesiebte ) Form des mit sich stimmigen Kontakts ist nicht der therapeutischen Situation vorbehalten, sondern die ontische Urform, an der sich alle interindividuellen Kontakte orientieren. Der Begriff „reiner Kontakt“ kann jedoch als synonym mit dem Begriff „therapeutischer Kontakt“ verwendet werden, weil die Qualität der alltäglichen Kontaktvarianten des Klienten davon abhängt, welche positive Begegnungsintensität er erlebt und damit verinnerlicht hat. Je reiner ein Mensch begegnen kann, desto freier ist er im Kontakt zu seiner Umwelt. Schon aus ökonomischen Gründen ist es daher Aufgabe des Psychotherapeuten, eine größtmögliche Kontaktintensität herzustellen, damit sich das Repertoire an Beziehungsmöglichkeiten beim Klienten neu strukturieren kann. Weniger intensive Begegnungsformen zwischen Therapeut und Klient sind selbstverständlich wirksam. Je oberflächlicher der interpersonelle Kontakt jedoch bleibt, desto länger dauert es, bis er wirkt und desto flacher wird die Wirkung sein. Da Kontakt nicht nur Funktion, sondern Teilstruktur der Psyche ist und zwar jene Teilstruktur, die Veränderungen von innen nach außen und von außen nach innen vermittelt, ist eine größtmögliche Kongruenz des therapeutischen Kontakts mit den Regeln des reinen ontischen Phänomens „Kontakt“ die beste Voraussetzung für eine gute Wirksamkeit.
Um Hinweise auf jene Form des Kontakts zu bekommen, die mit ihrem Wesen stimmig ist, wurden in den ersten drei Kapiteln dieses Buchs die Begriffe „Kontakt“, „Berührung“ und „Verbindung“ etymologisch untersucht. Grundidee war, dass sich in den Bedeutungen der verschiedenen Verwandten der drei Wörter die Bedeutungsfacetten eben dieser Wörter in allen Farben spiegeln, sodass man die Vielfalt des ganzen Phänomens im Prisma seiner Assoziationen erkennt.
Dieses Vorgehen hat eine Reihe von Ergebnissen erbracht, deren Bedeutung für die Struktur des „reinen Kontakts“ näher bestimmt werden soll. Dazu werden einige der etymologisch gewonnenen Begriffe erneut aufgegriffen und dahingehend untersucht, welche relevanten Themen sie ansprechen. Die Hinweise werden dann entsprechend bestimmter Themen gruppiert, die sich bei der Synopsis der Ergebnisse herauskristallisieren. Jedem Thema wird ein Charakteristikum des „reinen Kontakts“ entsprechen. Wie man dabei sehen wird, überschneiden sich die Bilder, die den unterschiedlichen Überschriften zugeordnet sind, sodass ein Gewebe von Vorstellungen entsteht, in dem die wesentliche Struktur des „reinen Kontakts“ hängen bleibt.
1.3. Vom Wort zu den Kriterien des „reinen“ Kontakts
1.3.1. Mit
„Mit“ meint „einschließlich, inbegriffen“ und ist somit der Inbegriff von Zugehörigkeit und (→) Integration. Die Zugehörigkeit einer Person, die in ihr Umfeld integriert ist, bedeutet jedoch mehr als ein Dabeisein, in dessen Folge die Person quasi als Lohn dafür, dass sie zu ihrem Umfeld passt, passiv dessen Schutz genießt. Echte Zugehörigkeit bedeutet, dass man im selben Maß auf das Umfeld einwirkt, wie man dessen Impulse empfängt. Zugehörigkeit ist eine Integration von Aktivität und Passivität, von Ausdruck und Hinnahme, von expansivem Impuls und Berührbarkeit. Die echte Integration beruht auf (→) Gegenseitigkeit. Individuen, die auf die aktive Einwirkung auf ihr Umfeld verzichten, sind daher sozial desintegriert, selbst wenn sie ein Leben lang nicht auffallen40.
„Mit“ bedeutet also nicht nur, dass man dabei ist, sondern auch, dass man mitmacht. Wenn man sich auf die Dynamik...