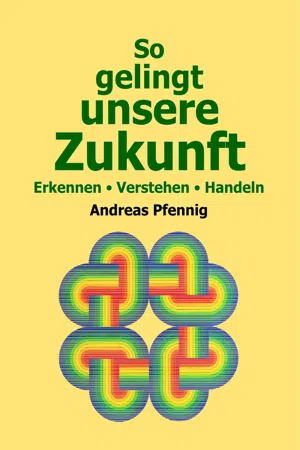![]()
1 Leben, Tod und Sterben
Schon morgens wird in der Arbeitsgruppe erzählt: Manik ist wieder da (Name geändert). Nachdem er über zwei Monate in seiner Heimat Indonesien war, ist er – völlig unangekündigt – wieder da. Einfach so. Ich habe in diesen zwei Monaten nur zwei vereinzelte E-Mails von ihm erhalten, die von seinem Schicksal berichten. In seinem gebrochenen Deutsch hat er versucht zu schildern, was ihm begegnet ist. In der Gebrochenheit der Sprache hilflos und doch überdeutlich.
Nach meinen ersten Arbeitsterminen, in einer kurzen Pause bevor lange angekündigte Gäste eintreffen, finde ich nur kurz Zeit Manik zu sehen. Da steht er vor mir. Kaum 1,50 m groß und schmächtig. Ein kleiner Mensch in all seiner Zerbrechlichkeit. Und dann erzählt er: „Weißt Du, ich bin nach Indonesien gefahren. Meine Schwester wollte heiraten. Die Gäste sollten in einem Hotel wohnen. Das Hotel war gebucht. Und dann war das Erdbeben in meiner Stadt, in Padang.“ Er erzählt das langsam und suchend, nach Worten des Deutsch ringend. Das hat er mir auch schon in den zwei E-Mails geschrieben, aber ich lasse ihn sprechen, denn das Hervorbrechen der Gedanken und das Ablaufen seiner inneren Bilder möchte ich nicht – will ich nicht – unterbrechen. „Und alle Häuser sind kaputt. Das Hotel ist kaputt. Die Hochzeit fand dann nicht statt.“ Das scheint fast harmlos, denn ich weiß, was er mir schon in den E-Mails geschrieben hat. Gleichzeitig fühle ich mich so hilflos. Da steht er vor mir, dieser kleine Mensch, Manik. Mit allen seinen schmerzlichen Erfahrungen und Erinnerungen, über die er erzählt. Und ich stehe vor ihm, 1,90 m lang, sonst eher in Jeans aber heute wegen der Gäste in Anzug und Krawatte. Für diese Begegnung, bei der ich nur Mensch sein möchte, völlig unangemessen gekleidet, so, als wollte ich mich hinter der Anzug-Fassade verstecken. Aber ich fühle mich ganz als Mensch gegenüber diesem kleinen Menschen, fühle, wie meine Arme hilflos zu beiden Seiten meines Körpers herunterbaumeln, sinnlos, zwecklos, da sie mit Zupacken hier das Geschehene nicht mehr verändern können. Und dann nochmal: „Die Häuser sind kaputt. Und meine Großmutter konnte nicht mehr gut gehen.“ Wieder ringt er nach Worten. Also nehme ich es ihm ab. „Deine Großmutter ist gestorben.“ „Ja, meine Großmutter ist tot.“ Gleichzeitig sehe ich dieses imaginäre Bild vor mir von einem eingestürzten Haus, aus dem die Großmutter nicht mehr entkommen konnte. Manik steht davor und kann nicht mehr helfen.
Manik erzählt dann weiter, wie er dort geblieben ist. Er spricht in suchendem Deutsch, immer wieder unterbrochen von seinem nach dem richtigen Wort fragenden und für ihn so typischen „was ist das?“, das er bei jeder Wortsuche in den Satz einflicht, auch durchaus mehrmals in einem Satz. Nach drei Tagen kamen die indonesischen Hilfstrupps, nach einer Woche die internationale Hilfe. In den ersten drei Tagen war es schon alleine schwer auch nur Essen und Wasser zu besorgen, weil alles zerstört war. Es ging wirklich zuerst nur um das nackte Überleben. Manik hilft dann den internationalen Hilfsgruppen, indem er dolmetscht. Er begleitet eine Hilfsgruppe aus Ungarn. Viele Menschen in Indonesien können kein Englisch. Er kann Englisch. Also übersetzt er. Und dann erzählt er noch von dem Dorf unterhalb des Berges, das durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Er berichtet, dass sie praktisch keine Überlebenden gefunden haben aber auch keine Leichen, weil alles verschüttet war. Es hat nur schrecklich nach Verwesung gestunken.
Manik hat Schlimmes gesehen und erlebt. Und ich stehe da – hilflos stehe ich vor ihm. Und jetzt muss ich in den Seminarraum, denn es ist Zeit für die Gäste. Gleichzeitig weiß ich: Mit Manik muss ich noch einmal darüber sprechen, mit mehr Ruhe und ohne den nächsten Termin im Nacken. Ich möchte mehr wissen von dem, was er erlebt hat. Und er muss darüber sprechen können.
Sein Hiersein bekommt durch das Geschehene eine völlig andere Qualität. Wieso ist er eigentlich schon wieder hier? Gäbe es nicht viel wichtigere Dinge für ihn zu tun bei ihm zu Hause, in seiner Heimat? Für ihn ist das Hiersein anscheinend wichtiger. Er erzählt, dass er hier viel lernen möchte und später vorhat, zurück in seinem Land durch Beratung den Politikern zu helfen, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft Indonesiens zu treffen.
Später habe ich mehr Zeit und gehe zu Manik, ohne einen nächsten Termin danach. Ich frage ihn noch einmal nach dem Erdbeben und dem Erlebten. Neben weiteren Erzählungen zeigt er mir Bilder auf seinem Computer: das eingestürzte Hotel, in dem die Hochzeitsgäste untergebracht werden sollten, der abgerutschte Hang, unter dem eine Siedlung verschwunden ist, aber auch Manik, wie er mit Helfern zusammensteht oder mit Regierungs-Offiziellen. Dabei ist auch ein Foto aus einem Fenster heraus, bei dem der Erdrutsch gezeigt ist, der gerade genau bis an die Hauswand dieses Hauses reicht: Glück im Unglück gehabt. Die Bilder erzählen eine überdeutliche Geschichte von dem Unglück, das die Menschen in Padang und Umgebung ereilt hat.
Die Auseinandersetzung mit solch einschneidenden persönlichen Ereignissen, zu denen auch der Tod nahestehender Menschen gehört, führt einen unweigerlich zu den zentralen Fragen nach Leben, Tod und Sterben, aber auch nach Gott und nach dem Sinn des eigenen Lebens. Diese Fragen sind auch Thema in diesem Buch. Wenden wir uns zunächst den vielleicht für uns persönlich schwierigsten Fragen zu, denen nach Leben, Tod und Sterben, die offensichtlich eng miteinander verknüpft sind. Die weiteren Fragen sind späteren Kapiteln vorbehalten.
Über meinen eigenen Tod wirklich nachzudenken ist mir zunächst sehr schwer gefallen, auch wenn mir rational natürlich immer klar war, dass mein Sterben unausweichlich ist1. Zunächst habe ich einfach Angst davor, nicht mehr zu sein. Diesen Zustand des Nicht-Seins kann ich mir nicht wirklich vorstellen und das an sich macht mir bereits Angst. Sich vorzustellen, dass die eigene Person, die da gerade denkt, nicht mehr existiert, ist auch logisch nicht ganz trivial. Man muss das eigene Denken weg-denken. Es kommt zum Denk-Ende des Denkenden. Das triviale Argument, das man gegen die Angst vor dem Nicht-Sein oft hört, dass wir ja auch vor unserer Geburt letztendlich in dem gleichen Zustand des Nichtseins waren, hilft da nur wenig, denn damals haben wir dies nicht vorausgesehen. Es gab uns, die wir hätten Ängste haben können, ja noch gar nicht. Da Ängste sich immer auf zukünftige Ereignisse beziehen, hatten wir nie Angst, vor unserer Geburt nicht zu sein. Dennoch hilft dieses Argument vielleicht ein wenig, wenn man sich so bewusst macht, dass wir genauso das eigene Nichtsein nicht mehr wirklich erfahren werden. Solange wir denken und empfinden, werden wir uns als denkende und empfindende Wesen wahrnehmen. Wenn wir nach dem Tod nicht mehr denken und empfinden, werden wir dies eben nicht mehr mit-er-leben. Wir können uns dies vielleicht vorstellen wie das Einschlafen in einen traumlosen Schlaf, aus dem wir nicht mehr erwachen.
Neben der direkten Angst vor dem Nichtsein gibt es weitere Facetten der Angst vor dem eigenen Tod. Wir planen den nächsten Tag und unsere weitere Zukunft. Dass da ein Zeitpunkt ist, jenseits dessen diese Planung für uns völlig sinnlos ist, können wir anscheinend nur schwer akzeptieren. Alltäglich werden wir zwar von gewissen Abweichungen zwischen unseren Planungen und der sich dann einfindenden Realität immer wieder eingeholt. Die prinzipielle Unplanbarkeit nach dem Tod ist allerdings fundamentaler und löst wiederum Ängste aus. Aber bereits wenn wir realisieren, dass ein wesentlicher Bestandteil der Ängste die Furcht vor der Unplanbarkeit ist, kann auch dies die Angst vor dem Tod an sich bereits wieder ein wenig weiter relativieren.
Ein weiterer Auslöser für Ängste ist wohl die Angst vor dem Prozess des Sterbens. So habe ich beispielsweise Angst davor, durch einen Unfall oder durch eine Krankheit zu sterben, und dadurch in meiner letzten Lebenszeit sehr große Schmerzen ertragen zu müssen. Das ist für mich persönlich die eigentliche Angst: die Angst vor dem Sterben und nicht die vor dem Tot-Sein.
Was haben wir beim Sterben an sich zu erwarten? Dem Sterben am nächsten sind Menschen gekommen, die wiederbelebt wurden und von denen einige über ihre Nahtoderfahrungen berichten. In diesen Berichten können wir nach Anhaltspunkten suchen für das, was uns beim Sterben erwartet. Auf die Nahtod-Berichte zur Klärung dieser Frage Bezug zu nehmen, ist gerechtfertigt, weil die Berichte eine ganze Reihe von immer wiederkehrenden Elementen enthalten, so dass wir davon ausgehen können, dass zumindest einige Elemente aus dem Berichteten womöglich auch für unser eigenes Sterben übertragbar sind. Menschen, die kurzzeitig klinisch tot waren und dann wiederbelebt wurden, beschreiben das Sterben fast immer positiv. Teilweise haben sich Menschen mit Nahtoderfahrungen daher sogar gegen die Rückkehr ins Leben ‚gewehrt‘. Beschrieben wird beispielsweise, dass man sich beim Sterben auf eine sehr weiße aber gleichzeitig außerordentlich emotional warme Lichtquelle zubewegt. Man fühlt sich dabei völlig angenommen. Auf dem Weg begleiten und unterstützen einen bereits verstorbene Angehörige und Freunde. Menschen mit Nahtoderfahrung berichten auch, dass sie nach dieser Erfahrung keine Angst mehr vor dem Sterben haben. Sie brauchen dann ja offensichtlich keine Angst mehr vor dem Unbekannten zu haben. Sie kennen es schon und hatten es zudem als durchaus nicht negativ erfahren. Die Details der Nahtoderfahrung sind dabei von der jeweiligen Kultur deutlich geprägt. Bei Hindus in Indien tauchen bei den Berichten beispielsweise heilige Kühe als Motiv auf, was im europäischen Kulturkreis fehlt. Von manchen wiederbelebten Selbstmördern wird dagegen berichtet, dass die Nahtod-Erfahrung sehr negativ war, geprägt von Ängsten und Zweifeln.
Natürlich haben wiederbelebte Menschen den Prozess des Sterbens offensichtlich noch nicht wirklich bis zum Ende vollständig durch-‚lebt‘, sie wurden ja ins Leben zurückgeholt. Die letztendlichen Ängste vor dem Sterben an sich können uns durch die Berichte von Nahtoderfahrungen also wenn überhaupt auch wieder nur partiell genommen werden.
Trotz der letztendlichen Zweifel können wir aber versuchen, aufbauend auf der Gesamtheit der Berichte zu Nahtoderfahrungen ein einigermaßen konsistentes Bild von dem zu entwerfen, wie wir das Sterben an sich eines Tages erleben werden. Beim Erlöschen des Lebens laufen im Gehirn anscheinend grundlegende Prozesse ab, die im Wesentlichen universell sind. Die individuell wahrgenommenen Inhalte dieser letzten Gehirnaktivitäten hängen allerdings neben kulturellen Einflüssen auch wesentlich von den persönlichen Erfahrungen und von den Gedanken kurz vor dem Sterben ab. Die Zweifel von Selbstmördern an dem Freitod verstärken sich im Sterben – soweit das mitteilbar ist – zu schrecklichen Sterbeerfahrungen. Fehlt der Zweifel, sind die Wahrnehmungen beim eigenen Sterben wohl insgesamt eher soweit ertragbar, teilweise sogar so positiv, dass wir keine Angst davor haben müssen. Dies passt auch zu den Berichten, die ich von Freunden und Verwandten gehört habe, die das Sterben anderer Menschen miterlebt haben. Der ‚letzte Schnaufer‘ war häufig ein eher friedlicher. Es scheint also so – soweit wir dies erahnen können –, dass unsere letzten wesentlichen Emotionen vor dem Sterben auch im Sterben das Er-‚lebte‘ mit beeinflussen. Umso wichtiger scheint es mir, bewusst seinen persönlichen Frieden mit dem eigenen Sterben gefunden zu haben, um so angstfrei wie möglich dem eigenen Tod begegnen zu können, wenn er einen denn eines Tages ereilt.
Was kann man daraus als Fazit ziehen? Der Tod ist nicht planbar. Er kann uns prinzipiell in jeder Sekunde ereilen. Wenn unser Erleben im Sterben auch von den Emotionen kurz vorher abhängt, so ist es wohl hilfreich, wenn wir versuchen dem Tod so akzeptierend wie möglich gegenüberzustehen und unsere Ängste abzubauen. Für mich selbst ist daher die Bewusstmachung dieser Zusammenhänge wichtig, denn so bin ich prinzipiell auf das Sterben vorbereitet und kann mich mit dem Tod – soweit wie dies im Vorhinein überhaupt möglich ist – ‚anfreunden‘. Zwar werden einem womöglich Gedanken durch den Kopf schießen, welche die Hinterbleibenden betreffen, deren emotionale Schmerzen und Sorgen wie sie womöglich nach dem eigenen Ableben weiter leben und wie sie versorgt sein werden. Diese Sorgen können je nach aktueller Lebenssituation sicher sehr berechtigt und drängend sein, beispielsweise wenn kleine Kinder zu versorgen sind oder wenn man selbst der Hauptverdiener in der Familie ist. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass wenn der Tod denn wirklich ‚anklopft‘, man dies nicht ändern kann und einem nur bleibt, ihn mit einer möglichst entsprechenden Gelassenheit anzunehmen. Ich möchte dabei nicht den Eindruck erwecken, von irgendeiner morbiden Todessehnsucht oder Ähnlichem befallen zu sein. Ich glaube allerdings, dass wir üblicherweise den Tod so zu einem Tabuthema machen, dass eine durchaus sinnvolle Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod eher unterdrückt wird. Für mich selbst war es wichtig, dieses Tabu zu durchbrechen, weil ich eigentlich keinen wirklichen Grund für dieses Tabu sehe. Der Tod ist natürlicher Teil von jedem Leben. Dabei realisiere ich sehr wohl, dass unsere diffusen Ängste das Tabu unterstützen, wir uns also ungerne mit diesem Thema auseinandersetzen, weil wir womöglich Angst haben, dann mit unseren Urängsten unmittelbar konfrontiert zu sein und sie aushalten zu müssen.
Diese Überlegungen können einem zwar in gewisser Weise bezogen auf das eigene ‚Sterben an sich‘ helfen. Sie sind allerdings nicht relevant bezüglich der Angst vor großen Schmerzen beim Sterben. Aber auch hierzu gibt es einen gewissen Trost. Entweder die Schmerzen sind langanhaltend zum Beispiel aufgrund einer schweren Erkrankung oder sie ereilen einen plötzlich beispielsweise wegen eines tödlichen Unfalls. Im ersten Fall darf man heute auf die Medizin vertrauen, die entsprechend starke und wirksame Schmerzmittel verfügbar hat. Andererseits reagiert der Körper bei plötzlichen starken Schmerzen aber gnädig. Von einem Mitdenker des im Vorwort angesprochenen Denkkreises, der Mediziner ist, wurde mir versichert, dass das Bewusstsein abschaltet, wenn die Schmerzen zu stark werden. Man nimmt den Schmerz nicht mehr wahr. Diese Argumente können mir die letzte Angst vor den großen Schmerzen kurz vor meinem Tod nicht vollständig nehmen, sie können sie lediglich reduzieren. Alleine dies empfinde ich persönlich allerdings schon als eine große Hilfe.
Bis hierher habe ich Vorstellungen über das gar nicht berücksichtigt, was mit unserem Geist oder unserer Seele losgelöst von unserem Körper womöglich nach dem Tod geschieht. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sind wir dann bei Gott? Landen wir im Himmel oder in der Hölle oder sind diese Stadien nur ein Durchgangszustand vor unserer Wiedergeburt? Werden wir mit unserer Persönlichkeit wiedergeboren oder in einer transformierten Weise? Offensichtlich findet man in unterschiedlichen Kulturkreisen und Religionen sehr verschiedene Vorstellungen von dem, was mit unserem ‚Ich‘ nach dem Tod geschieht. Einige der religiösen Aspekte möchte ich etwas näher in Kapitel 7 behandeln. Im Kontext der Fragen zum Sterben soll es hier genügen festzustellen, dass zu den unsicheren Aussagen zum körperlichen Sterben dann ja noch die Unsicherheiten der jeweiligen Religion hinzukommen: Gibt es Gott? Woher wissen wir, dass die jeweiligen religiösen Vorstellungen zu Vorgängen nach dem Tod auch wirklich zutreffen? Mir scheint, wir würden mit solchen Vorstellungen eben nicht unsere Unsicherheit um das Sterben reduzieren, sonders stattdessen eher noch mehr offene Fragen zusätzlich erhalten. Die religiös geprägten Vorstellungen können also – wenn überhaupt – ebenfalls nur bedingt eine Hilfe sein.
Bei einer Idee der Religionen möchte ich hier aber gedanklich verweilen, weil sie in verschiedenen Religionen auftritt und auch unabhängig von Religion bedeutsam zu sein scheint: bei der Seele. In den meisten Religionen spielt die Seele des Menschen eine wesentliche Rolle. Mit ‚Seele‘ wird üblicherweise das bezeichnet, was am Menschen nicht-körperlich ist, was also den Teil des Menschseins ausmacht, den wir nicht direkt dem Körper zuordnen können, der also über den Körper hinausgeht. Seele umfasst einerseits den denkenden Geist mit allen Gedanken und Ideen, das Selbst, das Bewusstsein vom Selbst, aber auch Emotionen und Gefühle wie Ängste, Hoffnungen, Liebe, etc. Andererseits schließt die Seele in manchen Vorstellungen eine schwer zu beschreibende Eigenschaft mit ein, die sich auf das Belebtsein an sich bezieht. Letzteres wird beispielsweise betont, wenn wir davon sprechen, dass wir ‚beseelt‘ sind oder im Begriff des ‚Odems‘, der dem Menschen beispielsweise von Gott eingehaucht wird. Geist im engeren Sinne ist dabei alles das, was letztendlich in unserem Gehirn an bewussten Gedanken und Gefühlen abläuft. Seele umfasst auch dies in manchen Anschauungen, in manchen nicht, und kann eben auch mit dem Belebtsein an sich über den Geist hinausgehen. Dieser begrifflichen Unschärfe möchte ich im Folgenden insbesondere bei der Beschreibung meiner eigenen Vorstellungen möglichst Rechnung tragen.
Von besonderer Relevanz ist die Seele im Zusammenhang mit dem Tod des Körpers. Bereits bei den Ägyptern ist es das Ka, das nach dem Tod eine Wanderung antritt. In den christlichen Religionen ist es die Seele, die den Tod des Körpers übersteht und über die gerichtet wird, die ewig lebt, entweder im Paradies oder in der Verdammnis. Im Buddhismus ist der Begriff Seele etwas komplexer. Er bezeichnet nur oberflächlich das Gleiche wie bei den christlichen Religionen. Genauer betrachtet ist es zwar irgendetwas, was bei der Reinkarnation wiedergeboren wird. Dies ist aber eben nicht identisch zu dem, was die Persönlichkeit eines gestorbenen Menschen ausmachte.
Warum ist Seele ein so wesentlicher Begriff in den Religionen? Eine mögliche Erklärung möchte ich hier suchen. Der Mensch hat die fatale Eigenschaft, den eigenen individuellen Tod als eine Unabänderlichkeit bereits im Leben erkennen zu können. Diese Einsicht ist sicher eine Triebkraft für die Entstehung von Religionen, die konsistente Antworten auf die bereits angesprochenen fundamentalen Fragen des Menschen geben sollen. Von diesen sind hier die beiden folgenden besonders relevant:
- Woher komme ich vor meiner Geburt?
- Wohin gehe ich nach meinem Tod?
Genau diese Fragen resultieren aus der Todesvoraussicht einerseits und unserer lebenslangen Erfahrung der Kontinuität des eigenen Lebens andererseits.
Im Buddhismus werden diese beiden Fragen elegant gemeinsam mit der Reinkarnation beantwortet. In theistischen Religionen erfolgt die Antwort durch Verweis auf Gott. In den abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam ist es Gott, der jeden Menschen individuell erschaffen hat, der dadurch den Sinn des Lebens definiert und zu dem jeder nach seinem Tod zurückkehrt, wie dies in Bild 1 grafisch verdeutlicht ist. Damit Letzteres überhaupt möglich ist, wird das Konzept der Seele notwendig, da der Körper ja offensichtlich zerfällt und nicht zu Gott zurückkehrt – wenn man von der metaphysischen Deutung absieht, dass der Körper durch sein Ze...