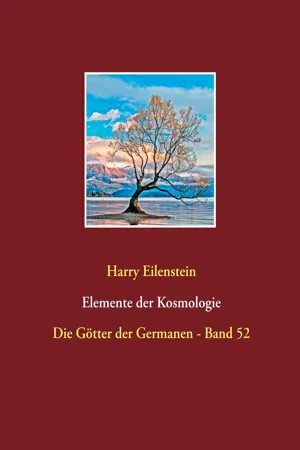
- 412 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Die ReiheDie achtzigbändige Reihe "Die Götter der Germanen" stellt die Gottheiten und jeden Aspekt der Religion der Germanen anhand der schriftlichen Überlieferung und der archäologischen Funde detailliert dar.Dabei werden zu jeder Gottheit und zu jedem Thema außer den germanischen Quellen auch die Zusammenhänge zu den anderen indogermanischen Religionen dargestellt und, wenn möglich, deren Wurzeln in der Jungsteinzeit und Altsteinzeit.Das BuchDie "mythologische Geographie" der Germanen besteht aus der Erde in der Mitte ("Midgard"), aus der Wasserunterwelt unter ihr, aus dem Himmel mit dem Götter-Wohnort ("Asgard") über der Erde, und aus dem Meer, das Midgard umgibt. Ganz außen am Rand der Welt liegt das Utgard-Jenseits. Der Raum zwischen Erde und Himmel ist vom Wind erfüllt. Das Götterheim Asgard ist aus der Überlieferung mit vielen Details bekannt.Zwei weitere Elemente prägen das Weltbild der Germanen: das Jenseits-Eis im Norden ("Niflheim") und das Feuer-Diesseits im Süden ("Muspelheim"), die durch den Abgrund "Ginnungagap" voneinander getrennt sind.Dieses Weltbild lässt sich zu einem großen Teil bis in die späte Altsteinzeit zurückverfolgen. So ist bereits in Göbekli Tepe der warme, helle Süden das Diesseits und der kalte, dunkle Norden das Jenseits. Dieselbe Symbolik findet sich auch bei den Chinesen: das helle Süd-Diesseits ist das Yang und das kalte Nord-Jenseits ist das Yin.Auch die Aufteilung der Welt in Erdgöttin und Himmelsvater ist weltweit verbreitet.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
V Wasser
V 1. Das Wasser in der germanischen Überlieferung
V 2. Das Urwasser
Inhaltsverzeichnis
- Bücher von Harry Eilenstein
- Kontakt
- Die Themen der einzelnen Bände der Reihe „Die Götter der Germanen“
- Inhaltsverzeichnis
- I. Erde
- II. Midgard
- III. Himmel
- IV. Asgard
- V. Wasser
- VI. Eis
- VII. Tau
- VIII. Utgard
- IX. Grjotunagard
- X. Tal
- XI. Das viertürige Haus
- XII. Ginnungagap
- XIII. Wind
- Themenverzeichnis
- Impressum