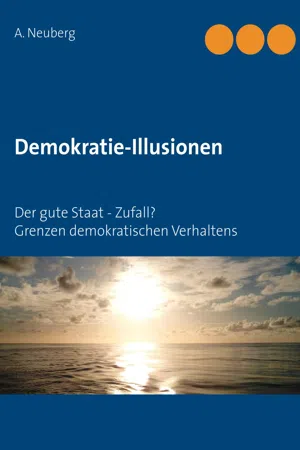![]()
Teil 1
Fundamentale Verwerfungen
aus quasi-demokratischen Prozessen
des letzten halben Jahrhunderts
Unsere heutigen Demokratien, mit über in Jahrzehnten geübten Usancen, sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wer käme auf die Idee, sie ernsthaft zu hinterfragen? So selbstverständlich sind sie, dass wir die Scheu vor der Obrigkeit verloren haben, alles und jedes kritisieren – häufig ungerecht, ohne Kenntnis der komplexen Zusammenhänge. Aber auch der Obrigkeit, Politik und Öffentliche Verwaltung, scheint der Verlust ihrer „Berufung“ – ehemals Ansehen, Ehre – nicht gewahr zu sein, scheint sich im tagespolitischen Geschehen zu verlieren; als doch einzigartiger Aufgabe einer für alle Bürger bestmöglichen Steuerung unseres Staates, höchste Auszeichnung die der Souverän zu vergeben hat. „Staatliche Verwaltung“ wird zur laschen Gewohnheit, zu Routine. Ob das für die Herausforderungen in einer nun globalen Welt reicht? Im hektischen Wettlauf hunderter Nationen, ständig wechselnder politischer Beziehungen, technologischer, ökonomischer, ökologischer u.a. Katastrophen, ethischer und religiöser Auseinandersetzungen in einer überfüllten Welt? Oder haben sie, zugunsten persönlicher Vorteile, tagespolitischer Banalitäten, aufgegeben? Der Eindruck nimmt zu!
Demokratien – nach westlichem Muster – finden wir primär in Nordamerika und Europa. Sie bleiben aber eine Minderheit. Natürlich könnte man nun – je Nation, je „demokratischem System“ wie auch persönlicher Beurteilung – fundamentale Verzerrungen intuitiv identifizieren und interpretieren (was ja verhindert werden sollte). Nachfolgendes entspricht zwangsläufig dem persönliches Lebens-, Wissens- und Erfahrungsumfeld (was ja immer gilt – nur kaum erklärt wird). Daher war zu versuchen, wesentliche Abweichungen von einer sinnvollen volkswirtschaftlich kontinuierlichen Entwicklung aufzuzeigen – primär des deutschen Sprachraums –, zu komprimieren und zu interpretieren.
Als Ursprung demokratischen Gedankenguts gilt das alte Griechenland, andererseits demokratische Bestrebungen aus der Aufklärung – z.B. aus der Französischen Revolution 1789-1799 wie auch der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776-1789. Als gravierende Umbrüche menschlichen Denkens und Verhaltens, begründet auf den Ideen freiheitlicher und gleichberechtigter Gemeinsamkeit. Die weitere weltweite Verbreitung demokratischen Gedankenguts erfolgte im Zuge der kolonialen Entfaltung, aber dennoch – bis heute – mit deutlichen Differenzierungen zu anderen Kulturkreisen, zu anderen Mentalitäten; und blieb verständlicherweise so immer Kern internationaler Diskrepanzen.
Ernsthafte politische Vergleiche demokratischer Prozesse sind daher begrenzt; jede Demokratie entwickelt sich individuell, aus jahrhundertealter Kultur und lokaler Mentalität. Nur die fundamentalen Grundansätze bilden eine Gemeinsamkeit – wie der von Freiheit, Gleichheit, von Liberalität und Ableitungen daraus – und werden dennoch unterschiedlich interpretiert. Wir spüren schon, wie sich Vorbehalte öffnen – auch, wie schwer es ist, bessere Alternativen abzuleiten. Die Demokratie bleibt also eine dynamische Regierungsform. Leider entwickelt sie sich heute nach tagespolitischen Geschehen, und besonders, nach jeweiligen Machtinhabern – als das Kernproblem. So erfahren wir aus den zwar schon reifen, wenn auch noch jungen Demokratien Europas, viele fundamentale Verzerrungen aus vielfältigen „demokratischen Usancen“, die zwangsläufig Krisen und Belastungen auslösen; nicht nur temporär, sondern wie dz. in der EU, sich selbst in Richtung Auflösung beschleunigen (und doch nur eine Auswahl bleiben):
1. Sicherheit – Erste Aufgabe des Staates
Aus den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte lernen wir, der Mensch formierte sich in Gruppen, in Herden, dann nach Regionen, später in Staaten, temporär in Staatenbünden. Das gab dem Einzelnen mehr Sicherheit, nützte aber auch, um andere aggressiv zu überfallen. Man pflegte also entsprechendes Kriegshandwerk, um zu plündern, zu unterjochen, also auf Kosten anderer Vorteile zu erheischen. Es war ein ständiges Hin und Her – niemals, nirgendwo, gab es in der Menschheitsgeschichte nachhaltig (!) Frieden. Gruppierungen wuchsen immer wieder neu. Waren sie wirtschaftlich stark, dann zumeist auch militärisch; büßten irgendwann ihre Überlegenheit wieder ein, verschwanden. Irgendwo gab es immer einen Missgünstigen, einen Plünderer, der die Gunst der Stunde nutzte (wie auch heute, meist in verdeckter Form). Hat sich hier etwas geändert? Mit Sicherheit können wir aus annähernd zehn Jahrtausenden sesshafter Menschheit doch ableiten, nichts hat Bestand, alles unterliegt ständiger wie dynamischer Veränderung. Gesellschaften kommen und Gesellschaften gehen. Und mit Sicherheit gilt Gleiches auch für die unsere. Auch sie hat nicht ewig Bestand, ist genauso dem Strudel weltweiter Veränderungen unterworfen, den menschlichen Egoismen. Es liegt an uns, an unserer Politik, mit welcher Kontinuität (mit welchen Erfolg) wir, als Nation, nun als Union, die Zukunft (und wie nachhaltig) meistern, besser, die wechselhaften Zeiten überstehen werden.
Unsere westlichen Gesellschaften – nach Jahrhunderten katastrophaler Auseinandersetzungen – sonnen sich seit nun gut 70 Jahren in Wohlstand, wiegen sich in Sicherheit. Die letzten Veteranen aus dem Weltkrieg sterben aus, und mit ihnen die tief prägenden Traumata aus dieser Zeit. Für die jetzige Generation ist Frieden und Wohlstand eine Selbstverständlichkeit. Anderes nicht mehr vorstellbar, dieser ständige Überlebenskampf während der ganzen Menschheitsgeschichte; die Kriege, Revolten, Überfälle, nie enden wollende Bedrohung an Leib und Leben, fehlende Sicherheit und keinerlei Sozialnetze. Es fehlt in ihrer Erfahrung. Und das bestimmt die Verhaltensunterschiede zu den Alten – bestimmt die differenten Einstellungen; so vernachlässigen wir selbst adäquate militärische Vorsorge. Ein gefährlicher Fehler, erwachsen aus einer saturierten Gesellschaft – dank wuchernder sozialer Netzwerke, in einer noch immer leistungsfähigen Wirtschaft. Die realen Erfahrungen aus der Geschichte – zumeist brutales Zusammenleben in wechselhaften Systemen und Gesellschaften – sind nicht mehr evident, belasten persönlich nicht mehr; ausgenommen einige weniger historischer „Highlights“ des letzten Jahrhunderts, die immer noch medial wirken, paradoxerweise ständig reflektiert werden. Dennoch, der Mensch ändert sich nicht, ist nicht plötzlich friedfertig, sozial – und das, weltweit.
Demokratische Gesellschaften wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg erleben, entwickeln über Jahrzehnte ausgefeilte Sozialsysteme, die zwangsläufig – wie wir feststellen – immer weiter wachsen, unbegrenzt wuchern (Korrekturen verhindern sich ja „demokratisch“. Kap. 9). Hemmung der Leistungsbereitschaft ist die Folge und bewirkt ökonomische Verzerrungen, beeinflusst selbst staatliches Verhalten. Über Jahrzehnte nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Des Staates primären Aufgaben treten in den Hintergrund – Bürokratien wuchern, verzweigen sich in alle Lebensbereiche des Bürgers; und prägen so auch die Politik. Selbst fundamentale Staatsaufgaben wie Gestaltung und Modernisierung der Infrastruktur, Sicherheit und Verteidigung, Förderung des allgemeinen Wohlstands, der Bildung, nämlich nach den Grundsätzen der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, treten in den Hintergrund (wenn auch ständig betont!). Eine wachsende Zahl von Bürgern zieht sich aus dem politischen Geschehen zurück, koppelt sich von der politischen Verantwortung ab, überlässt das „Staatsgeschehen“ der Administration, den Parteien. Noch können wir die Folgen kaum abschätzen. Selbst in der internationalen Konfliktbewältigung handeln die starren öffentlichen Strukturen autonom (wie heute, den Flüchtlingswellen, des wirtschaftlichen Niedergangs, Widererstarkens des Nationalismus, des Auflösens europäischen Gedankenguts usw.), als unstrukturiertes, ein selbstgenügsames „Verwalten“. Noch verlassen wir uns als Nation auf den Weltpolizisten USA und Nato; und geben so langsam, schleichend, unsere Selbstständigkeit – geruhsam in Wohlstand und vermeintlicher Sicherheit eingenistet – auf.
So werden in Europa z.B. die Verteidigungsausgaben zurückgefahren, die Wehrpflicht abgeschafft, die Verteidigungsindustrie vernachlässigt und drohende Veränderungen in der Welt negiert. Wie zum Beispiel sich abzeichnende Gefahren aus der Informationstechnik, von ABC-Einsätzen, terroristischen Gruppierungen, ausgeflippten Potentaten (selbst in Demokratien!). Dazu mit unsinnigen, zufallsgenerierten Militäreinsätzen im fernen Ausland, einer Vernachlässigung der Förderung von Forschung und Entwicklung für relevante technologische Neuerungen auf militärischen und benachbarten Gebieten, als Negation der weltweit politischen (Macht-)Verschiebungen mit all den massiven Gefahren für die eigene Sicherheit. Eines ist in der Welt jedenfalls Fakt: Je autoritärer Systeme, desto bedeutsamer sind für die Machthaber die Armeen, und je demokratischer Staaten sind, desto deutlicher degenerieren Verteidigung (sofern nicht akute Gefahren vom Nachbarn drohen, wie z.B. für Israel). Die Sicherheitsvorsorge wird lascher, zunehmend vernachlässigt. Und zwar mit bleibend negativem Einfluss auf die „Sozialisierung“ allgemein (Kap.14.), auch für die Identifikation mit dem Staat, mit der Union; als doch natürliche Verteidigungsbereitschaft, einer sozialen Verantwortung zur Gesellschaft.
Sehen wir nur einige aktuelle Entwicklungen im näheren Umfeld. Russland z.B. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion öffnete sich das Land gegen den Westen, mit offener, mit wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Annäherung an die EU. Mangels diplomatischem Geschick Europas kam es allerdings zur radikalen Kehrtwende, mit – im internationalen Machtgefüge – unabsehbaren Konsequenzen auf Jahrzehnte; z.B. seiner Hinwendung gegen den Osten/Südosten, gefolgt von einem gefährlichem Militarismus. Persönliche Einstellungen, Machtbewusstsein, besonders jedoch fehlendes strategisch staatspolitisches Denken Westeuropas und begrenzte Fähigkeiten der Spitzenpolitiker ließen den ursprünglich interessanten Ansatz, mit Verständnis für ein zusammenbrechendes Imperium, so different auch die Mentalitäten sein mögen, missen. Dass die Annexion der Krim völkerrechtswidrig war, ist nicht zu bestreiten; aber genauso lässt sich nicht bestreiten, dass Russland die Abtrennung seiner national-heroischen Militärbasis, mit Zugang zum Mittelmeer, kaum akzeptieren kann (wenn auch mit fadenscheiniger Begründung). Und dass ein Land wie Russland die gravierende Ausweitung des NATO-Einflussgebietes als Bedrohung empfinden muss, genauso. Natürlich meinen wir das im Westen anders – sind aber auch anders, zwangsläufig „national“ sozialisiert. Und der nächste Schritt Russlands, der Versuch die abtrünnige Ukraine zu destabilisieren, war ein – in der aufgeheizten Stimmung – sich schleichend entwickelnder „Nebeneffekt“. Ungebremst geht seitdem die Eskalation voran – keiner glättet diplomatisch die Wogen. Das Land schottet sich immer stärker ab, versucht sogar die EU (wie die USA) – über mediale Trolle und politische Unterwanderungen – zu destabilisieren. Und die Dinge beschleunigen sich, spalten die Beziehungen im Nahen Osten, in Nordafrika, selbst innerhalb der EU; und das, bei all den weltweit schwellenden Auseinandersetzungen. Die europäische Politik hätte, und hat noch immer die Möglichkeit, diplomatisch ausgleichend einzugreifen. Aber, es fehlt „diplomatische Größe“, auch die Fähigkeiten, wie in Deutschland, das so seine politischen Vorteile verspielt.
So ist die über ein Jahrzehnt fruchtbarer Zusammenarbeit Europas mit Russland (bei dem historischen Hintergrund!) nicht nur infrage gestellt – ganz zu schweigen von all den militärischen Konsequenzen, in der Ukraine, in Syrien, der Türkei, im Iran u.a., ferner der verlorenen Wirtschaftspotenziale, der problematischen Sicherheitsaspekte –, sondern der Abbruch, die Kehrtwende, wird auf lange Zeit das weltweite Gleichgewicht zu Ungunsten Europas verändern. Ein sich düpiert fühlendes Russland (besser, ein sich düpiert fühlender Autokrat) löste sich aus der Zusammenarbeit, schottet sich, verletzt durch Sanktionen, ab, entwickelt sich zunehmend autoritär. Führt gelegentliche Scharmützel und Kriege – durchaus im Sinne der Destabilisierung Europas – und engagiert sich militärisch und politisch in instabilen Ländern; was ebenfalls nicht im Sinne der EU liegen kann. Bis zu extremen Auswirkungen (in Syrien), die uns vor Entsetzen erstarren lassen. Pflegt die Annäherung an China – auch nicht in unserem Interesse –, gefolgt von einer sicherheitspolitisch problematischen Entwicklung für den europäischen Kontinent. Ursachen: Massive Fehler der europäischen Politik, staatspolitische Unfähigkeiten, fehlendes Verständnis für die Interessen und Sensibilitäten anderer Staaten; eben, auf gleicher Augenhöhe zu kooperieren. Und, das Ganze gefolgt von wirtschaftlichen Schäden auf Jahrzehnte. So autoritär, so destabilisierend sich das heutige Russland auch geben möge, im Grunde genommen haben wir, im Westen, massiv Schuld an der Misere.
Besonders augenscheinlich dabei die Rolle Deutschlands. Hat es doch, als wirtschaftlich größtes Land der EU, zwangsläufig bedeutenden Einfluss auf die Strategie und die Verhandlungen – somit besondere Verantwortung für die EU. So hätte es – aus der bekannt positiven Nähe zum russischen Staatschef – die Initiative ergreifen, diplomatisch ausgleichend wirken müssen. Welch wirtschaftlicher und strategischer Nutzen wurde hier verspielt! Dazu zählen auch die Sicherheitsbedenken der osteuropäischen EU-Staaten mit ihren Grenzen zu Russland. Deren Befinden hätte oberste Priorität gehabt; die zwar – über die NATO-Beistandsverpflichtung (wie sicher ist die schon, denken wir nur an die USA heute) – unbegründet scheinen, aber dennoch Unsicherheiten nicht verhindern; und, gravierende wirtschaftliche Nachteile aus unterbrochenen Wirtschaftsbeziehungen in Kauf nehmen mussten.
Sorge kommt auch auf aus den Abläufen der Entscheidungsprozesse in der EU. An diesen Verhandlungen haben ja nur Frankreich, Deutschland und einigen EU-Spitzendiplomaten teilgenommen. Wie eben immer, liegt die Voraussetzung zur Lösung solcher Konflikte – und der Komplexität demokratischer Entscheidungsfindung wie des irrational langen Zeithorizonts – eben, bei vorbehaltlos und strategisch denkenden, bei charismatischen Führungspersönlichkeiten; sinnvoller Weise der wirtschaftlich starken Länder. Die deutsche Regierung wäre aus ihrer Position wie auch historisch dafür prädestiniert gewesen. Hat es aber nicht geschafft (eines der massivsten demokratischen Mankos. Kap.18)!
Wie nicht anders zu erwarten, wirkte zwar der erste Teil: Nämlich, das wirtschaftlich stärkste Land übernimmt die Gesprächsrunde. Fehlt jedoch der zweite Teil, der vorbehaltslos und strategisch denkende, der charismatische und fähige „Moderator“, wird zwar verhandelt, aber – wie eben auch in vielen Unternehmen – ist das Resultat zwar nicht chaotisch, aber dennoch falsch. Erreicht wurde wenig: Zwar klangen die Scharmützel ab, aber der Status quo stabilisierte sich hemmend, und mit ihm die Sanktionen – auch zum Nachteil der Europäer. Die Verantwortlichen haben zwar ihren „Job“ erfüllt, tragen selbst aber keinerlei Schaden. Wir sehen, Demokratien sind nur dann nachhaltig erfolgreich, wenn die Besten führen, und wenn sie auch Sorge tragen, dass genügend Fähige gefördert werden – eine menschliche Hürde, die nur reife Persönlichkeiten meistern. Eine Hürde die, jedenfalls in Demokratien, offenbar schwer zu überwinden ist (Kap. 23).
Und, wie lief es tatsächlich ab? Intuitiv, nach persönlicher Neigung wurde vorgegangen, ohne Rücksicht auf die Historik anderer Länder, auf Sensibilitäten, dazu mit wenig „Weisheit“ (Weisheit als Resultat von Wissen, Reife und Erfahrung). Fehler wirken umso gravierender, je größer der angeschlossene Interessenskreis ist. Es zeigt aber auch, dass wissenschaftliche, dass logische, dass erfahrene und reife Professionalität in der Politik, selbst in Demokratien, kaum zählt. Ähnliches Verhalten, ähnliche Logik, findet sich auch bei all den nachfolgend wesentlichen Verzerrungen. Die politische Führung Deutschlands in der EU mag sich zwar aus der Größe anbieten, dennoch, es entspricht keinem demokratischen Konsens – und wirkt umso negativer, je geringer die „Professionalität“ der führenden Initiatoren ist.
Nehmen wir ein anderes Beispiel: Die Entwicklung in Afghanistan. Ein mehr als zehnjähriger Militäreinsatz d...