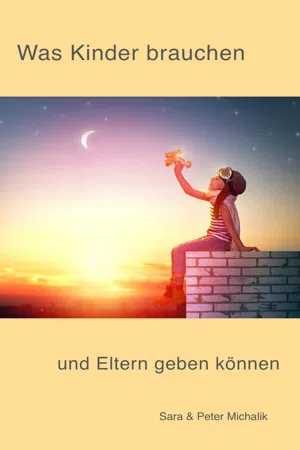![]()
Einmal fragte mich eine Mutter, was sie denn tun solle: Sie habe Angst, dass sich ihr 4 Monate altes Kind verletzen würde, sie habe schon alles Mögliche versucht, aber es nütze nichts. Als ich genauer nach der Situation fragte, berichtete mir die Mutter, dass sie beobachtet habe, dass ihr Kind bereits als Baby immer am Rand des Kinderbettchens lag und sie befürchten musste, dass es sich am Bettrahmen anschlagen und verletzen könnte. Sie habe daraufhin das Bettchen gegen eine große Matratze ausgewechselt und das Kind auf diese Matratze Schlafen gelegt. Doch auch hier habe sich das Kind dann immer gegen die Wand bewegt. Es bringe ja nichts, ihm noch eine noch größere Matratze anzubieten. Aufgrund von Verletzungsgefahr gebe es auch keine Kissen oder Kuscheltiere im Bettchen…
Diese Mutter zeigte auf den ersten Blick eine große Fürsorge für ihr Kleinkind, aber gleichzeitig auch ein Unvermögen, die Signale ihres Kindes richtig zu deuten und die Bedürfnisse von Kleinkindern zu kennen. Die Gefahr bestand für dieses Kleinkind nicht darin, dass es sich verletzen könnte, sondern darin, dass es für seine Entwicklung sehr wichtige Angebote durch seine Bezugspersonen nicht bekommen könnte: Halt, Berührung, Kontakt, Wärme, Geborgenheit.
Obwohl wir an die Erlebnisse unserer frühen Kindheit keine bewussten Erinnerungen haben, beeinflussen sie die menschliche Entwicklung stärker als jede andere Entwicklungsphase.
Dies konnten Forschungsuntersuchungen aus verschiedenen Bereichen in den letzten Jahren eindrücklich belegen. Die Erfahrungen der frühen Kindheit beeinflussen, wie wir uns fühlen, wie wir uns in Beziehungen verhalten und wie das psychische Befinden ist.
In diesem Kapitel sind einige der wichtigsten Forschungsergebnisse zusammengefasst und mit Beispielen aus dem Alltag verständlich erklärt. Am Ende des Kapitels finden sich zudem hilfreiche Tipps, die helfen können, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und diesen gerecht zu werden.
Obwohl sich die meisten Menschen nicht an die Zeit vor dem vierten Lebensjahr zurückerinnern können, ist das Vergangene nicht einfach vergangen. Im Gegenteil: Diese Erfahrungen sitzen ganz tief in unserem Körper. Ähnlich wie traumatische Erlebnisse noch „in den Knochen stecken“ und einfach wieder hochkommen und uns überwältigen, ohne dass wir das steuern oder in Worte fassen können, so ist es auch mit den Kindheitserfahrungen. Wir finden keine Worte, können nicht benennen, woher etwas kommt und können es nur schwer steuern, aber es prägt unser Verhalten und unsere emotionale Reaktion.
Studien zeigen, dass wir oft sehr viel mehr wissen und uns an viel mehr erinnern, als uns bewusst ist, denn der Körper reagiert. Beispielsweise reagiert er mit Stress, wenn wir auf etwas treffen, dass uns geschadet hat. So empfinden wir Angst, ohne dass wir uns explizit daran erinnern können, was geschehen ist.
Der Körper ist das Medium der Erinnerung. Die Wissenschaft schenkt daher der Bedeutung des körperlichen Erlebens für unser Fühlen und Denken immer stärkere Aufmerksamkeit.
Wie die Welt funktioniert, erfahren Kleinkinder durch Erfahrung, Empfinden, Be-greifen und schließlich durch Einsehen. Die Erfahrungen, wie die engsten Bezugspersonen mit uns umgegangen sind, prägen unser Verständnis dafür, wie Menschen miteinander umgehen. Diese tiefgreifenden Erfahrungen sind in erster Linie Körpererfahrungen: Berührungen, Gestik, Gesichtsausdrücke, Stimmmelodien. Diese sind die ersten Interaktionen zwischen Kind und Bezugspersonen.
Wird ein Kind aufgenommen, wenn es zu weinen beginnt? Spricht die Mutter leise und beruhigend auf das Kind ein, wenn es unruhig und ängstlich wirkt? Es geht darum, wie die Verbundenheit zwischen dem Kind und den engsten Bezugspersonen, zumeist Mutter und Vater, hergestellt wird. Auf diesen verinnerlichten Interaktionen, auf dieses „Beziehungswissen“, baut die Gehirnentwicklung und die seelische Entwicklung eines Kindes auf.
Heute verstehen Neurologen das Gehirn als „Beziehungsorgan“.
Von ganz grosser Bedeutung sind Berührungen. Durch den Tastsinn erspürt der Säugling bereits im Mutterleib die Welt. Dadurch baut es auch sein eigenes Körperbild auf und erspürt seine Grenzen. Berührungen geben dem Säugling Halt und Geborgenheit. Studien belegen, dass Berührungen Wachstums- und Bindungshormone freisetzen, Stresshormone reduzieren und den Herzschlag und die Atmung stabilisieren. Eltern erleben, dass ihre Säuglinge am zufriedensten sind, wenn man sie viel herumträgt, und dass sie sich am besten beruhigen, wenn sie auf den Arm genommen werden. Es ist ein grundlegendes Bedürfnis von Säuglingen getragen und gehalten zu werden. Diese körperliche Nähe ist zudem sehr wichtig für die Bindung zwischen Kind und Bezugspersonen (vgl. auch unten). Der Körper- und Gesichtsausdruck des Säuglings dienen dazu, die Bezugspersonen zu bewegen bzw. zum Reagieren zu motivieren. Experimente zeigen: Wir gleichen unsere Reaktionen oft dem Gegenüber an. Und werden unsere Mimik und Gestik vom Anderen gespiegelt, dann fühlen wir uns wohl. Darin liegt auch die Fähigkeit mit dem anderen „mitzugehen“, mitzufühlen und nicht nur kognitiv zu verstehen, was andere uns gerade sagen wollen.
Auch ohne eine Sprache zu besitzen, drücken Kleinkinder ihre Gefühle und Bedürfnisse aus: Über ihren Körper.
Dabei ist der ganze Körper im Einsatz, mitsamt Beinen und Armen. Indem Eltern dieses Gefühl in Worten beschreiben, etwa „Hast du Hunger?“ oder „Jetzt bist du aber erschrocken, gell!“, helfen sie dem Kind, die eigenen Gefühle zu verstehen. So gewinnt das Kind einen Schlüssel zu seiner Innenwelt.
Durch ständige Bewegung kommen Kinder in Kontakt mit sich und der Welt und bauen so ihr Selbstbild auf.
Begreifen bedeutet für Kleinkinder, Dinge greifen zu lernen: Be-greifen.
So spiegelt sich die große Bedeutung von Bewegung nicht nur im Körpergefühl, sondern auch im Denken, in der Sprache, in den Gefühlen und in den Interaktionen wieder. Zuerst wird alles über den Körper erlebt, erfahren und ausgedrückt.
John Bowlby (1907–1990), ein britischer Kinderpsychiater und Psychoanalytiker, ging davon aus, dass zwischen einem Kind und einem ihm vertrauten Menschen ein unsichtbares, enges und gefühlvolles Band besteht. Dieses Band hat eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Bowlby legte den Grundstein für die sogenannte Bindungsforschung.
Bis heute konnte vielfach bestätigt werden:
Kinder brauchen von Anfang an persönliche Bindungen um sich gesund entwickeln zu können. Wobei die Qualität der frühen Bindungsangebote die Entwicklung der inneren Strukturen prägt und entscheidend dafür ist, was wir von anderen Menschen erwarten.
Sichere Bindung führt zu einem sogenannten Ur-Vertrauen, unsichere Bindungen zu einem Ur-Misstrauen. Die Qualität der Bindung ist auch entscheidend dafür, wie Kinder ihre Umwelt explorieren/erkunden. Gute Bindungspersonen bilden sozusagen den sicheren Hafen, von dem aus es gelingen kann, die Umwelt zu erforschen und entdecken. Je mehr ein Kind sich auf seine Fürsorgeperson verlassen kann, desto mehr kann es sich seiner Neugierde, dem Erkundungsdrang und dem Spiel hingeben. Das Verhalten der primären Bezugspersonen entscheidet zudem darüber, welche Art von Bindung das Kind entwickelt. Sicher gebundene Kinder sind besser dazu fähig, Probleme zu lösen, haben mehr Möglichkeiten, mit Stressmomenten umzugehen, sind aufmerksamer gegenüber neuen Aufgaben und besitzen ein stärkeres Selbstwertgefühl.
Eine sichere Bindung und ein starker emotionaler Halt scheinen wie ein Schutzschild zu wirken, das oft ein Leben lang bleibt.
Wenn ein Kind jedoch in eine Welt hineinwächst, die nicht sicher ist oder bei der es nie sicher sein kann, woran es ist, erlebt es ständig Stress. Und dieser Stress vergisst der Körper nicht (vgl. oben). Studien können zeigen, dass solche Kinder auch noch viel später mit einer „inneren Mobilmachung“ reagieren, fortan sogar noch schneller und intensiver gestresst reagieren und nie wirklich ruhig und entspannt sein können. Dieser subtile Daueralarm hat einen hohen Preis: Die Stresshormone hemmen die Ausbildung des Gehirns (reduzierte Synapsenbildung und Reifung von Nervenfasern. Gewisse Hirnareale, die wichtig sind für Impulskontrolle usw. sind weniger gut ausgebildet). Aber auch die Entfaltung schöner Gefühle sowie das freie Erkunden der Welt und das kindliche Spiel sind gehemmt. Es kommt also zu einer mehrfachen Entwicklungshemmung, denn neben der Gehirnentwicklung sind gerade auch das entspannte Explorieren der Welt und das kindliche Spiel zentral für die kindliche Entwicklung.
Indem ein Säugling von Anfang an viel feinfühlige Zuwendung erfährt, wird er für seine Gefühle sensibilisiert. Wenn beispielsweise ein Baby weint, weil es das Bedürfnis nach Nähe hat und seine Eltern ihm dieses Bedürfnis stillen, indem sie es nicht schreien lassen, sondern es bald beruhigen, indem sie es auf dem Arm wiegen, dann lernt das Baby, dass es sich auf seine Selbstwahrnehmung verlassen kann. So lernt es, dass seine Signale verstanden und ernst genommen werden. Es lernt, dass seine Eltern prompt auf seine Bedürfnisse reagieren und sich um es kümmern, wenn es etwas braucht.
Wenn Bezugspersonen die Stimmungen und Bedürfnisse des Babys richtig zu deuten lernen, kann dieses seine Gefühle und Gedanken besser zum Ausdruck bringen und sich optimal entwickeln. Diese Fähigkeiten von Bezugspersonen (man spricht von Feinfühligkeit oder heute auch von emotionaler Intelligenz) sind in den ersten zwei Lebensjahren die wichtigsten Grundvoraussetzungen für eine optimale Entwicklung des Kindes.
Wissenschaftliche Studien belegen: Kinder sind von Geburt an auf Beziehung und Bindung ausgelegt.
Die Wissenschaft spricht heute vom kompetenten Säugling, der von sich aus bereits aktiv seine Umwelt mitgestaltet. Beispiele dafür, wie sehr das Baby auf Beziehung ausgelegt ist, finden wir in den Fähigkeiten des Säuglings: Bereits nach wenigen Stunden erkennt das Baby die Stimme und den Geruch der Mutter. Das Neugeborene zeigt Interesse an Gesichtern und imitiert Augenblinzeln und Zungenherausstrecken. Es schreit, wenn es ein Bedürfnis hat und beruhigt sich, wenn es auf den Arm genommen wird.
Im Alter von etwa 6 Wochen reagiert das Kleinkind auf menschliche Stimmen und Gesichter mit einem Lächeln. Dieses sogenannte soziale Lächeln und die ersten Imitationen fördern Wissenschaftlern zufolge die Bindung der Eltern an das Kind. Die Eltern erfreuen sich an diesen Reaktionen, wenden sich intensiv ihren Kindern zu, verstärken ihre Gesichtsausdrücke und wiederholen selber die Reaktionen ihrer Babys.
Indem Bezugspersonen mit übertriebener Mimik reagieren und die Gefühle des Kindes in Worte fassen, lernt das Kind, was sein eigenes Verhalten und sein Gefühlsausbruch bedeutet: „Das ist der Ausdruck für Ärger, das der Ausdruck für Angst.“
So verknüpfen Kinder Empfindungen mit Erfahrungen. Die körperlichen Reaktionen werden zu einem emotionalen und körperlichen Wissen.
Ein dreimonatiges Kind erwartet Interaktion mit seinen Bezugspersonen. Es kommuniziert über Mimik, Gestik und Laute. Starrt eine Mutter ihr Kleinkind nur an (sogenanntes Stillface) reagiert das Kleinkind mit massivem Stress, versucht, die Aufmerksamkeit der Mutter durch Aktivität auf sich zu ziehen und beginnt schließlich verunsichert zu weinen. Die Reaktionen der Eltern werden für Babys zu Körperempfindungen. Hier bildet sich der Ursprung von Intersubjektivität, also der Fähigkeit andere zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen. Schon mit ca. vier Monaten entwickeln Kleinkinder Erwartungen: Wenn ich das so mache, passiert das… Wenn ich so schreie, wird Mama kommen und mich trösten. So lernen sie, dass ihr Gefühlsausdruck eine Reaktion erreichen wird und damit wirksam ist. So lernen sie sich immer besser kennen und lernen erkannt zu werden.
Im negativsten Fall reagieren Eltern immer wieder nicht adäquat auf die Signale eines Kindes, vielleicht, weil sie selber psychisch krank sind, weil sie zu sehr mit sich selber beschäftigt sind oder weil sie es selber nie gelernt haben.
Stellen wir uns etwa folgende Situation vor: Ein Säugling drückt aus, dass es ihm unwohl ist, indem er jammert. Die Mutter geht jedoch nicht darauf ein, sondern spielt weiterhin mit der Rassel vor seinem Gesicht. Der Säugling wendet sich ab, und auch das nimmt die Mutter nicht richtig wahr, sie geht mit der Rassel noch näher an ihn heran, plappert weiterhin fröhlich auf ihn ein…
Dieses Beispiel macht deutlich, dass diese Mutter ihr Kind nicht richtig „liest“, seine Signale also nicht versteht. Für das Kleinkind bedeutet die Reaktion der Mutter, einerseits, dass es ausdrücken kann, was es will, die Mutter nimmt es nicht oder zumindest nicht richtig wahr. Andererseits wird die Reaktion der Mutter für das Kind nicht vorhersehbar. Wenn dies nicht nur einmalige, flüchtige Interaktionsmomente sind, sondern der Dauerzustand in unseren engsten Beziehungen, dann können wir erahnen, welche Tragweite diese Interaktionen für einen Säugling haben. Das Kind kann keine Verknüpfung von seiner Reaktion und der Reaktion der Mutter machen, es hat keine oder falsche Erwartungen. Der Säugling kann sich auch nicht wehren. Er kann seinen eigenen Gefühlen nicht mehr trauen und schon gar nicht dem Umfeld. Wie viel schlimmer sind die Auswirkungen, wenn das engste Umfeld nicht nur nicht adäquat und verlässlich auf das Verhalten des Säuglings reagiert, sondern gar noch zu einer Bedrohung für das Kind wird, wenn die Bezugspersonen das Kind zum Beispiel misshandeln oder sexuell ausbeuten? – Die Auswirkungen auf das ganze Leben eines Menschen sind immens, selbst dann, wenn das Kind irgendwann doch noch „in Sicherheit“ ist. Diese Erfahrungen sitzen so tief, dass die Spuren teilweise nie mehr verschwinden.
Die Zeit heilt die Wunden nicht einfach, die Spuren bleiben oft ein Leben lang vorhanden. Das Erlebte ist nicht vergessen, es ist konserviert.
Und es braucht unglaublich viel, um das Vertrauen eines solchen Kindes gewinnen zu können.
Dieses Kapitel weist auf die Bedeutung der frühen Kindheitserfahrungen und die Wichtigkeit der Beziehungs- und Interaktionsangebote der Bezugspersonen hin.
Es geht nicht darum, ständig verfügbar und „perfekt“ zu sein, sondern darum, „good enough“ (Winnicott, englischer Kinderarzt, und Psychoanalytiker) zu sein und somit in der Lage, auf die Bedürfnisse des Kleinkindes einzugehen, sodass sich das Kind nie ganz verlassen oder vernachlässigt fühlt.
Folgende Tipps können Eltern helfen, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und diesen gerecht zu werden.
Tipps:
Nehmen Sie Ihre eigenen Empfindungen wachsam wahr und ernst. Eltern erleben, dass sie mit dem Säugling im Arm viel empfindsamer werden und beispielsweise Reizüberflutungen in Einkaufszentren selber nicht mehr mögen oder auf zu laute Musik noch stärker reagieren. Indem wir diese Empfindungen ernst nehmen, schützen wir auch das Baby vor Reizüberflutungen und sind zugleich ein Vorbild, das vormacht, dass Körper- und Sinnesempfindungen wertvolle Marker im Leben sind. Vertrauen Sie auf Ihre eigene Intuition.
Auf die (feinen) Signale des Babys achten. Alle Eltern müssen lernen die Signale und Körpersprache ihrer Kinder zu lesen und zu verstehen. Seien Sie geduldig mit sich, gehen Sie aber auch mit Neugierde und Entdeckungslust vor. Es ist eine große Freude, wenn man erleben darf, dass man das eigene Kind immer besser versteht und schon sehr früh in einen Dialog mit dem Baby treten kann.
Die Signale des Kindes spiegeln, aber auch dossieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ein Kind aufgrund eines lauten Knalls erschrickt, die Mutter dann darauf eingeht, in Worte fasst, was geschehen ist und signalisiert, dass keine Gefahr vorhanden ist. Babys suchen in den Gesichtern de...