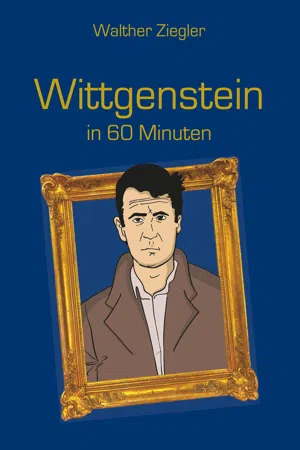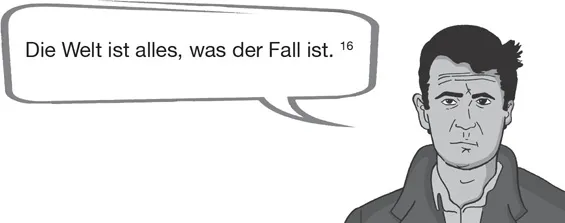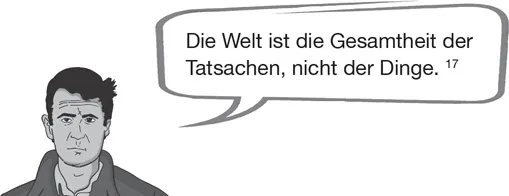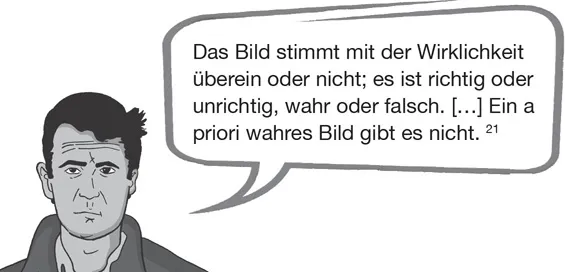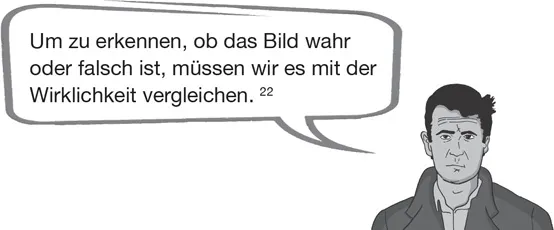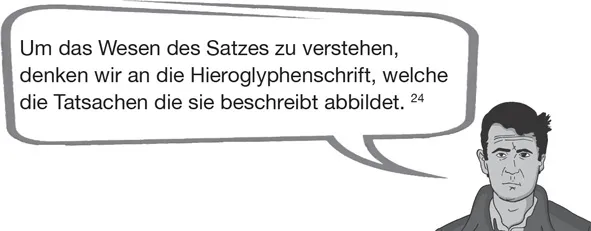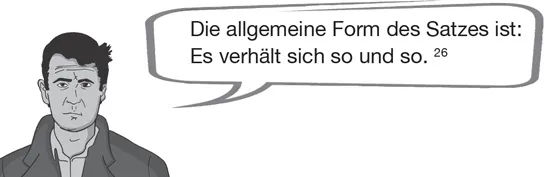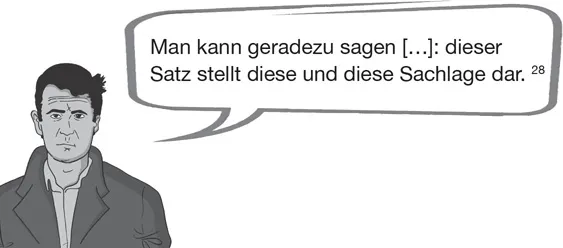![]()
Wittgensteins Kerngedanke
Was ist die Welt?
Die Welt besteht nur aus Tatsachen, die wir in Sätzen abbilden
Schon der allererste Satz des Tractatus, also die These Nummer eins, ist von bestechender Einfachheit:
Einfacher geht es nicht. Die Welt ist zunächst einmal alles, wovon man sagen kann: „Ja, das ist der Fall“. So ist es beispielsweise der Fall, dass die Erde rund ist, sich um die eigene Achse dreht und Schwerkraft auf uns ausübt. Es ist ferner der Fall, dass sie von einer Atmosphäre umgeben ist, die ermöglicht, dass wir atmen können. Wäre all das nicht der Fall, hätten wir Atemnot und würden darüber hinaus davonfliegen.
Bis hierher scheint Wittgensteins Antwort auf die klassische Frage „Was ist die Welt?“ banal und geradezu selbsterklärend. Sie ist eben schlichtweg alles, was der Fall ist. Doch schon im nächsten Satz vollzieht er eine grundlegende Wende. Die Welt ist nämlich nicht die Summe aller „Dinge“, von denen wir gemeinhin glauben, dass sie der Fall sind, sondern, so Wittgenstein, nur die „Gesamtheit der Tatsachen“:
Die Welt besteht erkenntnistheoretisch also keineswegs aus sämtlichen „Dingen“, die wir seit der Kindheit in unserer Vorstellung angesammelt haben und von denen wir glauben, dass sie der Fall sind, etwa aus Ampeln, Autos, Straßen, Schutzengeln, Bergen, Wäldern, Ozeanen und Meerjungfrauen, sondern streng genommen nur aus der Gesamtheit der echten „Tatsachen“, die wir über die Welt wissen und aussagen können. Schutzengel und Meerjungfrauen gehören beispielsweise schon nicht mehr dazu. Doch wie kommen wir zu den echten Tatsachen? Wie entstehen sie in unserem Kopf? Wittgensteins Antwort ist zunächst wieder sehr einfach:
Biografen verweisen an dieser Stelle gerne auf ein Erlebnis Wittgensteins im Gerichtssaal. So hat er einmal persönlich mit großem Interesse einer Gerichtsverhandlung beigewohnt. Der Richter ließ mit Puppen und Modellen von Autos den umstrittenen Hergang eines Unfalls rekonstruieren. Damit konnte er die widersprüchlichen Darstellungen ausräumen und sich ein genaues Bild davon machen, was wirklich passiert war. Das hat Wittgenstein sehr beeindruckt und womöglich auch zu seiner Bildtheorie inspiriert. Denn genau wie der Richter machen sich die Menschen, so Wittgenstein, im Alltag ständig irgendwelche Bilder von der Wirklichkeit, um diese in ihrer Unübersichtlichkeit besser verstehen und bewältigen zu können:
Wenn ich beispielsweise bei Grün vertrauensvoll über die Straße gehe, habe ich mir bereits ein Bild oder ein Modell von der komplexen Funktionsweise der Ampel und des gesamten Verkehrssystems gemacht. Ich habe das Modell im Kopf, dass die grüne Ampel gleichzeitig den anderen Verkehrsteilnehmern durch ein rotes Signal das Warten gebietet und so in Intervallen den reibungslosen Verkehr ermöglicht. Natürlich, so Wittgenstein, kann man sich dabei auch irren und das Bild beziehungsweise das Modell, das man sich von der Wirklichkeit macht, stimmt gar nicht. Denn:
Tatsachen sind aber einzig und allein die „wahren“ und „richtigen“ Bilder von der Wirklichkeit. Was aber unterscheidet Tatsachen dann von Trugbildern? Ist nicht auch der Schutzengel ein Bild, das wir in unserem Kopf haben? An dieser Stelle gibt Wittgenstein eine folgenreiche Antwort:
Dieser Satz ist im Grunde genommen der Startschuss für die gesamte moderne empirische Naturwissenschaft, wonach jedes Bild, jedes Modell von der Wirklichkeit und jede Hypothese mit der Wirklichkeit verglichen und in Experimenten wiederholt nachgewiesen werden muss. Dieser Abgleich ist wichtig. Wir machen uns nämlich sonst womöglich ein Leben lang viele Bilder von der Welt, die keineswegs alle korrekt sind. Im nächsten Schritt sagt Wittgenstein, dass auch Sätze und Worte letztlich nichts anderes sind als zusammengestellte Bilder von der Welt:
Wittgenstein verweist an dieser Stelle auf die ägyptische Hieroglyphenschrift:
Auch die chinesische Schrift bildet bis heute in manchen Schriftzeichen Tatsachen in direkter Weise bildhaft ab. Wenn man ein „Dach“ malt und das Zeichen „Frau“ hinzufügt, so bedeutet diese Kombination „Frieden“. Zwei Frauen ohne Dach stehen für „hübsch“, drei Frauen ohne Dach bedeuten hingegen „Streit“. Seit frühesten Zeiten also machen sich die Menschen mit Hilfe von Wörtern und Sätzen Bilder von der Wirklichkeit:
Um Tatsachen handelt es sich aber auch bei Sätzen nur dann, wenn die entsprechend formulierten Bilder mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Der Satz „Es gibt Schutzengel und Meerjungfrauen“ wäre beispielsweise keine Tatsache, denn er würde sich im Abgleich mit der Wirklichkeit als falsch erweisen.
Darüber hinaus müssen die überprüfbaren Aussagen auch noch logisch sinnvoll sein. Wenn ich beispielsweise sage „Entweder regnet es jetzt draußen oder es regnet jetzt nicht“, dann kann ich das zwar empirisch überprüfen, indem ich die Hand zum Fenster hinausstrecke und feststelle, dass es gerade regnet oder eben nicht. Der Satz ist aber trotzdem wissenschaftlich unbrauchbar, da er ja in jedem Fall zutrifft und somit beliebig und nichtssagend ist.
Deshalb stellt Wittgenstein im Tractatus nun seine zweite große erkenntnistheoretische Forderung auf. Alle Sätze der Wissenschaft über die Welt und somit über die „Tatsachen“ müssen eine logische Struktur aufweisen und dürfen auf keinen Fall „unsinnig“ sein.
![]()
Sätze über Tatsachen müssen sinnvoll sein!
Wittgenstein macht nun etwas Faszinierendes. Im weiteren Fortgang des Tractatus erstellt er Szenarien, in denen er alle logisch möglichen und erdenklichen Sätze in Hinblick auf ihre wissenschaftliche Brauchbarkeit untersucht. Es gibt nämlich, so Wittgenstein, auf der ganzen Welt nur sechzehn sogenannte „Wahrheitsoperationen“, also nur eine sehr begrenzte Anzahl von möglichen Sätzen, in denen Tatsachen ausgesprochen werden können. Das sind „und“-Sätze, „wenn dann“-Sätze, „oder“-Sätze, „nicht“-Sätze, „weder noch“-Sätze usw. Man kann zum Beispiel sagen: „Ein Baum ist nicht aus Metall“ oder: „Wenn der Gegenstand aus purem Metall besteht, dann ist es kein Baum“. Wittgenstein untersucht nun deren Geltungsansprüche mit dem Ziel, die „allgemeine logische Form der Wahrheitsfunktion“ zu finden, auf die sich all diese Sätze zurückführen lassen. Er kommt zu dem Ergebnis:
Damit sagt Wittgenstein, dass im Grunde jeder Satz, ganz unabhängig davon, welche der sechzehn möglichen Satzkonstruktionen beziehungsweise Wahrheitsfunktionen wir gerade verwenden, letztlich immer nur der Beschreibung eines Gegenstandes oder Ablaufes dient. Aber nicht alle Sätze, in denen man etwas „so und so“ beschreibt, sind wiederum wissenschaftlich brauchbar:
Wittgenstein analysiert nun, welche Art von Sätzen geeignet sind, um Tatsachen zu beschreiben und welche nicht. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich drei verschiedene Arten von Sätzen gibt: sinnvolle, sinnlose und unsinnige Sätze. Für die Wissenschaft brauchbar ist natürlich nur der sinnvolle Satz, denn dieser bildet eine Tatsache so ab, dass man sie auch überprüfen kann:
Si...