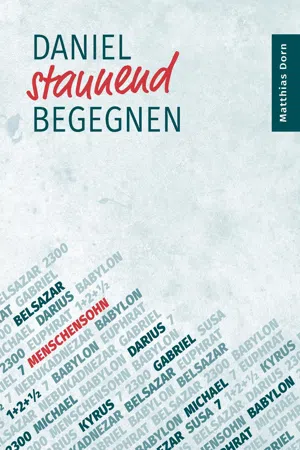![]()
1 Eine erste Begegnung mit dem Danielbuch
Leben wir in der Endzeit?
Schon ein flüchtiger Blick auf lokale, regionale, nationale, ja globale Entwicklungen suggeriert, dass die Welt in vielen Belangen aus den Fugen zu geraten scheint, so als sei ein Kollaps mit nicht mehr zu kontrollierenden Auswirkungen unabwendbar. Sorgenvolle Weltuntergangsstimmung beschleicht zunehmend das Denken der Menschen.
Die Terroranschläge vom 11. September 2001, der um sich greifende Terrorismus, der offensichtlich nicht zum Frieden befähigte Nahe Osten, die Kriege im Irak und in Afghanistan, die Grausamkeiten des Islamischen Staates. Und: die Explosion der Rohstoffpreise, die Abhängigkeit ganzer Volkswirtschaften von knapper werdenden Ressourcen, die Umweltzerstörung und eine mögliche, nahende Klimakatastrophe, immer häufiger auftretende Naturkatastrophen. Und: Die Degeneration der Werte, genauer: die Degeneration der Wertevorstellungen, die Auflösung der klassischen Familienstrukturen, die Zunahme der Kriminalität. Und: Der Wandel westlicher Gesellschaften in übernationale Wirtschaftsdiktaturen, die Suspendierung global handelnder Unternehmen aus der Verantwortung nationaler Wirtschaftskontrollen (Globalisierung), die Subordination des Menschen unter das Primat des wirtschaftlichen Handelns und die globale Finanzkrise samt der verfehlten Eurorettungspolitik. Und: Massenhaft soziale Verarmung und Verelendung, HIV und Aids, das sprunghafte Ansteigen der Migranten und Flüchtlinge weltweit. Und: Mediale Gleichschaltung statt kultureller Vielfalt …. Die Aufzählung könnte noch weitergeführt werden.
Dass diese Liste zutreffend und in gleicher Weise beklemmend ist, kann niemand ernstlich bestreiten. Aber sind damit schon die Indikatoren der Endzeit zutreffend beschrieben? Einige Vergleiche können hier helfen, die Relationen zu Recht zu rücken.
Die Umweltzerstörung und die mit ihr einhergehende Klimaveränderung sind mitnichten allein eine Ausprägung modernen wirtschaftlichen Verhaltens seit der Industrialisierung. Die Entwaldung des gesamten Mittelmeerraumes seit der Römerzeit und erneut seit dem Aufstieg der großen mediterranen Handelsstädte ist mindestens eine ebenso große ökologische Katastrophe wie das Waldsterben der letzten Jahrzehnte.
Noch viel detaillierter als es hier möglich ist, hat DIAMOND (2005) dargestellt, dass politisch-ökologisches Fehlverhalten von Gesellschaften eine der wesentlichen Ursachen für ihren Kollaps ist. Singularisiert DIAMOND diese Ursache, so nennt er jedoch acht Kategorien (DIAMOND 2005,18) an Maßnahmen, die sich an der ökologischen Grundlage der Gesellschaften vergreifen: Entwaldung und Lebensraumzerstörung, Probleme mit dem Boden (Erosion, Versalzung, nachlassende Fruchtbarkeit), Probleme mit der Wasserbewirtschaftung, übermäßige Jagd, Überfischung, Auswirkung eingeschleppter Tiere und Pflanzen auf einheimische Arten und steigender Pro-Kopf-Effekt der Menschen.
Diese die Menschheitsgeschichte in allen Zeiten und Regionen begleitenden Verhaltensweisen deuten darauf hin, dass auch der ökologische Kollaps – DIAMOND (2005,18-20) spricht vom „Ökozid“ – kein erst die Endzeit charakterisierendes Phänomen sein kann, sondern seit jeher Auswirkung politisch-gesellschaftlichen Fehlverhaltens war und ist.
Waren die wütenden Pestepidemien des ausgehenden Mittelalters nicht ebenso furchtbar wie es die erschreckenden Konsequenzen der HIV-Pandemie sind? Werden die Menschen, die zu jener Zeit im Angesicht des Schreckens dieser Epidemien gelebt haben, nicht mit dem gleichen Recht von der Endzeit, die nun anbrechen werde, gesprochen haben, wie es heute viele im Angesicht von HIV und Aids tun?
Und werden die deutschen Soldaten, die in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges im Blut ihrer Kameraden waten mussten, nicht auch von der Endzeit geredet haben, vielleicht sogar noch mehr als es jetzt eher Unbeteiligte bei den Nachwehen des zweiten Golfkriegs tun? Außerdem war in der ganzen Geschichte der Menschen der Krieg immer grausam, grässlich und furchtbar, zu keiner Zeit hatte er so etwas wie ein menschliches „Gesicht“, sieht man vielleicht einmal von den Auswirkungen der Genfer Konvention ab.
Die rapide zunehmende, massenhafte Verarmung, sogar in den Industrienationen, selbst in Deutschland, besonders aber in den Ländern der Dritten Welt, ist kein neues Phänomen. Seit jeher begleitet die Geißel der Armut die Menschen und prägte sich nur manchmal etwas schwächer oder stärker aus als in unserer Zeit. Und auch die Dominanz des wirtschaftlichen Lebens ist in seiner Radikalität nicht neu: Die wenigstens in einigen Staaten existierende sozialstaatliche Rückendeckung ist eine moderne gesellschaftliche Errungenschaft, die nur einem kleinen Teil der Menschen zu Gute kommen kann; und selbst in diesen Staaten waren die Menschen noch bis vor kurzem einem täglichen Kampf um ihr wirtschaftliches Wohlergehen ausgeliefert.
Und auch das weltweite Flüchtlingsproblem, das aktuell immer bedrängender wird, ist kein Charakteristikum allein der Gegenwart. In allen Jahrhunderten wurden Menschen entwurzelt, ihrer Heimat und Kultur beraubt, die Vertreibung der Deutschen aus den ihnen angestammten Gebieten in Osteuropa, das ähnliche Schicksal des palästinensischen Volkes, die fried- und ruhelose Geschichte des jüdischen Volkes, die Flucht der Hugenotten aus Frankreich, der gewaltige Exodus in die Neue Welt und die damit zusammenhängende grausame Verdrängung der amerikanischen Ureinwohner, die Völkerwanderung und natürlich die Umsiedlung ganzer Völker in der Antike gehören zum bitteren Bestand menschlicher Geschichte. Und das Danielbuch weiß auch von einer Vertreibung zu berichten: Ein Teil des jüdischen Volkes wurde nach Babylon geführt.
Selbst das Widererstarken der eher orthodoxen, intoleranten, teilweise sogar militanten Religionen, wie die christlich-nationale Rechte in den Vereinigten Staaten, der fundamentalistische Islam, der nationalistische Hinduismus Indiens, taugt nicht zur Charakterisierung der Endzeit. Schon ein schneller Blick zum Beispiel in die Geschichte Europas erkennt unmittelbar die verheerenden Konflikte, die den religiösen Umbrüchen folgten.
Diese Argumentation lässt sich zu jedem oben genannten Aspekt fortführen und man gelangt zu dem Schluss, dass es zu jeder Zeit Bereiche des menschlichen Lebens gab, die es ohne Abstriche gerechtfertigt hätten, von einer Endzeit zu sprechen. Deswegen sollten wir mit dem Heraufbeschwören endzeitlicher Weltuntergangsszenarien sehr zurückhaltend umgehen.
Leben wir in der Endzeit?
Auch die mehr oder weniger wissenschaftlich durchgearbeiteten und fundierten Annäherungen, unsere Welt oder unsere Gesellschaften zu beschreiben, können diese Frage letztlich nicht eindeutig beantworten, denn es hat zu allen Zeiten starke Umwälzungen der Gesellschaften gegeben, oft revolutionär, gewalttätig, oft in tiefen schnellen Brüchen. Tiefgreifende politische und gesellschaftliche Wandlungen dürften, da sie zu allen Zeiten stattfanden, kaum hilfreich sein, die Endzeit erschöpfend zu beschreiben.
Wenn also die verschiedenen Zustandsbeschreibungen der Welt, der Gesellschaften nicht zur Beantwortung dieser Frage taugen, dann stellt sich die Frage, ob es nicht andere Quellen gibt, die es auszuschöpfen gilt.
Leben wir in der Endzeit?
Theologisch stellt sich der Begriff Endzeit folgendermaßen dar: Mit Kreuzestod und Auferstehung Christi und seiner anschließenden Himmelfahrt ist der von Gott entworfene Erlösungsplan realisiert worden. Die Tür zu einem neuen, friedevollen, ohne das Böse als integralem Bestandteil charakterisierten Reich ist geöffnet. Das heißt, dass die Endzeit mit der Himmelfahrt Christi begonnen hat. Von daher läuft die Uhr der Welt jetzt rückwärts auf das Ende der (End)zeit, also auf die Wiederkunft Christi, zu. So betrachtet leben wir seit jeher in der Endzeit, oder, um im Bild von Dn 2 zu bleiben, der Stein, der die Statue zerstört, fällt schon herab. Endzeit im biblischen Sinne ist also die ganze Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi.
Rein historisch betrachtet verhält es sich anders. Dem Begriff Endzeit ist hier ein Bedeutungsrahmen zu eigen, der leicht missverstanden werden kann. Der Begriff verleitet dazu, die Endzeit nur von ihrem Ende her zu betrachten. Doch diese Denkstruktur, die alles in einem großen Ende, wie immer es auch beschaffen sein mag, münden sieht, verkennt, dass die Endzeit nicht nur vom Ende her zu denken ist, sondern dass ihr vielmehr eine geschichtliche Vergangenheit vorausging, aus der heraus sich die Endzeit in ihrer politisch-historischen Verwirklichung dann erst ergibt. Ist dem Begriff Endzeit wohl ein teleologischer Charakter zu zuerkennen, so ist sie aber auch als prozessualer Fortgang der ihr vorausgehenden historischen Entwicklung zu begreifen. Es ist aus der historischen Sicht nicht möglich und dem Verständnis des Begriffs nicht angemessen, dass die Endzeit spontan mit unbedingten neuen politischen oder historischen Wesensmerkmalen einsetzt, die zur Vorvergangenheit der Endzeit wenig oder gar keine Beziehung haben.
Man wird also gut daran tun, die Endzeit und die ihr vorausgehenden geschichtlichen Abläufe als eine prozessuale historische Einheit zu betrachten. Es ist genau dieses Verständnis von Endzeit, das das Buch des Propheten Daniel im Alten Testament auszeichnet. Es ist, wie Daniel von Gott selbst unterrichtet wird (12, 9)1, für die „letzte Zeit bestimmt“. Was sagt uns Daniel in Bezug auf unsere Frage:
Leben wir in der Endzeit?
Kaum ein Buch des Alten Testamentes hat mit seinen Erzählungen so weiten Eingang in das allgemeine Wissen gefunden, wie das des Propheten Daniel, sieht man einmal von der Genesis ab, zu dem das Danielbuch ganz besonders intensive Bezüge besitzt. Da sind die atemberaubenden Visionen mit ihren geheimnisvollen Symbolen und Zahlen, die eine fortdauernde, unentrinnbare Faszination ausüben; aber auch die bestürzenden Erzählungen von den drei Männern im Feuerofen, dem Wahnsinn Nebukadnezars, der Hybris des Königs Belsazar und der wunderbaren Rettung Daniels in der Löwengrube sind unvergängliche Bestandteile der Weltliteratur. Darüber hinaus sind sie theologisch fundamentale Passagen hoher Dignität von weitreichender Bedeutung.
Bevor wir uns dem Text zuwenden mit dem Versuch, ihn uns neu zu erschließen, gilt es noch zwei Aspekte besonders zu beleuchten: Einmal ist die Frage zu klären, wer dieser Daniel überhaupt war, und zum zweiten sind einige methodische Vorbemerkungen unabwendbar, um die Grundlage zu entwerfen, auf der aufbauend das Buch ausgelegt werden soll.
![]()
2 Zur Person Daniels
So einmalig, ungewöhnlich und faszinierend wie das prophetische Buch Daniel ist auch sein Verfasser. In Daniel begegnet uns eine überragende Persönlichkeit nicht nur von beeindruckendem Format, sondern auch von persönlicher Integrität und überbordender intellektueller Kompetenz. Was wissen wir über Daniel?
SHEA (20022,7-10) beschreibt, dass im Jahr 1995 in der Nähe Jerusalems ein Grab gefunden wurde, an dessen Tür der Text „Dies ist das Grab Daniels“ stand. Die Schreibweise des Namens Daniel (d’any`l) entspricht dem Schreibstil vor dem Exil, archäologische Faktoren deuten darauf hin, dass die Anlage des Grabes aus frühpersischer Zeit stammt. Neben der Grabinschrift ist eine Szene in den Stein gehauen, die einen Mann in einer Grube mit zwei Löwen zeigt, die jedoch den Mann weder angreifen noch töten. Über dieser Szene ist ein Mann zu sehen, der aus einer Öffnung heraustritt.
Es handelt sich bei der dargestellten Szene offensichtlich um die in Dn 6 beschriebene wunderbare Rettung Daniels in der Löwengrube. Dieser bemerkenswerte archäologische Fund legt es nahe, dass wir durchaus von der Historizität der Person Daniels ausgehen dürfen. Es kann kein abschließender Beweis sein, sollte aber Anlass dazu geben, mit Zweifeln an der Existenz dieser Persönlichkeit eher zurückhaltend zu sein.
Ebenso wie das Volk Israel die Gebeine Josefs aus Ägypten mitgenommen hat (Ex 13,19; Jos 24,32), so hat man wohl auch Daniels sterbliche Überreste nach Jerusalem überführt. Es sollte also nicht erstaunen, dass Daniels Grab in Jerusalem und nicht im Zweistromland liegt.
Wichtiger aber als diese archäologischen Zeugnisse sind die, die die Heilige Schrift selbst über Daniel bereithält.
Der Name Daniel bedeutet: Gott ist mein Richter, und zwar in dem Sinne, dass „Gott mir Recht schafft“ (MAIER 20058,76). Das meint, dass Gott derjenige ist, der das letzte, abschließende und mächtigste Wort über diese Welt sprechen wird. Daniels Name ist damit schon Programm.
Dabei ist Daniel nicht nur selbst Prophet, sondern bereits erfüllte Prophetie, denn der hundert Jahre vor ihm lebende Prophet Jesaja weissagt dem König Hiskia (2Kö 20,16-18):
„Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre des HERRN Wort:
17 Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag, und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der HERR.
18 Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel.“
Daniel und seine Freunde sind die Erfüllung dieser prophetischen Aussage.
Nach den Texten in Dn 1 ist Daniel königlicher Abstammung (1,3-6), also aus vornehmem und adligem Haus. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, dass er sich in einem Palast eines Weltreiches klug und angemessen zu verhalten und zu bewegen wusste, wovon ja schon Dn 1 zu berichten weiß. Ihm war also royales Flair nicht fremd und fremd war ihm sicher auch nicht die Schattenseite eines solchen Flairs, das mit Intrigen durchtränkt war. Daniel brachte also eine persönliche Disposition mit, die ihn für die späteren Aufgaben bei Hofe qualifizierte.
Als Daniel mit einem Teil des Volkes Israel ins Exil nach Babylon geführt wird, wird er etwa 15 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Er lebt siebzig Jahre im Exil (9,2) und wird dann Zeuge des ersten Teils des zweiten Exodus zurück in das verheißene Land. Daniel wird bei seinem Tod etwa 85 bis neunzig Jahre alt gewesen sein. Jerusalem und sein Tempel wurden 586 v. Chr. von den Truppen Nebukadnezars zerstört, sodass sich die Lebenszeit des Daniel, von der in seinem Buch berichtet ist, vom Ende des siebten bis ins sechste vorchristliche Jahrhundert erstreckt.
Daniel erfährt von Anfang an eine ungewöhnlich hohe Wertschätzung Gottes. Dies drückt sich zunächst darin aus, dass Gott ihm die Anrede „Du von Gott geliebter“ (10,11+19) zuteilwerden lässt. Daniels Gottergebenheit und sein leidenschaftliches Eintreten für sein Volk und den Glauben mögen die Ursache dafür sein, dass Gott das Herz dieses Mannes so wertschätzte. Wie MAIER (20058,363) vermerkt, werden neben Daniel mit ähnlichen Worten nur noch Mose in Num 12,7f, Maria, die Mutter Jesu in Lk 1,29f und natürlich Christus selbst in Mt 17 so genannt. Jesaja spricht so vom Gottessohn in Jes 42,1. Daniel wird von Gott selbst in einen kleinen, wahrhaft erlauchten Kreis gestellt.
Der mit Daniel, seinen drei Freunden und der jüdischen Oberschicht später ebenfalls nach Babylon exilierte Prophet Hesekiel erwähnt seinen Zeit- und Leidensgenossen Daniel in besonderem Zusammenhang (Hes 14,14+20):
„Wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der HERR.“
Mit Noah und Hiob werden erneut zwei große und herausragende Persönlichkeiten mit Daniel gemeinsam genannt. Außerdem ist es interessant, dass es Gott im Gerichtss...