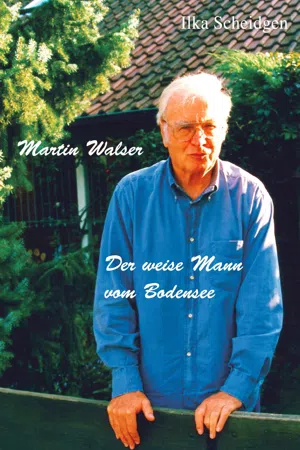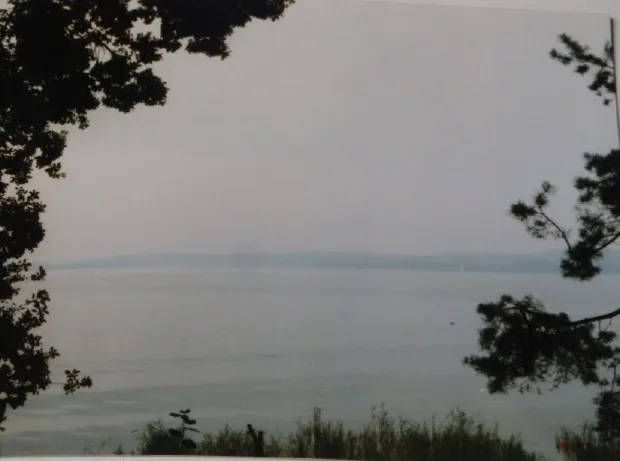![]()
Mein Besuch bei Martin Walser
Ein sonniger Septembernachmittag. Nußdorf – ein ruhiger Ort am Ufer des Bodensees, wenige Kilometer vom geschäftigen Überlingen entfernt und auf Sichtweite der barocken Klosterkirche Birnau. Weinstöcke und Obstbäume stehen in Reih und Glied. Die Sonne und eine leichte Brise verlocken Tausende von Segelbooten dazu, sich auf dem Wasser zu verteilen, und verleihen ihm ein heiter getupftes Aussehen zu. Straßennamen wie Zur Forelle, Zum Hecht, Zur Barbe, Zum Stichling lassen den See auch auf dem Trockenen allgegenwärtig sein.
Mit dem Besuchstermin bei Martin Walser hat es etwas gedauert, denn als ich ihn zum ersten Mal anrief, war er noch mitten in der Arbeit an seinem neuesten Roman und bat mich zu warten, bis er ihn beendet hätte. Dann noch einmal ein Aufschub. Walser war zwischenzeitlich erkrankt. Doch dann ist es so weit, dass ich ihn in seinem Haus in seinem Haus am Bodensee besuchen kann.
Das Haus von Martin Walser, schindelbedeckt, weinlaubumrankt. Die Klingel am Gartentor von Stauden überwuchert.
Frau Walser empfängt mich und führt mich hinauf ins Arbeitsreich ihres Mannes.
Es ist unter dem Giebel des großzügigen Einfamilienhauses eingerichtet. Der Blick geht hinunter zum See, an dessen schilfbestandenem Ufer das Grundstück unmittelbar angrenzt.
Hier lebt Martin Walser mit seiner Familie seit 1968.
Und er schätzt es, in so unmittelbarer Nähe des Bodensees zu wohnen, der ihn seit seiner Kindheit wie eine Selbstverständlichkeit begleitet.
Nach einer herzlichen Begrüßung setzen wir uns auf die bequemen Sessel unmittelbar vor dem großen Giebelfenster mit Blick auf Garten und See. Hier also wirkt Martin Walser.
Der Bodensee, an dem Walser 1927 in dem Ort Wasserburg geboren wurde, hat ihn, wie er mir erzählt, nicht losgelassen. Nach seinem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte in Tübingen und Regensburg und seiner Beschäftigung beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart ist er mit Beginn seiner Laufbahn als freier Schriftsteller 1957 an ihn zurückgekehrt. Der See ist Walser-Lesern aus seinen Romanen bestens vertraut. Ohne ihn als Hintergrund scheint Walser auch beim Schreiben nicht auskommen zu können.
Sein Schreibtisch und das Regal mit seinen Arbeitsbüchern (allesamt mit der Hand geschrieben und ordentlich nummeriert, damit er sich aus ihnen für seine Romane ‚verproviantieren’ kann) stehen in einer Nische des hohen hellen Raumes, am weitesten entfernt vom Fenster.
Zur Zeit schaut man von hier oben vorwiegend auf Bäume, die, jetzt noch im vollen Laub, den See und die Sonnenreflexe auf dem Wasser nur spärlich freigeben. Man muss nah ans Fenster treten oder auf den angrenzenden Balkon, um das Ufer des Sees zwischen den mächtigen efeubewachsenen Stämmen von Eichen und Kiefern hindurchsehen zu können. Dort liegt das Ruderboot, selten genutzt, wie mir Martin Walser erzählt und ein altes Surfbrett, das inzwischen abgelöst wurde von einem besseren, moderneren, welches er häufiger benutzt. Aber am liebsten das pure Element Wasser! Nichts geht darüber: Schwimmen im See. Und nicht nur mal kurz, sondern eine Stunde lang. Erst dann wird es richtig wohltuend. Man lässt alles hinter sich, ist frei. Der See - ohne ihn kann Walser sich ein Wohnen nicht vorstellen.
Frau Walser tritt noch einmal diskret ins Reich ihres Mannes, bringt uns Kaffee und Kuchen und ist so unauffällig, wie sie eingetreten ist, wieder zur Tür hinaus. Kurz darauf begehrt der Hund, der elfjährige Appenzeller „Robbi", Einlass. Martin Walser öffnet ihm, bedenkt ihn mit einem zärtlichen Blick. Er wird die ganze Zeit anwesend sein, ohne zu stören.
Martin Walser, einer der bedeutendsten und erfolgreichsten deutschen Gegenwartsautoren, mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, liebt trotz seines hohen Bekanntheitsgrades die Zurückgezogenheit. Öffentliche Auftritte sind ihm, der sich in jungen Jahren offen politisch engagierte (z.B. im Wahlkampf 1961 für die SPD oder als Vietnamkriegsgegner} unangenehm geworden. Was nicht heißen soll, dass er sich nicht weiterhin ins politische Geschehen einmischt: kritisch und differenziert, mitleidend und nicht besserwisserisch sich zu Wort meldend.
Ziemlich einsam unter den Intellektuellen stand Walser mit seiner Auffassung zur deutschen Teilung, mit der er sich - seinem „Geschichtsgefühl" gemäß -nicht abfinden konnte. Das trug ihm viel Unverständnis, ja Häme ein. Dennoch empfand Walser nach der Wiedervereinigung weder Genugtuung noch gar Schadenfreude, sondern nur eine reine Freude darüber, dass es so gekommen ist, und dass er es noch erleben durfte.
Und dann sind da die Walserschen Romanfiguren: allesamt aus dem Mittelstand oder Kleinbürgertum, dem der Autor sich selbst zurechnet – Menschen wie du und ich. Treffsicher und mit Witz, subtil und doch niemals verkomplizierend zeichnet Walser seine Charaktere.
Irgendwie liebenswürdig sind sie eigentlich alle in ihren Marotten, Selbstzweifeln, Erfolglosigkeiten. Selbst die Karrieresüchtigen und Prestigejäger werden, obwohl psychologisch treffend als solche enttarnt, in ihren Verrenkungen und Heucheleien niemals wirklich böse niedergemacht oder vom Moralkatheder aus verurteilt.
Nein, Martin Walser ist kein Pessimist, obwohl er sich in den Schwächen und Verbiegungen der Menschen bestens auskennt. Er ist ein Moralist, ohne Moral zu predigen. So versteckt Walser in seinen Romanen Reflexionen klar wie Glas und von scharfsichtiger Analyse.
Und fleißig ist er obendrein. Mehr als 50 Buchveröffentlichungen (Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele, Essays) liegen von ihm vor. Weil er sich keine andere Lebensform als die des Schreibens vorstellen kann. Das hat schon in der Kindheit angefangen. Das Schreiben war für Walser eine Fortsetzung seiner ersten Leseerfahrungen. Lesen und Schreiben – das ist eine Lebensart. Eine Form, sich selbst zu begegnen.
In dem Band „Zauber und Gegenzauber" mit Aufsätzen und Gedichten aus den letzten 30 Jahren erhält man einen ausgezeichneten Überblick über Walsers scharfsichtige Analysen von Zeitgeschichte, über Hintergründe seines Schreibens („Meine Muse ist der Mangel") und für viele, die ihn vor allem aus seinen Romanen und Theaterstücken kennen, sicher überraschend -auch über seine Lyrik, knappe Stimmungsnotate, zuweilen ironisch gebrochen, dann wieder von einer Schönheit und Empfindsamkeit, ja Zartheit, dass darin aufscheint, was Walser in einem Aufsatz über Gedichte (Eine Verführung zum Schönen) schreibt: „Das ist es, glaube ich, was die Gedichte schaffen: ein deutliches Gefühl. Das sogenannte Dasein ist für eine kurze Zeitlang nicht mehr stumm oder dunkel, sondern deutlich, bestimmt."
Dieser Band kam nicht in seinem Stammverlag Suhrkamp heraus, sondern in dem relativ unbekannten Verlag Isele. Wie es zu dieser Zusammenarbeit kam, frage ich Martin Walser. „Ja, dieser junge Verleger Klaus Isele," antwortet er, „ist eine liebenswürdig sensationelle Ausnahme. Ein nach meinem Gefühl geborener Verleger, der alles selber machen muss, der das auch alles gelernt hat." Walser hat dessen Wege schon eine Weile beobachtet und attestiert ihm „Geschmack und Leidenschaft". Und weil Walser weiß, wie schwer es für einen jungen Verlag ist, unterstützt er ihn, denn, so sagt er, „es ist mein Interesse, dass dieser Verlag gedeiht."
Natürlich bekommt ein so bekannter Schriftsteller wie Martin Walser auch viele Manuskripte von jungen Autoren zugeschickt. Früher hat er sie gelesen und auch schon manch einem Autor auf den Weg helfen können. Heute habe er einfach nicht mehr die Zeit und Kraft dafür. „Also das muss ich für mich abschreiben," sagt er mit aufrichtigem Bedauern, „denn man will ja zurechnungsfähig reagieren. Man ist ja ein bisschen mitverantwortlich. Und es ist so, dass man einfach zu dem nicht kommt, was man selber noch machen möchte."
Wir kommen auf das „Tagebuch eines Schriftstellers" zu sprechen. In dieser Essay-Sammlung aus den Jahren 1990-1993 lässt Walser den Leser ein gutes Stück hineinschauen in seine Schriftsteller-Existenz, die im Grunde in jeder Hinsicht eine ungesicherte ist. Denn, so erfährt es Walser, „Sprache ist das am wenigsten Verfügbare." Vom Schreiben und Lesen, von Erfahrungen und Meinungen ist hier die Rede. Letztere beurteilt Walser äußerst kritisch, denn „Meinung tendiert zum Urteil" und „je mehr Meinung, desto weniger Erfahrung". Wie ist er zu dieser Skepsis gegenüber der Meinungsäußerung, vor allem derjenigen in den Medien, gelangt, die für ihn etwas angenommen hat von „erpresserischem Meinungsabverlangen", frage ich ihn. „Das liegt natürlich an den Erfahrungen", antwortet Walser, „dass ein großer Teil der aktuellen Teilnahme in Sprache bei Intellektuellen in einer besonderen Sprachart stattfindet, bei der es fast ausschließlich ums Rechthaben geht." Er selbst habe auch bei sich, wenn er frühere Äußerungen kritisch beleuchte, feststellen müssen, wie „grell" sie teilweise gewesen seien.
Aber dass Meinungen heutzutage mehr und mehr im Vordergrund stünden, vielfach lediglich zu Schlagabtausch, zur Bekräftigung der eigenen oder zur Ablehnung der anderen führten, bedauert Walser zutiefst. „Meinung", sagt er, „das klingt nach: Es reicht. Nach: Bescheidwissen." Das schmerzt ihn. Wenn es zum Beispiel um seine Person geht. Wenn andere, Kollegen zumal, ihn in die rechte Ecke schieben wollen, nur weil er sich nicht mit der Teilung Deutschlands abfinden wollte und dann nach der Wiedervereinigung diese als „das liebste Politische seit ich lebe" bezeichnete.
Im Grunde, so sagt Martin Walser in unserem Gespräch, und es kl...