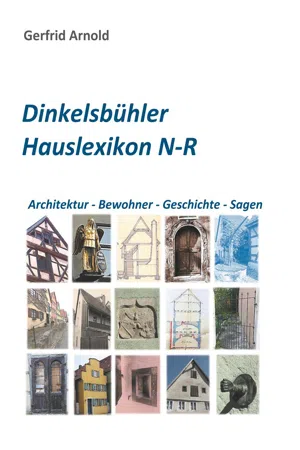![]()
Nördlinger Straße
Die längste der vier Torstraßen. Sie durchquert das gesamte Nördlinger Stadtviertel zwischen Ledermarkt und Nördlinger Tor. Der erste Teil ab dem Karmeliterkloster bis zur Wethgasse, wo einst das Staufertor stand, hieß bis 1911 Ledermarkt. 1804 auch Ochsenmarkt genannt – der Rindermarkt fand hier bis in die 1950er Jahre statt. Die Straße hatte diese Richtung bereits im Königshofareal, zumindest in der Stauferstadt. Danach verläuft sie der Uferterrasse der Wörnitz folgend in einer Krümmung. Zur besseren Verteidigung knickt sie am Staufertor wie auch am Nördlinger Tor ab. Aus gleichem Grund stehen die Häuser schräg zur Straßenflucht und gestaffelt, um in Straßenrichtung schießen zu können. Auf zwei kleinen Straßenplätzen befinden sich Brunnen. Der Wethbrunnen, früher Oberer Röhrbrunnen genannt, liegt bei der Wethgasse (s. Bd. 4) am ehemaligen Staufergraben. Dort lag bis 1795 ein als Pferdeschwemme genutzter Löschweiher. Der Fischerbrunnen, früher Unterer Röhrbrunnen genannt, liegt beim Fischergässlein (s. Bd. 1). Häuser in der Nördlinger Vorstadt, die beim ehemaligen Staufertor bei der Wethgasse begann, sind im Schuldbuch ab 1399 genannt. Hier sind noch Gartengrundstücke und Freiflächen, es wohnten hier Gerber, Wollwarenhersteller und Landwirte. Das Viertel litt durch Beschuss gegen Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Den Namen hat die Straße von der Stauferstadt und späteren Reichsstadt Nördlingen, weil sie seit dem frühen Mittelalter über Mönchsroth führte. Die Trasse der heutigen B 25 am gegenüber liegenden Wörnitzufer wurde 1814/1815 angelegt.
Nördlinger Straße 1
*H Vorkragung, Portal, Tür
Baubeginn ca. 1550. Liegender Dachstuhl. Kleiner Aufschiebling. 1690 als Haus und Höfle genannt, 1750 Haus und Hof. 1903 baut Zahntechniker- und Baderswitwe Wilhelmine Bühler einen Kamin.
Das kleine Bürgerhaus (dreifensterbreit, zwei Obergeschosse, zwei Dachgeschosse) steht mit dem steilen Giebel zur Straße und hat einen Seitenflur. + Das Erdgeschoss war ursprünglich Hochparterre und das niedrigste Stockwerk im Haus. Mitte des vorigen Jh. wurde der Treppenaufgang abgebrochen und ein hoher Eingang mit verkröpfter Putzrahmung und Scheitelstein angelegt. Die achtfach kassettierte Tür dieser Zeit hat ein hohes unterteiltes Oberlicht. Einbau einer Schaufensterfront anstelle zweier Wohnzimmerfenster. + Das 1. Obergeschoss kragt gekehlt auf schrägen Eckkonsolen vor. Fensterband. + Knapp über den Fenstern kragt das 2. Obergeschoss ebenfalls stark vor. Symmetrisches Fensterband. + Im 1. Dachgeschoss wurde anstelle der Ladeluke ein Zwillingsfenster eingebaut. + Im Spitzboden befindet sich eine kleinere Ladeluke.
Im 18. Jh. Eigentum oder bewohnt von Stricker, Buchbinder, Forstmeister. + Im 19. Jh. Eigentum oder bewohnt von Forstmeister, Chirurg, Bader/Zahntechniker.
Nördlinger Straße 2
*G St. Paulskirche, Alte Kapelle
Die Kirche St. Paul steht am Platz der Kirche St. Katharina des ehemaligen Karmeliterklosters. Die protestantische Hauptkirche wurde 1840-1843 als Predigtsaalbau im klassizistischen Stil Schinkels mit historischen Formelementen erbaut.
Für den Kirchenneubauwurde die „Alte Kapelle“ St. Johannes abgerissen, die unmittelbar neben der Klosterkirche auf der heutigen Hofzufahrt und dem Gehsteig vor St. Paul stand. Der Tradition nach handelt es sich um die karolingische Kapelle eines um 730 gegründeten Königshofs, einer „Villa“, die amältesten Kirchenplatz Dinkelsbühls stand. Eine Kapellenlegende, die von den Karmeliten beharrlich und eifrig gepflegt wurde, birgt den wahren Kern der Stadtgründung. Die Kapelle sei ihnen vom ansässigen Hofbesitzer, dem „Dinkelbauer“, geschenkt worden, worauf zuerst ihr Kloster und danach die Stadtsiedlung entstanden sei. Tatsächlich wurde den Mönchen die Alte Kapelle von der Reichsstadt überlassen, als sie 1291 an diesem Platz ihr Kloster gründeten. Der „Dinkelbauer“ der Legende kann somit als ein Königshofverwalter mit Namen Thingolt verstanden werden, der Rechtsvorgänger der Reichsstadt Dinkelsbühl war. Tatsächlich enthält eine Dinkelsbühler Siegelumschrift die Bezeichnung „Villicus“.
Stauferstele
*D *G
Vor der St. Paulskirche, Nördlinger Straße 2, steht seit 2013 eine Kalksteinsäule zur Erinnerung an die Stauferstadt Dinkelsbühl. Das salische Hausgut war vererbtes staufisches Hausgut von 1125 bis zum Tod des letzten staufischen Schwabenherzogs Konradin 1268. Allerdings war es seit 1251 an die Grafschaft Oettingen verpfändet.
Die regelmäßige Achtecksäule ist in vier ungleiche Abschnitte unterteilt und steht auf einem flachen quadratischen Sockel. Sie geht in ihrer Form auf die einzigartige Architektur des Castel del Monte zurück, das Kaiser Friedrich II. in Apulien bauen ließ. Es symbolisierte als Herrschaftszeichen das himmlische Jerusalem in Verbindung mit staufischer imperialer Macht.
Auf dem Sockel steht an der Seite zur Nördlinger Straße:
INGEBORG ET ANDREAS RAAB DEDERUNT [haben übergeben]
MARKUS WOLF FECIT MMXIII [hat gemacht 2013]
Der oberste, schmale Teil läuft als Goldband um die Säule.
Auf der Säulenfläche zur Nördlinger Straße ist oben das Wappen mit dem einköpfigen Königsadler gemeißelt, darunter der Text:
FRIEDRICH I.
BARBAROSSA
ERSTER KAISER
AUS DEM HAUSE
HOHENSTAUFEN
SOHN VON HERZOG
FRIEDRICH II.
VON SCHWABEN
UND DER WELFIN
JUDITH
GRÜNDET AN DER
WÖRNITZFURT
BEI DER KREUZUNG
DER VOM MITTELRHEIN
ZUR DONAU FÜHRENDEN
>NIBELUNGENSTRASSE<
MIT DER VON
WÜRZBURG KOMMENDEN
NACH AUGSBURG UND
ITALIEN FÜHRENDEN
STRASSE UM 1170/80
AUF STAUFISCHEM
HAUSGUT DIE STADT
DINKELSBÜHL
Richtigstellung und Ergänzung: Die bedeutende mittelalterliche Nord-Süd-Straße ist 1236 als Pilgerweg (Romweg) beschrieben und führte von Bremen an der Nordsee über „Dinkepole“ nach Rom. – Dinkelsbühl ist keine staufische Stadtgründung, sondern eine gewachsene Siedlung, deren Ursprung auf einen wahrscheinlichen Königshof um 730 zurückgeht. Er gehörte mit seinem dazugehörigen Umland um 1079 zum staufischen Herzogtum Schwaben und wurde 1125 staufisches Hausgut. Die Ansiedlung wurde zum militärischem Stützpunkt ausgebaut und mit einem Bering befestigt. Unter dem Stauferkönig Konrad III. dürfte Dinkelsbühl um 1142/46 ein Marktort geworden sein, weshalb man Dinkelsbühl als Königsstadt bezeichnen kann. – Sein Neffe, Kaiser Barbarossa, unterzeichnete 1188 einen Ehevertrag, in dem das staufische Eigengut „Tinkelspuhel“ als Burgum, als befestigter Ort, genannt wird und Teil des Heiratsguts ist.
Auf der Säulenfläche z...