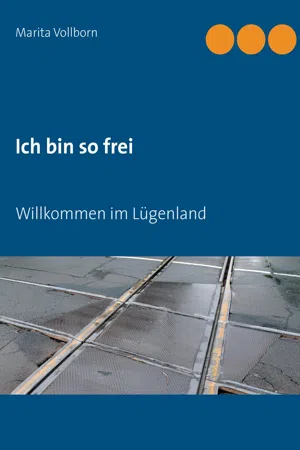![]()
Ein blauendes Grau – so präsentierte sich der Morgen des 4. November 1989. Der Nieselregen, der das Berliner Pflaster in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Nässefilm überzogen hatte, schien mit dem Wind ein Abkommen geschlossen zu haben, diesen Tag aus der herbstlichen Schmuddelzeit auszusparen. Ich sah zum Himmel hinauf und erahnte hinter der Wolkendecke eine ungeduldige Sonne. Eine Frau mittleren Alters, das kurze Grauhaar unter einem locker gebundenen Schal fast verschwunden, folgte meinem Blick. „Det Wetter is uns jut!“, sagte sie und sprach damit aus, was mir durch den Kopf gegangen war. Dabei lächelte sie mich an, wie man nur Gleichgesinnte anlächelt: in stillem Einvernehmen, verschwörerisch. Wir kannten uns nicht, aber wir fremdelten auch nicht. Diese Vertrautheit zwischen Menschen, die sich in den Demonstrationszügen begegneten, war eine der großen Merkwürdigkeiten des Jahres 1989. Denn wir, die wir in der DDR lebten, hatten gelernt, einander zu misstrauen und unauffällig, ja unsichtbar zu werden. Zwanglose Blickkontakte gehörten nicht unbedingt zu unserem Repertoire. Jetzt aber fühlten wir uns stark und einflussreich – wohl das erste Mal in unserem Leben. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass dieses Wir-Gefühl einmal so real sein könnte, so unorthodox, so ehrlich und natürlich.
Ich bin ein Kind dieser Deutschen Demokratischen Republik, dort geboren und aufgewachsen, und ich war geprägt von der allumfassenden kognitiven Dominanz der Sozialistischen Einheitspartie Deutschlands, der SED, ihrer Doktrin, ihrem Erziehungs- und Bildungsstil. „Sozialistische Persönlichkeiten“ sollten wir werden: Sinn und Inhalt des Lebens junger Leute in der DDR sollten darin bestehen, „alles zu tun für die Sicherung des Friedens, für das Wohl der Menschen, das Glück des Volkes, die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen“.11 Unerbittlich gebrandmarkt und gemaßregelt wurden jene, die sich nicht fügen wollten, aber ebenso vehement wurde versucht, den Kindern mit Hilfe der immer gleichen Geschichten über siegreiche, uneigennützige oder standhafte Proletarier Empathie für die Schwachen und Unterdrückten, Hilfsbereitschaft, Mut und (Selbst-)Disziplin zu lehren. Dagegen wurde die „Freiheit“ in ihrer individualisierten Form nie diskutiert – der Begriff gehörte zu den Unworten und durfte nur dann in Gebrauch kommen, wenn vom Freiheitskampf der Arbeiter und Bauern die Rede war. Das mussten wir in der 12. Klasse am eigenen Leib erfahren, nachdem wir es gewagt hatten, während eines „Kulturprogramms“ das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ anzustimmen. Wir erhielten von der Schulleitung einen Verweis, was eine schwere Ahndung darstellte. Noch eine derartige Verfehlung, so wurde uns vom Direktor mitgeteilt, und wir müssten die Erweiterte Oberschule verlassen. Abitur und Studium wären damit passé gewesen.
Wir lernten, dass sich die Verwirklichung persönlicher Ziele und Wünsche gänzlich im gesellschaftlichen Erfordernis aufzulösen hatte. Das Erreichte sollte dem Volk dienen, nicht dem Einzelnen. Diese Mischung aus Zwang und Idealisierung (mit dem Schwerpunkt Zwang) verwandelte die Vielfalt in Monotonie und verurteilte zum Stillhalten. Wir wurden gedrillt, die Köpfe zu senken. Das Wort „Gemeinschaft“ erhielt einen üblen Beigeschmack. Ich hatte in meiner Schulzeit oft das Gefühl, Bestandteil einer amorphen Masse zu sein, die einzig nur deshalb nicht zerfloss, weil sie in eine Grube geschaufelt worden war. Dass diese Masse auch gären konnte, war nicht nur für mich undenkbar gewesen.
Allein die Zahl der Demonstranten an diesem 4. November musste den Kadern Schauer über den Rücken jagen: Mehrere hunderttausend Menschen, die Veranstalter sprachen damals von einer Million, waren auf den Beinen, um für eine demokratische Umgestaltung der DDR auf die Straße zu gehen. Die Initiative zur Großdemo war von Ostberliner Theaterleuten und Künstlern ausgegangen, die es tatsächlich geschafft hatten, eine Genehmigung für eine Demonstration entsprechend Artikel 27 und 28 der Verfassung der DDR einzuholen – eine Ungeheuerlichkeit nahe am Wunder für einen Staat, der auf Grenzverletzer schießen ließ, Dissidenten für Jahre hinter Gitter brachte, Familienmitglieder und Freunde als Informelle Mitarbeiter anheuerte, Ausreisewillige wie Verbrecher behandelte, kritischen Zeitgenossen Lehre, Studium oder Karriere verweigerte und ein ganzes Volk hinter einer Mauer einsperrte.
Ich wusste damals nicht, dass es sich um die größte Demonstration der Nachkriegsgeschichte handelte, aber mir nahm der Anblick des Menschenmeeres den Atem. Natürlich kannte ich Aufmärsche, diese erzwungenen, verlogenen Auftritte: widerstrebend vereinte Kollektive an jedem ersten Mai, zur üblichen Kundgebung am Kampf- und Feiertag der Arbeiterklasse. Doch hier demonstrierten wir freiwillig. Mir war, als wäre jeder von uns eine Zelle, die den riesigen Organismus, den man Volk nennt, endlich zum Verstoffwechseln der Lügen antreibt. Das Wimmeln in den Straßen hatte Richtung und Ziel, ein Strom der Stolzen und Entschlossenen wälzte sich von der Mollstraße über die Karl-Liebknechts-Straße bis hin zum Marx-Engels-Platz, wo der „Palazzo Protzo“, der hässliche Klotz baugewordener SED-Machtphantasien, oder, offiziell: der „Palast der Republik“, stand. Von dort strebten wir dem Alexanderplatz zu, doch mehrere hundert Meter zuvor stockte der Zug. Zunächst befürchteten wir das Schlimmste, und ein besorgtes Raunen durchlief die Reihen. Unruhig traten wir von einem Fuß auf den anderen, versuchten einen Blick über die Köpfe der anderen hinweg zu erhaschen.
Junge Leute wurden auf Schultern gehievt und wieder herabgelassen, viele Hände stützten und hielten fest, damit niemand fiel. Mich schauderte. Was, wenn die Staatsmacht nun doch mit Waffengewalt auf diesen aufstandgleichen Massenmarsch reagierte, wenn die Genehmigung eine Farce war, die Polizei und Kampftruppen weiter vorn die Menschen schon auseinander knüppelten und von hinten die Grenztruppen mit ihren Kalaschnikows nachrückten? Schließlich hatte Honecker-Nachfolger Egon Krenz in der Aktuellen Kamera das Juni-Massaker nach den Protestkundgebungen chinesischer Studenten auf dem „Platz des Himmlischen Friedens“ in Peking, dem Tian' anmen-Platz, gutgeheißen, hatte die Partei- und Staatsführung am 7. Oktober, dem 40. Gründungstag der DDR, die am Rande der Jubiläumsfeierlichkeiten mit Ausrufen wie „Demokratie – jetzt oder nie“ Protestierenden mit Schlagstöcken und Fußtritten malträtiert und festgenommen. Ich selbst war zusammen mit vielen weiteren hundert Menschen einen Monat vor der großen Alex-Demo auf meinem Weg in die Gethsemanekirche12 im Bezirk Pankow an schwer bewaffneten Einsatzkräften vorübergezogen, die, ihre Maschinengewehre im Anschlag, in den Nebenstraßen postiert waren, um uns Demonstranten den Weg abschneiden und jederzeit eingreifen zu können. Obwohl wir an diesem Abend ungestört unsere Kerzen auf dem Vorplatz anzünden und den Diskussionen in der Kirche folgen konnten, blieb das ungute Gefühl, eingekesselt zu sein. Die Staatsmacht war nervös, und niemand wusste, wie sie reagieren würde.
Doch auch heute blieb alles ruhig. Ich sah weit und breit keine Uniform. Das Stocken war einfach dem Platzproblem geschuldet: Mehr Menschen passten nicht auf den Alex. Schon von hier aus hörten wir das Hallen der Lautsprecher, das darauffolgende jubelnde Gebrüll, das Klatschen von zigtausend Händen, verstanden aber kein Wort. So wühlten wir uns bis zur Tribüne vor, einem Podest, das mit einem Geländer aus Fichtenbrettern gesichert war, nagelneuen Fichtenbrettern, wie ich mit Erstaunen feststellte. (Schließlich war Baumaterial in der DDR eine Rarität.) Ich kann mich nicht mehr erinnern, welchen Redner wir als ersten zu Gesicht bekamen, aber ich weiß noch genau, wie es sich anfühlte, ihn freiheraus beurteilen, seine Ausführungen für gut oder schlecht befinden und das auch äußern zu können.
Den Stasi-Generaloberst Markus Wolf oder den Berliner SED-Chef Günter Schabowski lauthals auszubuhen, dem Schriftsteller Stefan Heym und dem Liedermacher Gerhard Schöne frenetisch zu applaudieren – das kam einem Frontalangriff auf das System gleich. Spätestens als Christa Wolf vor das Auditorium trat und „Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg“ ins Mikrofon rief, schien alles möglich. Plötzlich verloren die Begriffe „Gemeinsinn“, „Gemeinwohl“ und „Gemeinbesitz“ ihren parteifunktionalen Beigeschmack. Sie begannen sich mit Leben zu füllen; die Vorstellung, mit vereinter Kraft tatsächlich einen demokratischen Sozialismus erschaffen zu können, die Altkader vom Sockel zu stoßen und als Volk die Macht zu übernehmen, ergriff die Menge. Die Ziele dieser Demonstration jedenfalls gingen völlig an den politischen und wirtschaftlichen Interessen des Westens und der Kirche vorbei, wie sich noch zeigen sollte.
Wenn ich an den Herbst 1989 zurückdenke, kann ich mich an zahllose politische Treffen, kleinere und größere Demos, an prominente und mir unbekannte Redner und Akteure erinnern – jedoch nicht daran, je von einer Angela Merkel gehört oder gelesen zu haben. Nur zwei bekannte Gesichter sollte ich später wiedersehen: Gregor Gysi, damals Rechtsanwalt, und Lothar Bisky, zu dieser Zeit Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen der DDR. Gysi und Bisky waren als SED-Vertreter während der Großdemonstration auf dem Alexanderplatz aufs Podium getreten und saßen im vereinten Deutschland für die PDS/Die Linke im Parlament. Wo aber war Angela Merkel, die heute von manchen Zeitgenossen als mächtigste Frau der Welt gehandelt wird? Merkel, die 1986 am Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlin ihre Physikpromotion absolviert hatte, konnte das Aufbegehren der Massen natürlich nicht verborgen geblieben sein. Doch sie verhielt sich auffällig still. Einem Institutskollegen soll sie auf seine Frage, warum sie nicht auf die Straße oder zu politischen Versammlungen ging, geantwortet haben: „Ach, mal gucken, was draus wird.“13 Taxieren, Taktieren, Abwarten, Aussitzen gehörten offenbar schon zum Repertoire der 35jährigen: Erst wenn andere aktiv geworden, gestürzt oder ihnen Flügel gewachsen waren, wenn ein Intermezzo zum Faktum geworden war – dann trat sie auf den Plan und fällte Entscheidungen, oft mit heftigen Nachwehen verbunden, so manche unwiderruflich.
Nicht nur deshalb ist vielen die Person Merkel bis heute rätselhaft geblieben. Wie konnte ein so unbeschriebenes Blatt, ein Mädel aus dem Osten, eine solche Blitzkarriere hinlegen? Wer Details erfahren will, wird kaum fündig. Seltsam blutleer erscheint der Mensch Angela Dorothea, geborene Kasner. Selbst im Internet, sonst ein Quell skurriler Nichtigkeiten, herrscht ein Informations- und Spekulationsvakuum. In ihrer 2004 erschienenen Interviewsammlung mit dem wenig glücklichen Titel „Mein Weg“ (ein Titel, der, ob gewollt oder nicht, an Erich Honeckers Memoiren „Mein Leben“ erinnert) antwortet sie ihrem Interviewer, dem ehemaligen Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Hugo Müller-Vogg, auf die typische Weise: distanziert, kalkuliert, das offiziell Zu-Wissende in immer neuen Worten wiederholend.14 Es ist wie es ist, und es war wie es war, könnte die Quintessenz ihrer Äußerungen lauten.
In Wirklichkeit haben Förderer wie Anhänger fleißig am Mythos Merkel gebastelt. Merkel ist ein Konstrukt, eine Projektionsfläche für verschiedene Ansichten. Keineswegs waren es Glück und Können, die sie an die Spitze des deutschen Einheitsstaates katapultierten – sie war in die richtigen Kreise hineingeboren worden. Auf ihrem Weg nach oben verstand sie es prächtig, die Gunst der Stunde zu nutzen und Widersacher aufs politische Abstellgleis zu schieben. Ihr Vater Horst Kasner, Spitzname „roter Kasner“, war nicht gerade für seine Opposition zur Staatsführung und zur Kirchenpolitik der SED bekannt. Er galt als Erfinder des Begriffs „Kirche im Sozialismus“ und hatte als Leiter des Pastoralkollegs in Templin, einer Fortbildungsstätte der evangelischen Kirche, Zugang zu einflussreichen Kreisen. Zu seinen ständigen Gesprächspartnern in punkto SED-Kirchenpolitik zählten die Rechtsanwälte Clemens de Maiziere, Vater Lothar de Maizieres und Wolfgang Schnur, späterer Vorsitzender des Demokratischen Aufbruch (DA).15 Sowohl Clemens de Maiziere als auch Wolfgang Schnur waren lange Jahre Spitzel der Staatssicherheit. Dass Kasners Tochter Angela in einem von politischen Debatten und Allianzen geprägten Umfeld aufwuchs, dürfte ihrem Aufstieg nicht hinderlich gewesen sein.
1978 übernahm sie aus freien Stücken Leitungsaufgaben in der Freien Deutschen Jugend (FDJ), der Jugendorganisation der DDR, und wurde Sekretärin für Agitation und Propaganda am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften, einer Einrichtung, die immerhin rund 600 Mitarbeiter zählte. In ihrem offiziellen Lebenslauf wird dieses Amt als „Kulturfunktionärin“ bezeichnet. Ich selbst habe ebenfalls ein Hochschulstudium in Berlin absolviert, allerdings an der Humboldt Universität, kann mich aber nicht erinnern, dass die FDJ in unseren Seminargruppen oder im Institut einen Kulturbeauftragten bestimmt hätte. Dagegen war es sehr wohl üblich, „Agitation und Propaganda“ in die Hände eines Studenten oder Mitarbeiters zu legen. „Agitation und Propaganda“ war die unbeliebteste aller Funktionen und wegen der von der Partei- und Staatsführung erwünschten Phrasendrescherei am meisten verpönt. Ziel war es, die Verzagten - die es offiziell in der DDR selbstverständlich nicht gab - auf Linie zu trimmen, die anderen auf dem Weg, zur sozialistischen Persönlichkeit heran zu reifen, zu unterstützen und den gemeinsamen Kampf gegen den imperialistischen Klassenfeind im Westen ideologisch zu untermauern. Vom Agit-Prop- Verantwortlichen wurde unter anderem verlangt, regelmäßige Zeitungsschauen mit Artikeln aus den SED-und FDJ-Organen „Neues Deutschland“ und „Junge Welt“, die die außenpolitische Lage aus Sicht der kommunistischen Weltanschauung und die Überlegenheit des Sozialismus zum Inhalt hatten, zu veranstalten sowie entsprechende Vorträge zu Jahrestagen, Appellen, Feierlichkeiten oder sonstigen Anlässen zu organisieren. Ein ideologisch klarer und aus Sicht der SED „eineindeutiger“ Standpunkt waren Grundvoraussetzung. Ich habe nie erlebt, dass jemand gezwungen wurde, diesen Posten zu übernehmen. Allerdings: Wer es leichter haben wollte in Studium und Beruf, für den war außerordentliches politisches Engagement im Sinne der Partei- und Staatsführung durchaus hilfreich.
Sowohl in meiner Abiturklasse als auch später in unserer Seminargruppe war meist ein SED-Mitglied oder ein Mitglied der Blockparteien für Agitation und Propaganda zuständig – zwingend notwendig war das aber keineswegs. Ohnehin habe ich während meiner Schul- und Studienzeit, die ich ebenso wie Angela Merkel in der DDR absolviert habe, die Erfahrung gemacht, dass der direkte politische Druck auf den Einzelnen im Laufe der Jahre sogar nachließ. In der Schule bestimmte häufig noch der Lehrer anhand der Zensuren und der Mitarbeit, wer leitende Positionen in der Pionier- oder FDJ-Gruppe auszuüben hatte; die Mitschüler hoben dann schnell die Hand, weil jeder froh war, diese Aufgabe nicht selbst übernehmen zu müssen. Im Studium ließ dann der Zwang, trotz zahlreicher Versuche subtiler oder direkter Einflussnahme, etwas nach. Umso fragwürdiger erscheint mir, dass Angela Merkel ihre Tätigkeit als Sekretärin für Agitation und Propaganda in der Akademie der Wissenschaften mit dem Begriff „Kulturfunktionärin“ verbrämt, noch dazu, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen konnte und daher weder um die Gunst linientreuer, Zensuren vergebender Dozenten buhlen noch ihre Loyalität anderweitig unter Beweis stellen musste.
Im Winter 1989 schloss sie sich dem Demokratischen Aufbruch an. Schon vor dem Gründungsparteitag war im DA ein heftiger Streit um die Wirtschafts-, Sozial- und Deutschlandpolitik entbrannt, in dem die Vertreter des linken Flügels von ihren Mitstreitern als „rote Faschisten“, „rote Säue“ und „Stasi-Spitzel“ beschimpft wurden. Gewinner des anhaltenden Richtungsstreits waren die konservativen Kräfte um Wolfgang Schnur. Im Februar 1990 stellte der DA sein Wirtschaftsprogramm vor, das eine umfassende Reform und die Einführung der D-Mark vorsah, und im gleichen Monat wurde Angela Merkel Pressesprecherin. Zur Volkskammerwahl trat der DA zusammen mit der DDR-Blockpartei CDU und der Deutschen Sozialen Union (DSU) unter dem Namen „Allianz für Deutschland“ an, initiiert von der West-CDU und ihrem Vorsitzenden Helmut Kohl. Überraschend ging die Block-CDU als Siegerin aus der Volkskammerwahl hervor, der DA kam gerade einmal auf 0,92 Prozent der Stimmen. Die vier DA-Vertreter in der Volkskammer schlossen sich bald darauf der CDU an. Bei dem Desaster dürfte nicht unerheblich gewesen sein, dass Schnur kurz zuvor als Stasi-Spitzel enttarnt worden war. Warum und durch wen die Stasi-Vergangenheit Schnurs ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ans Tageslicht kam – darüber kann nur spekuliert werden.
Auf jeden Fall dürfte der bodenlose Fall des DA-Vorsitzenden die Sympathie der Wähler für d...