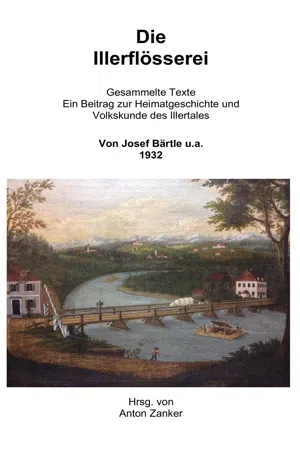![]()
Texte anderer Autoren zur Illerflösserei
An den Flüssen entstehen neue Gewerbe- und Industriebetriebe (Eisen- und Hammerwerke, Papierfabriken, Säge- und Mahlmühlen), die das Wasser für ihre Zwecke nutzen, während die Flösse durchfahren wollen. Zahlreiche Prozesse werden wegen „Wasserwegnahme“ geführt. Es wird offenbar, dass die Flösserei dem Industriezeitalter weichen muss.
M. Scheifele 82
Die Illerflösser83
Josef Knittel
Eines der ältesten Handwerke neben der Landwirtschaft ist die Flösserei, sie wurde im Raume Aitrach und Mooshausen schon seit einigen Jahrhunderten betrieben. Seit 1444 ist die Illerflösserei urkundlich nachweisbar. Im Jahre 1578 verkauft der Erbtruchsess Johann-Jakob von Waldburg-Waldsee-Marstetten seine Zollgerechtigkeit auf der Iller von Arlach bis Kellmünz und alles, was damit verbunden war, an die Reichsstadt Memmingen. Dass die Flösserei bestimmt älter ist, zeigt das untere Bild aus dem Jahre 1343.
Das Bild zeigt zwei Flösse auf der Iller zwischen Aitrach und Egelsee, links im Bild die Brücke in Ferthofen, rechts die Brücke von Egelsee, oben links die Burg Marstetten, daneben Mooshausen und rechts Tannheim. Am unteren Rand des Bildes ist Brunnen, Volkratshofen und Buxheim zu sehen rechts die Stadt Memmingen.
Die Reichsstadt Ulm hatte schon in den Jahren 1434 und 1471 eine Ordnung über den Bau- und Brennholzhandel von den Flössen aus und auf den Länden (das waren die Anlegestellen der Flösse in Ulm) herausgegeben. Dabei wurde auch erwähnt, dass im Jahre 1444 Steine aus dem Ellhofer Tobel von Lautrach an auf der Iller zum Münsterbau nach Ulm geflösst wurden.
Bild: Stadtmuseum Memmingen. Letzte Angaben dazu: Vermutlich ursprünglich v. Konrad Eben, Brunnen bei Volkratshofen. (Urheberquelle konnte nicht ermittelt werden) Diese Abbildung dürfte zu den ältesten gehören, die die Flösserei auf der Iller darstellt. Anm. d. Hrsg.
Die Memminger Geschichtsblätter berichten, dass die Iller und Donau in der Zeit der Türkenkriege als Transportwege für die kaiserlichen Truppen dienten, da der Landweg bis nach Wien die Leute zu sehr strapazierte. Im Jahre 1585 wurde angeordnet, die Anwerbung und Einkleidung möglichst nahe der Donau vor zunehmen, billige Knechte und genügend Flossleute, die den Wasserstrom befahren, seien besonders zu Marstetten, bei den Truchsessen zu Waldburg und bei Aitrach zu bekommen. Diese Transportflösserei von Menschen war meist nur eine Ausnahme, die übliche und gewerbsmäßige Flösserei basierte auf dem Wassertransport des Stamm-und Schnittholzes. Vom Aitracher und Mooshauser Gebiet verfrachtete man auch Scheiter, die die Bäcker und Bierbrauer in Ulm abkauften. Aber nicht nur die Ulmer waren Abnehmer des Holzes, sondern auch die Zimmer- und Bäckermeister, die Ziegelei- und Brauereibesitzer in der Gegend von Leipheim, Günzburg, Gundelfinden, Lauingen, Dillingen, Höchstädt und Donauwörth warteten noch in den Jahren 1870 und 1880 mit Sehnsucht auf die Ankunft der Holzlieferungen aus dem Allgäu.
Eine echte Flössergemeinde waren Mooshausen und Aitrach-Marstettten. Das zeigt auch die amtliche Aufstellung der Flösserfamilien zwischen den Jahren 1800 und 1900. Hier sind 41 Namen von Flössern, die in Aitrach oder Mooshausen lebten aufgeführt.
| Biedermann Johannes | Diem Josef Anton |
| Butscher Josef | Frommeld Ignaz |
| Butscher Konrad | Fischer Ignaz |
| Frommeld Josef | Gallasch Clemens |
| Frommeld Wendelin | Gallasch Franz-Josef |
| Gallasch Raimund | Gallasch Konstantin |
| Gallasch Andreas | Gallasch Ferdinand |
| Gallasch Martin | Holzmiller Josef |
| Hartmann Sebastian | Hartmann Sebastian |
| Bufler Johann Georg | Kramer Josef |
| Butscher Alois | Kramer Johannes |
| Bärtle Phillip | Kramer Andreas |
| Butscher Xaver | Lang Franz Josef |
| Notz Herrmann | Motz Josef |
| Motz Konrad | Oettel Michael |
| Schmid Andreas | Ulrich Cordian |
| Ulrich Sebastian | Ulrich Ignaz |
| Ulrich August | Ulrich Mathias |
| Wachter Franz Xaver | Wachter Conrad |
| Wachter Joh. Georg | Walter Ignaz |
| Zäh Wilhelm | |
Die meisten von ihnen hatten nebenbei eine kleine Landwirtschaft, um den Lebensunterhalt zu sichern. Während der Flösser seine harte Arbeit auf der Iller verrichtete, bemühte sich die Ehefrau mit ihren Kindern um die Landwirtschaft, damit sie die vielen Mäuler stopfen konnte. Es gab bestimmt noch viele ledige Flösserknechte, die hier nicht aufgeführt sind.
Die bekanntesten Flossherren waren Graf von der Fluhmühle bei Legau und der Holzhändler und Flossherr Phillip Bärtle aus Mooshausen. Pfarrer Josef Bärtle von Mooshausen, ein Sohn von Phillip Bärtle, Flossmeister, hat im Jahre 1933 ein Buch über die Illerflösserei geschrieben. Aus diesem Buche stammen die meisten Aufzeichnungen, die hier niedergeschrieben werden.
Die sogenannten Anmachplätze waren in Aitrach und Mooshausen der Schwal. Dort wurden die Langholzstämme ins Wasser geworfen und erst einmal gelagert, um dann später als ganze Ladung ihren Weg auf der Iller in Richtung Ulm oder weiter donauabwärts zu machen. Der Schwal [auch Schwohl] war ein riesiges Holzlager. Dort türmten sich die mächtigen Lager von Langholz, Brettern, Scheitern, Stangen und Latten auf.
Die Flösserei war nicht nur eine schwere körperliche Arbeit, sie stellte auch hohe Ansprüche an den Geist. Bei den extremen Wasserverhältnissen war oft eine schnelle Entschlusskraft erforderlich. In erster Linie wurde Langholz aus Aitrach illerabwärts befördert. 30-40 Stämme wurden zusammengebunden und mit 2 Rudern versehen. Kleine Flösse aus kurzen Stämmen konnten mit 500 Brettern oder mit 20 Raummeter Scheiter beladen werden und wurden von einem Mann gelenkt. Größere Flösse mit zwei tüchtigen Ruderern, konnten 800 Bretter oder 55 Raummeter Scheiter tragen. Ein kleines Floss, stellte einen Wert von 300-400 Mark, ein Grösseres einen solchen von 600-700 Mark dar. Eine Transportversicherung für solche Flösse gab es nicht. Die Flösser waren deshalb auf die Gunst des Schicksals, wie auf die Kraft ihrer Arme angewiesen. So mancher Flösser ist bei der Ausübung seines Berufes ertrunken.
Im Laufe von 50 Jahren sind 7 Flösser aus Aitrach bei der Ausübung ihres Berufes ertrunken:
Ludwig Sander, am 12. November 1837 in Dietenheim Matthias Ulrich, am 12 September 1852 bei Höchstädt a. D. Josef Frommeld, am 19. Juni 1866 bei Unterkirchberg Franz Josef Lang, am 29. Juli 1867 bei Unterkirchberg Konrad Butscher, am 17. August 1878 bei Altenstadt Max Ulrich, am 9. Juni 1875 bei Gundelfinden a. D. Franz Josef Holzmüller, am 1. April 1883 in der Aitrach in der Nähe von Mooshausen.
Die Flösser benützten verschiedene Reisetaschen und sog. „Geldkatzen“, so bezeichnete man die Ledergürtel, die eine meist wasserdichte Innentasche hatten und die die Flösser um ihren Leib schnallten, zur Aufbewahrung von Geld und sonstigen Habseligkeiten.
Die „Anmachplätze“ in Mooshausen und in Aitrach waren schon von Weitem zu erkennen. Hier herrschte ein reges Durcheinander. Dort stand meist das Altwasser der Iller ca. 80 cm hoch. Hier wurden die Langholzstämme, die von den umliegenden Wäldern herangefahren wurden, ins Wasser geworfen und mit Weiden und Birkennägeln miteinander verbunden. Das gab zunächst den Boden des Flosses. Die längeren Stämme mussten in die Mitte, die kürzeren an die Außenseite verbunden werden. Es war nicht immer ganz leicht, mit großen Griffbengeln die mächtigen Stämme übereinander zu heben. Mancher Stamm war buckelig und verwachsen und musste erst zugerichtet werden. In der Gegend von Aitrach und Mooshausen wurden meist Scheiter verladen. Aber oft wurden die Flösser aus Mooshausen und Aitrach, die als die besten und erfahrensten bekannt waren, angefordert um eine teure Fracht bis zum Hofe nach Wien zu bringen. Das waren damals, vor allem der Allgäuer Käse oder die als Delikatesse bekannten „Schnecken“, die in großen Salzfässern transportiert wurden.
Bei solchen langen Fahrten war dann der Rückweg oft sehr umständlich. Bei den Fahrten nach Ulm war es einfacher. Nach der Ankunft der Flösser mit ihrer Fracht in Ulm, die meist an der „Ziegellände“ anlegen mussten, wurde zuerst die Ladung gelöscht, erst nach getaner Arbeit ging es dann zum gemütlichen Teil über. Nach der schweren körperlichen Arbeit, welche sie bei Hitze und Kälte, bei Sturm und Regen zu verrichten hatten, war es verständlich, dass sie weder Verächter eines kräftigen Bissens noch eines guten Trunkes waren. Der Durst war bekanntlich bei den Flössern sehr groß. Aber dem wurde abgeholfen!
Die Flösserherbergen
Bekannte Flösserherbergen waren das „Rössle“ zu Ferthofen, der „Hirsch“ zu Mooshausen, das „Kreuz“ zu Egelsee, der „Engel“ zu Pless, die „Steige“ zu Kellmünz, das „Kreuz“ zu Dietenheim, der „Mohren“ zu Brandenburg und der „Hirsch“ zu Oberkirchberg, wo die Wirtin Lauterwein Flösserspätzle von einer Qualität zu bereiten wusste, dass sie einen Tag lang hielten. Weitere Flösserherbergen gab es in Ulm: die „Krone“, der „Storchen“, der „Bock“, der „Hohentwiel“, die „Eisenbahn“, zu Neu-Ulm die „Löwenbrauerei“ und das „Schiff“, wo heute noch an der Decke ein Illerfloss zu sehen ist.
Ein besonders reges Leben spielte sich naturgemäss in den Ulmer Flösserherbergen ab, worüber lange berichtet wurde. Die alten Flossherren taten sich besonders hervor, in dem sie mit ihrem Reichtum protzten. Man sah sie mit Ringen an den Fingern und einem großen Siegelring im schwarzseidenen Halstuch durch die Straßen ziehen, um sich mit anderen Flossherren zu treffen und in einem „besseren Lokal“ schon des Morgens ein Glas Wein zu schlürfen.
Die „normalen Flösser“ begaben sich am Abend nach getaner Arbeit in ihre Herberge, wo sie sich die langen nassen Stiefel auszogen und es sich nach reichlichem Mahle gemütlich machten und ihr Pfeifchen anzündeten. Bei gutem Bier und Wein tauten sie langsam auf und wurden gesprächig. Obwohl sie nicht gerne von ihren Arbeiten und Erlebnissen erzählten, so hörte man doch manchmal an ihren Tischen manchen Schwank oder manche Erzählung. Ob die Erzählungen nun wahr waren oder erfunden, das wusste man nicht so genau, wichtig war, dass si...