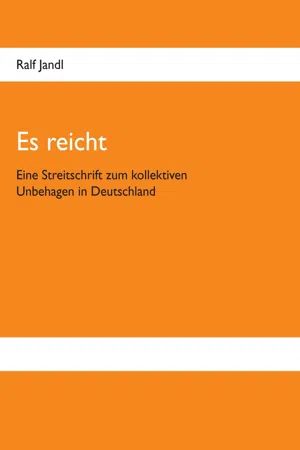![]()
Wissenschaft und Kunst als Chance
In der Wissenschaft ist zur Zeit noch eine Dominanz der USA festzustellen, die aber auch hier von Importen aus anderen Ländern lebt. Noch immer kann die USA als führende Wirtschafts- und Militärmacht angesehen werden, wobei die NSA einen großen Teil der technischen und materiellen Kompetenz im Bereich der Elektronik absorbiert haben dürfte. Je mehr man über das Reich der NSA erfährt, desto mehr kann man nur den Kopf schütteln und bezweifeln, ob sich dieser Aufwand an Geld und Geist je lohnen wird, von der Frage ganz abgesehen, wie man es rechtfertigen will Freund und Feind gleichermaßen auszuspionieren, was die früheren Außenminister Albright und Fischer aber für selbstverständlich halten.
Während die USA schon lange Wissenschaftler aus der ganzen nichtsozialistischen Welt anzuwerben gezwungen ist, hat China noch bei weitem nicht sein eigenes Potential an Köpfen erschlossen. In den nächsten 20 bis 30 Jahren wird China an den USA vorbeiziehen, auch wenn die USA von Europa unterstützt wird. Geht man von den Nobelpreisen als Kriterium für den Stand der Forschung aus bleiben die Amerikaner noch auf vielen Feldern unter sich. Das wird nicht immer so bleiben. Seltsam ist manchmal die Auswahl von amerikanischen Ökonomen, die für Leistungen in der Bewertung von Aktien prämiert werden und sich nur wenige Monate danach als Hedgefond Manager erweisen, deren Fonds mit Riesenaufwand vor dem völligen Absturz bewahrt werden müssen.
In den Naturwissenschaften wird das entscheidende Problem der nächsten Jahrzehnte sein, wie man einerseits die Klimaerwärmung in Schach hält und andererseits ausreichend für Energie sorgt.
Für die Sozialwissenschaften, speziell die Soziologie, wird es entscheidend werden darzustellen, welche gesellschaftlichen Modelle zukunftsfähig sind und welche zum Scheitern führen müssen. Hier ist der Westen mit dem Kapitalismus nicht gut aufgestellt.
Interessant ist, was im gesellschaftlichen Prozess über die ästhetische Wirkung hinaus, durch die Kunst bewegt werden kann.
Zwischen Wissenschaft und Kunst stehen die Museen, die heute in der Präsentation und der Pädagogik mit Museen noch der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht zu vergleichen sind. Sie stellen heute Lernorte dar, deren Möglichkeiten leider nicht ausreichend genutzt zu werden scheinen.
Insgesamt ist es heute ohne Risiko, die Religion zu kritisieren, da die Säkularisierung fast alle Tabus beseitigt hat und kein Scheiterhaufen mehr wartet. Die Pussy Riots im Kölner Dom wären auch bei uns noch eine Meldung, aber nur für einen Tag. Die Fülle an Nachrichten sorgt dafür, dass jeden Tag für einen neuen Skandal gesorgt ist. Es wirkt daher treuherzig, wenn die“ Ostseezeitung“ mit dem Slogan wirbt „Jeden Tag mit neuem Inhalt“.
Im Gegensatz zur Kritik an der Religion ist Kritik am Kunstbetrieb und der Kunst selbst ein nahezu tollkühnes Unternehmen, da man auf eine geschlossene Abwehrfront von Nutznießern trifft, deren Argumente freilich bei Licht besehen oft an des Kaisers neue Kleider erinnern.
Sehr skeptisch bezüglich der Wirkung der Kunstförderung war das Buch „Der Kulturinfarkt“, das vorsorglich gleich von vier Experten aus Deutschland und der Schweiz geschrieben wurde. Es versuchte, Fehlentwicklungen aufzuzeigen und konstatierte „Von allem zu viel und überall das Gleiche“. Das Buch wurde leider kein Bestseller und prallte am Selbstbehauptungswillen des Kulturapparates ab. Eine These wie „Zuviel Geld für Kultur schadet nur“ wird in der Kunstszene nie viel Anhänger finden, und Kritik am Mythos vom Kulturstaat wird von Politikern als Axt am Tempel des Wahren, Schönen, Guten empfunden werden. So werden die Subventionskultur und ihre Auswüchse weitergehen. Das Unbehagen in der Kultur, von dem schon Freud sprach, wird hier in ganz anderer Form deutlich. Unsere Kultur und Kunst ist nicht einmal in der Lage, bzw. wagt es nicht mehr, sich selbst zu deuten und zu analysieren, und ist daher schon deshalb unfähig, den Menschen vom generellen Unbehagen in der Kultur, das Freud meinte, zu befreien.
In dem zitierten Buch wird das so populäre Programm „Kultur für alle“ als Höhepunkt der bürgerlichen Bildungsutopie entlarvt, die tief in der deutschen Klassik wurzelt und sich die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts vorgenommen hatte. Ein Ideal aus der Zeit der aufgeklärten Aristokratie, das also vordemokratisch ist. Der mündige Bürger in der Demokratie lässt sich von der Kulturpolitik nicht vorschreiben, wie er sein Leben zu gestalten hat. Er lässt sich im Grunde gar nichts vorschreiben, das er nicht selbst bejaht. Die Autoren bemängeln zu Recht, dass es in der Politik überall um Zukunftsgestaltung geht, nur in der Kultur geht’s um Vergangenheit, um Strukturerhaltung und moralische Selbstverteidigung.
Die Verfasser weisen darauf hin, dass Europa die teuerste Kulturlandschaft der Welt darstellt, aber in der Wirkung über Europa kaum hinauskommt. Als Kernübel wird die Staatsnähe angesehen.
Adorno hat zwar recht, wenn er sagt „Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung“, aber darum geht es hier nicht. Es geht um die durchgängige Affinität zwischen Kunst und Staat, nicht nur als finanziellem Förderer. Schon 1937 sprach Herbert Marcuse vom affirmativen Charakter der Kultur. Die Kunst beißt nicht die Hand, die sie füttert. Man vergleiche das Wirken der zahmen geförderten Bühnen und das „Off Theater“.
Wo soll denn die zukunftsweisende Funktion der Theater herkommen, wenn man sich mit einem Partner verbündet, der an Veränderungen nicht interessiert , ja dagegen ist?
Interessant zu beobachten war, wie in den neunziger Jahren bei formaler Beibehaltung aller Maximen von der Freiheit der Kunst, ohne scheinbaren Grund Museen und andere Einrichtungen im Kulturbereich als Stiftungen firmieren mussten, die nicht zu Erträgen führten, sondern jährlich mühsam aus dem Haushalt aufzufüllen waren. Der Grund war, dass sich dadurch in den Beiräten, Kuratorien usw. der Staat einmischen konnte, was er auch kräftig tat. Koscher war das nicht, aber verbreitet.
Schon der lateinische Dichter Horaz forderte, die Kunst möge den Menschen erfreuen oder bilden. Am Gewandhaus in Leipzig, einer Pflegestätte klassischer Musik auf höchstem Niveau, heißt es über dem Eingang „res severa verum gaudium“ - die ernsthaften Dinge sind die wahre Freude, woran bei uns selbst viele Politiker in den Parlamenten scheitern würden, wurde doch selbst in der Stuttgarter Staatskanzlei schon die Devise „locker vom Hocker“ ausgegeben.
Zur bildenden Kunst
Hegel hoffte zwar, dass die (bildende) Kunst sich weiterentwickeln und vollenden möge, stellte aber zugleich realistisch fest, ihre Form habe aufgehört, „das höchste Bewusstsein des Geistes zu sein, weshalb wir die Knie nicht mehr beugen würden“.
Auch eine Bemerkung wie die Rilkes beim Anblick eines apollinischen Torsos „ Du musst Dein Leben ändern“ wäre heute nicht mehr möglich.
Viel schärfer charakterisiert der peruanische Literaturnobelpreisträger Gabriel Marcel Llosa die Situation der bildenden Kunst in seinem Buch „Alles Boulevard“ und spricht von einem „Kunterbunten Amüsierbetrieb“ und warnt: „Wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst.“ Vielleicht hat der CIA als Lenker der Kunstströmungen im Kalten Krieg doch nicht immer das richtige Gespür gehabt. Immerhin ist sein Wirken unbemerkt geblieben und hat wohl selbst noch nach der Wiedervereinigung dazu geführt, dass die Ostmaler bei Ausstellungen gern im Keller, die Westmaler in der Beletage gezeigt werden.
Llosa wird man entgegenhalten, dass er ein alter Herr ist, und die ältere Generation nie mit den gewandelten Auffassungen der Jungen zurechtkommt, was sicher zum Teil stimmt, aber seine Kritik nicht entwertet.
Schade ist, dass viele Maler und Bildhauer ,die nach wie vor nach den Regeln der Kunst arbeiten , unter der Scharlatanerie der Großfürsten ihrer Zunft leiden müssen ,neigt der Bürger doch oft dazu ,alles in einen Topf zu werfen.
Es ist leider so, ob Kunst, ob Politik, wer in der Demokratie nicht aufs Blech haut wird, offensichtlich nicht gehört. Ausnahmen wie Gerhard Richter oder die Leipziger Schule bestätigen die Regel.
Zur Literatur
Was bleibt, ist Literatur, Theater und Musik. Die Literatur bei uns ist quantitativ überzeugend mit rund 80 bis 90 Tausend Neuerscheinungen im Jahr. Davon wohl weit über einhundert Romane, die von der Werbung als „Buch des Jahres“ angepriesen werden.
Dazu muss man wissen, dass im Iran, dem man hierzulande allenfalls den Koran in Neuauflage zutraut, immerhin etwa die Hälfte der Zahl unserer Neuerscheinungen auf den Markt kommt. Dort kandidierten auch vor einiger Zeit zwei Philosophen und ausgewiesene Kant Spezialisten um das Präsidentenamt. Hört, hört!
Die Betrachtung von Kunst als Sachwert kennt man vor allem von der bildenden Kunst als „Wandaktien“. Überraschend aber wahr ist, dass auch Literatur als Sachwert Spitzenpreise im literarischen Reliquienhandel erreichen kann. Der Leser vermutet richtig, es geht um Kafka. Taucht eine Handschrift von Kafka auf, die wissenschaftlich längst ausgewertet und im Grunde ohne Belang ist, kommt in Marbach und anderswo die reine Habgier zum Ausbruch: das müssen wir haben! Wohlgemerkt haben! Mancher erinnert sich an Erich Fromms „Haben oder Sein“, und wenn es schon kein lebendiges literarisches Leben im Lande mehr gibt, weil alle satt und zufrieden sind, und es keinen einzigen Dramatiker mehr im Lande Schillers gibt, dann will man den Kafka wenigstens im Keller im Safe haben. Böse Menschen nennen solche Leute anale Charaktere, um wieder an Freud anzuknüpfen.
Kafka selbst hätte es verdient , trotz unzähliger Deutungen durch Germanisten muss er ein ganz lieber Mensch gewesen sein. So heißt es auch, sein Lieblingslied sei das Silcher Lied „Lebe wohl du kleine Gasse ,lebe wohl du stilles Dach“ gewesen. Ob dies in Marbach überhaupt jemand weiß?
Der Staat hat zum Glück für solche Reliquienkäufe kein Geld, aber das braucht er auch nicht, da fließen Millionen von Sponsorengeldern, ohne dass man lange betteln muss..
Ein anderer Heiliger des Literaturbetriebes, zumindest in Baden- Württemberg, ist Ernst Jünger, den man realistisch am besten als Dandy des Schlachtfeldes bezeichnet.
Schillerpreisträger und vom Land mit einer Ernst Jünger Stiftung zur Vergabe eines Ernst Jünger Preises für Entomologie (wegen seines Hobbies) geehrt. Ein Preis für Käferkunde ist eine ungewöhnliche Ehrung für einen Literaten als Namensgeber aber vielleicht doch auch wieder passend. Man dürfte, wenn man Jünger als nekrophil bezeichnet, nicht ganz daneben liegen.
In einer marktkonformen Demokratie kann man es den Künstlern nicht verdenken, sich auch marktkonform zu verhalten, was am besten durch Spektakel geschieht. Es begann mit dem Urinal von Marcel Duchamps, der ein hundsgewöhnliches Pissbecken zum Kunstwerk, man muss sagen, „ernannte“. Eine Putzfrau würde sagen: richtig zielen ist eine Kunst, aber das Urinal selbst? So geht die Volksmeinung und die der Künstler und Intellektuellen oft auseinander.
Schon längst sind die Unterschiede zwischen marketing, offener Lüge und Wahrheit in der Kunst fast nicht unterscheidbar geworden. Das gilt für Beuys, der seine Biographie veredelte, was aber tendenziell ja auch jeder Politiker, ja fast jeder, der in der Öffentlichkeit steht, heute tut. Niemand kann verlangen, dass man an die Kunst noch so herantritt wie Wackenroder und Tieck in ihren „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“.
Am war immer wieder Günter Grass, der selbst Papst Ratzinger versucht , in seine vita einzuspannen und sich daran zu erinnern glaubte, dass er mit ihm in einem Gefangenenlager unter der gleichen Zeltplane dem Regen getrotzt habe. Seine Bedeutung als Politikberater von Willy Brandt wird sehr unterschiedlich gesehen. Brandt selbst soll auf die Ankündigung, Grass sei im Anmarsch, mit den Worten reagiert haben: „Was will denn dieses Ar………schon wieder?“
Der Vorwurf gegen Grass, er habe sich an seine Zeit als SS Panzerschütze erst sehr spät erinnert, ist vielleicht sogar unfair, verdrängt der Mensch das Peinliche doch am stärksten.
Martin Walser hingegen dürfte von der Gnade der späten Geburt profitiert haben, war er doch nur 6 Tage Gebirgsjäger bei der Wehrmacht. Zeit zum Blumenpflücken auf der Alm und Warten auf die Kapitulation. Je älter er wurde, desto eigentümlicher wurde er aber, was ja nicht nur bei großen Dichtern so ist. Bei einem Gespräch in Berlin erklärte er vor zum Entsetzen mancher Zuhörer: „Das Gesicht von Angela Merkel ist schön.“ Wie jeder weiß, liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. Auch Linsentrübungen sind im Alter immer möglich. Bei Politikerinnen sollte man aber immer hinter das „schöne Gschau“ sehen, das bei Frau Merkel ja allenfalls auch sehr zurückhaltend eingesetzt wird.
Es zeigt sich auch hier, dass die von Walser im Einklang mit der Gegenwartsphilosophie immer wieder gemachte Feststellung, zu jeder Aussage sei auch das Gegenteil richtig, viel für sich hat. Wobei sich für Nichtphilosophen die Frage ergibt, ob man überhaupt noch etwas sagen sollte. Der Philosoph Wittgenstein empfahl, der Einfachheit halber über Dinge, über die man nicht reden könne, einfach zu schweigen.
Bemerkenswerterweise scheinen die Literaten in Deutschland recht zufrieden zu sein. Burkhard Spinnen, einer ihrer Protagonisten, meinte, ihre Lage sei befriedet, und auf große ästhetische oder politische Debatten könne man gut verzichten. Man könne sagen, die Literatur in Deutschland habe ihren Platz in der pluralen postideologischen Gesellschaft gefunden.
Skeptiker meinen davon abweichend, sie haben ihren Platz höchstens in der politisch korrekten Gesellschaft gefunden, in der gesellschaftspolitische Probleme als störend empfunden und nicht mehr wahrgenommen bzw. dargestellt werden. Selbst in unserer absterbenden Kultur läuft der Betrieb mit staatlichen Subventionen „wie geschmiert“. Lesungen, Preise, Talkshows, Diskussionen, Gespräche, ein unendliches Geschwätz, wie gehabt und ohne Ergebnis. Der Untergang des Abendlandes wurde schon vor einhundert Jahren von Oswald Spengler proklamiert. Allmählich müssten sich Zeichen für eine neue Morgenröte zeigen. Vielleicht im Morgenland, und unsere Autoren sollten zumindest heraus aus der warmen, politisch korrekten Ecke. Wer nicht sucht, findet auch nicht. Im Zuge der Digitalisierung unserer Welt dürfte aber auch der Literatur noch einiges bevorstehen. Ein kleiner Vorgeschmack: Amazon veröffentlicht auf E-books die Markierungen der Leser im Text. Bei Sloterdijks Großessay „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“ gibt es Markierungen nur bis S.→ bei einem Gesamtumfang von 489 Seiten. Schon wird die fiese Frage gestellt, warum soll etwas produziert werden, das nicht konsumiert wird. Die Autoren von „Von allem zu viel und überall das Gleiche“ werden sich bestätigt sehen. Eine revolutionäre Vision könnte sich aber ergeben, wenn eine große berechnete Erzählung entsteht, die sich nicht aus der Kreativität von Autoren speist, sondern aus der Nachfrage von Konsumenten. Zum Beispiel: alle fünf Seiten einen Ehebruch, alle zehn eine Scheidung , Mordversuch oä. Eine grauenhafte Vorstellung , aber machbar.
Zum Theater
Noch viel unbefriedigender als die Situation der Bildenden Kunst und Literatur ist die des Theaters. An Selbstlob fehlt es nicht. Kritiker aber sprechen von Selbstaufgabe des Theaters und vom Stadttheater als Handlanger des Kapitalismus, da dieses es nicht mehr wage beziehungsweise fertig bringe, auf die Probleme der Zeit eine Antwort zu finden und diese darzustellen. Stattdessen immer noch „Gschichten aus dem Wienerwald“, wo doch jeder die Problematik kennt und weiß, dass sie überholt ist, und immer noch Faust I mit seinen bildungsbürgerlichen Problemen, obwohl die Frankfurter Ausstellung „Goethe und das Geld“ eindrucksvoll vermittelte, dass Goethe unsere Finanzsituation schon vor zweihundert Jahren klar voraussagte, nämlich eine Zeit, in der man Schulden aufnehmen muss, um Schulden zurückzuzahlen. Nirgendwo kommt die Kapitalismuskritik schärfer zum Ausdruck als in Faust II. “It‘s Goethes Faust II, stupid“.! Traumhaft wäre eine Premiere von Faust II , die ähnlich verläuft wie die Premiere von Schillers Räubern, die das Publikum so mitris...