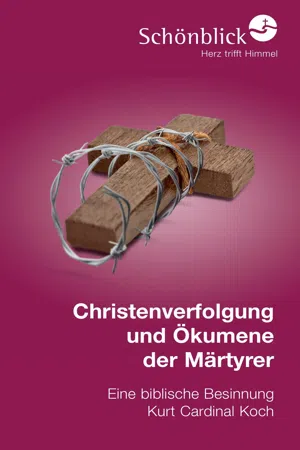
eBook - ePub
Christenverfolgung und Ökumene der Märtyrer
Eine biblische Besinnung
- 60 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Kurt Cardinal Koch verbindet in seiner Besinnung zu Christenverfolgung und Ökumene der Märtyrer das biblische Zeugnis mit der Leidenserfahrung von Christen. Eine Erfahrung, die so alt ist wie die Kirche und sich heute mit stärkerer Vehemenz zuspitzt als jemals zuvor. Christen auf nahezu allen Kontinenten sind davon betroffen. Doch die Erfahrung des Martyriums dient der Verherrlichung Gottes. Sie vermittelt eine Christusnähe, Zeugniskraft und geistliche Einheit, die Kirchengrenzen überschreitet. Eine beachtenswerte ökumenische Dimension!
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Christenverfolgung und Ökumene der Märtyrer von Kurt Koch, Edition Schönblick im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Teologia e religione & Cristianesimo. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
„Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.“ In dieser Weisheit im Ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth (12, 26) kann man die Grunderfahrung jener Glaubens– gemeinschaft sehen, die sich Kirche nennt. Denn niemand kann allein Christ sein, wie bereits der frühchristliche Kirchenschriftsteller Tertullian formuliert hat: „Ein Christ ist kein Christ.“ Christ sein kann man vielmehr nur in der Gemeinschaft der Kirche. Denn Christen sind Glieder eines Leibes. Wenn am Leib ein Organ schmerzt, dann betrifft dies nicht nur dieses Organ, sondern berührt den ganzen Leib. Im Zeitalter der Ökumene weitet sich der Horizont dabei auf alle Christen. Wir haben den grösseren Leib Christi entdeckt. Und wir nehmen ihn als verwundeten Leib wahr, zumal in der heutigen Zeit, in der so viele Christen dem Leiden und der Verfolgung ausgesetzt sind. Die Christenverfolgungen heute berühren die ganze Ökumene und stellen uns vor die Frage, was sie für uns Christen in der heutigen Zeit bedeuten.
1. CHRISTENVERFOLGUNGEN IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART
Wenn wir heute von Christenverfolgung und Martyrium reden hören, handelt es sich dabei einfach um historische Erinnerungen, die unser gegenwärtiges Leben kaum mehr existenziell berühren? Im durchschnittlichen Bewusstsein der Menschen und selbst der Christen heute sind Christenverfolgung und Martyrium Themen der Vergangenheit, die vor allem in der historischen Abteilung des Wissens verortet sind. Man pflegt mit diesen Themen vor allem Erinnerungen an Vergangenes zu verbinden. Man denkt an die Steinigung des Stephanus, über die uns die Apostelgeschichte berichtet. Man erinnert sich an die verschiedenen Verfolgungswalzen, deren sich in der frühen christlichen Zeit die römischen Kaiser bedient haben, um die „Atheisten“, wie die Christen damals bezeichnet worden sind, aus der Gesellschaft zu eliminieren. Man erinnert sich auch, dass die Geschichte der christlichen Mission vor allem in Japan und China, in Korea und Uganda weitgehend eine Märtyrer-Geschichte gewesen ist. Es ist gewiss im Bewusstsein auch des 20. Jahrhunderts präsent, dass unter den Terror– regimes des Nationalsozialismus und des Sowjetkommunismus eine unvorstellbare Zahl von Christen und Christinnen um ihres Glaubens willen verfolgt und hingerichtet worden sind und dass am Beginn des vergangenen Jahrhunderts mit dem Armenier-Genozid die erste grosse Christenverfolgung in der Neuzeit stattgefunden hat. Von daher drängt sich das Urteil auf, dass es in keinem Jahrhundert so viele christliche Märtyrer wie im 20. Jahrhundert gegeben hat.
Als jedoch das sowjetische Terrorregime zusam– mengebrochen, die Berliner Mauer zu Fall gekommen und der Eiserne Vorhang aufgehoben worden ist, sind nicht wenige Menschen der Meinung gewesen, es gebe jetzt keine Christen– verfolgungen mehr, es sei vor allem die Zeit der universalen Anerkennung der Menschenrechte und vor allem der Religionsfreiheit als des fundamentalsten Menschenrechts angebrochen.
Dabei handelt es sich um eine völlig naive Fehleinschätzung der heutigen Situation, die spätestens von den Berichten über die Gräuel– taten der satanischen Terrororganisation „Islami– scher Staat“ im Nahen Osten korrigiert werden musste.
Diese Erscheinungen haben zugleich bewusst gemacht, dass am Ende des zweiten und am Beginn des dritten Jahrtausends die Christenheit erneut zur Märtyrerkirche geworden ist. Heute müssen wir eine neue Generation von Märtyrern wahrnehmen, die ein solches Ausmass ange– nommen hat, dass man nicht um das Urteil herumkommt, dass es heute mehr christliche Märtyrer gibt als während den Christen– verfolgungen in den ersten Jahrhunderten. Achtzig Prozent aller Menschen, die heute wegen ihres Glaubens verfolgt werden und unter Diskriminierungen, schwerwiegenden Benach– teiligungen und zum Teil heftigen Anfeindungen leiden müssen, sind Christen und Christinnen.
Der christliche Glaube ist in der heutigen Welt die am meisten verfolgte Religion. Man muss insgesamt davon ausgehen, dass heute in 25 Ländern Christen und Christinnen wegen ihres Glaubens von Misshandlungen, Gefängnis und Tod bedroht sind. Und man darf es nicht verschweigen, dass heute grausame Christen– verfolgungen auch und vor allem im Nahen Osten stattfinden.
Dass von dieser erschreckenden Realität in den Medien kaum die Rede ist, muss man als Skandal bezeichnen und nach den Gründen für dieses seltsame Phänomen fragen. Eine sehr harte Antwort, die aber zu denken geben muss, hat vor einigen Jahren der Journalist Jan Ross von der Wochenzeitung „Zeit“ gegeben, wenn er geurteilt hat, das Christentum sei „die meistverfolgte Religion auf der Welt, wofür sich freilich bei uns kaum einer interessiert, weil es dem abend– ländischen Selbsthassklische widerspricht“. Es ist unübersehbar, dass in unseren weithin säkulari– sierten Gesellschaften Europas manchmal eine feindselige Haltung gegen das Christentum vor allem in bestimmten Medien mit Händen zu greifen ist. In der veröffentlichten Meinung wird nicht selten die Behauptung vertreten, das Christentum sei an beinahe allen Übeln der Menschheit schuld: der Überbevölkerung, der AIDS-Epidemie, kriegerischen Auseinander– setzungen und sogenanntem fundamentalis– tischen Verhalten. Wir Christen werden immer häufiger als Fremdkörper oder gar Störenfriede in einer neuheidnischen Gesellschaft empfunden, wenn wir deren Konsense nicht mittragen, sondern als Christen und Christinnen vieles nicht zu tun bereit sind, was „man“ in der heutigen Gesellschaft tut.
Um einen noch grösseren Skandal handelt es sich, wenn gegen die Christenverfolgungen in der heutigen Zeit nicht einmal Christen ihre Stimme erheben, sondern offensichtlich die starke Tendenz in sich verspüren, angesichts der eigenen Schuldgeschichte des Christentums und von christlich geprägten Staaten und angesichts von Intoleranz und Unterdrückung, derer sich Christen im Laufe der Geschichte schuldig gemacht haben, lieber zu schweigen. Natürlich haben wir Christen allen Grund, an die eigene Brust zu klopfen und das mea et nostra culpa öffentlich auszusprechen, auch und gerade im Blick auf die grausamen Konfessionskriege im 16. und 17. Jahrhundert, vor allem den Dreißig– jährigen Krieg, der Europa in ein Meer von Blut verwandelt hat. Solche Erinnerungen dürfen uns jedoch nicht daran hindern, auch gegen das Unrecht, das heute unsern christlichen Schwes– tern und Brüdern in vielen Regionen der Welt angetan wird, unsere Stimme zu erheben.
Die erschütternde Bilanz der Christenverfol– gungen in der heutigen Welt stellt eine grosse Herausforderung zu leidempfindlicher Solidarität mit den verfolgten Christen und Christinnen und zu öffentlicher Denunzierung von Märtyrersitua– tionen dar. Aber findet diese Solidarität wirklich statt? Oder werden die Schmerzensschreie der heutigen Christen genauso überhört wie in seiner Zeit die Schreie des Propheten Jesaja, der seinen Schmerz mit den bitteren Worten zum Ausdruck gebracht hat: „Der Gerechte kommt um, doch niemand nimmt es sich zu Herzen. Die Frommen werden dahingerafft, aber es kümmert sich niemand darum“ (Jes 57,1).
Diese kritische Frage richtet sich nicht nur an die einzelnen Christen, sondern auch an die europäischen Politiker. Es ist gewiss ein schönes Zeichen gewesen, als nach den schrecklichen Attentaten in Paris auf Charlie Hebdo und einen Supermarkt mit koscheren Waren im Januar 2015 Regierungspräsidenten aus ganz Europa in die französische Metropole gereist sind, um mit Frankreich ihre Solidarität zu bekunden. Auf der anderen Seite aber musste ich mir damals sagen, dass das, was in Paris geschehen ist, im Nahen Osten jeden Tag geschieht, und ich habe mich gefragt, wo jetzt die europäischen Politiker sind.
Natürlich stehen wir nach den Wahnsinnstaten im November 2015 in Paris wieder an der Seite Frankreichs. Aber der Nahe Osten mit seiner brutalen Verfolgung durch den Islamischen Staat ist nun in grausamer Weise in Europa ange– kommen; und es ist zu hoffen, dass das grauenhafte Geschehen dort auch im Westen näher in den Blick rückt. Denn im Allgemeinen muss man leider den Eindruck haben, dass der Nahe Osten auf der internationalen Ebene weithin ignoriert wird und dass sich auch der Westen gegenüber dem Leiden der Christen weithin gleichgültig verhält. Aus dieser Fest– stellung ergeben sich bedrängende Fragen: Wie lange will die europäische Politik noch zusehen, wie in Syrien und Irak uralte Kulturgüter dem Erdboden gleichgemacht werden, wie Menschen - Christen und andere religiöse Minderheiten wie die Jesiden - wie Schlachtvieh hingerichtet werden, und wie viele Menschen in die Flucht getrieben werden? Das Flüchtlingsproblem, das heute so gross ist, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gewesen ist, kann nur bewältigt werden, wenn die Situation in jenen Ländern geändert wird, aus denen die Flüchtlinge kommen.
2. CHRISTLICHES MARTYRIUM ALS ESSENZ DES CHRISTENTUMS
Diese erbärmliche Situation bewusst zu machen, ist eine besondere Verantwortung der christlichen Kirchen. Dazu gehört auch, dass sie in Erinnerung rufen, dass es kein martyriumsfreies Christentum gibt. Man muss realistischerweise vielmehr davon ausgehen, dass die Nachfolge Jesu immer auch das Martyrium einschliessen kann.
Die christlichen Kirchen können das Martyrium von Christen auch heute im Licht des Glaubens nur verstehen, wenn sie darum wissen, dass es wesenhaft zum Christentum gehört, „sozusagen ein Wesensmerkmal des Christentums“ ist. Diese realistische Annahme hat sich im Laufe der Kirchengeschichte tausendfach bewahrheitet und bestätigt sich auch in der heutigen Welt und bedarf gerade heute einer theologischen Vertiefung.
Ein besonders eindrückliches Beispiel, an dem dies abgelesen werden kann, ist das Martyrium des Heiligen Polykarp von Smyrna. Er gehört in die Zeit der Apostelschüler und wirkte in Kleinasien, wo die ersten christlichen Gemeinden noch in der Zeit der Apostel gegründet worden sind. In diesem Gebiet wurden die Christen bereits früh verfolgt, wie die Worte zeigen, die der Seher Johannes an die Gemeinde von Smyrna schreibt: „Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst! Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben“ (Apk 2, 10). Allen in der Gemeinde von Smyrna voran hat ihr Bischof Polykarp Anteil an Jesu Kelch des Leidens und des Todes erhalten. Über seinen Märtyrertod berichten die ältesten christ– lichen Märtyrerakten. Das Auffälligste und das zweifellos Tiefsinnigste dabei ist, dass der Bericht über sein Martyrium als Liturgie geschildert und wie ein eucharistisches Hochgebet gestaltet ist.
Zunächst wird berichtet, wie Bischof Polykarp gefesselt wird und wie ihm die Hände auf den Rücken gebunden werden. Damit erscheint er, wie es in den Märtyrerakten heisst, „wie ein edler Widder, der aus der grossen Herde zu Gott geführt wird, eine Gott wohlgefällige, für ihn bereitete Opfergabe“. Nach dieser Vorbereitung des Martyriums, die wie eine Gabenbereitung beschrieben wird, spricht Polykarp, auf den Holzstoss gelegt und dort angebunden, eine Art eucharistisches Hochgebet. Er dankt für die Erkenntnis Gottes, die ihm durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus zuteil geworden ist. Er preist Gott, weil er gewürdigt worden ist, Anteil am Kelch Jesu Christi auf die Auferstehung hin zu erlangen. Schliesslich bittet er mit Worten aus dem alttestamentlichen Buch Daniel, die offensichtlich schon früh in die christliche Liturgie aufgenommen worden sind: „heute vor dir als wohlgefälliges und fettes Opfer angenommen zu sein“. Dieses Hochgebet endet – wie dies auch in den eucharistischen Hochgebeten geschieht - mit einer grossen Doxologie. Nachdem Polykarp das „Amen“ gesprochen hat, entzünden die Knechte den Holzstoß. Anschliessend wird eigens erwähnt, dass sein verbrannter Leib nicht wie verbranntes Fleisch erscheint, sondern wie gebackenes Brot, und dass die Anwesenden einen süssen Duft spüren „wie von Weihrauch oder von kostbaren Aromen“. Wenn man bedenkt, dass beide Bilder - Brotwerdung und Wohlgeruch - zusammen– gehören und der alt- und neutestamentlichen Opfertheologie entstammen, wird nochmals der liturgisch-eucharistische Charakter des Gesche– hens verdeutlicht.
Der Bericht über das Martyrium des Polykarp als eucharistische Liturgie sei deshalb so eingehend erwähnt, weil er in die Mitte des christlichen Martyriums hineinführt. Er zeigt, dass Bischof Polykarp durch sein Martyrium wie Christus geworden ist und dass sein Leben Hin-Gabe und eucharistische Gabe geworden ist: Wie von Christus gerade nicht das Gift der Zersetzung des Lebendigen durch die Macht des Todes gekommen ist, sondern von ihm die Kraft des Lebens ausgegangen ist und er wie gutes Brot uns Leben gegeben hat, so besiegt auch die persönliche Hineingabe des Glaubenszeugen Polykarp in den Leib Christi durch das Marty– rium die Macht des Todes. Denn indem der Märtyrer lebt und gerade durch sein Sterben Leben schenkt, ist er selbst in das eucharistische Geheimnis eingegangen. Hier liegt der tiefste Grund, dass die Märtyrerakten das Martyrium des Heiligen Polykarp als „Eucharistiewerdung des Märtyrers“ beschreiben, „der in die volle Gemeinschaft mit dem Passah Jesu Christi eintritt und so mit ihm Eucharistie wird“.
Solche existenzielle Eucharistiewerdung von glaubwürdigen Christen ist in der Geschichte der Kirche vielfach bezeugt. Das zweifellos populärste Beispiel ist die Geschichte vom Heiligen Laurentius auf dem Rost, in der man bereits früh das Urbild der christlichen Existenz erblickt hat, und zwar dahingehend, dass die Bedrängnisse des Lebens zu jenem reinigenden Feuer werden können, das uns selbst allmählich so umformt, dass unser ganzes Leben Gabe für Gott und für die Menschen wird. In der jüngeren Vergan– genheit sticht das Martyrium des Heiligen Maximilian Kolbe in die Augen, der unter Lobgesängen stirbt, der für einen anderen Menschen das Leben gibt und bei dem sich die radikale Hingabe gerade dadurch vollendet, dass sein ganzes Leben aufgelöst wird. Diese Beispiele zeigen, dass christliches Martyrium nicht nur Leben aus dem Mysterium der Eucharistie bedeutet, sondern auch und vor allem existen– zielles Hineingenommenwerden in dieses Myste– rium selbst.
3. TEILHABE AM PASSAHGEHEIMNIS IN DER NACHFOLGE JESU
Aus dem Tod in Hingabe entsteht neues Leben. Das ist die Botschaft der Märtyrer, die ganz in das eucharistische Geheimnis hineingenommen wor– den sind. Auch wenn in unseren Breitengraden uns Christen ein Martyrium, jedenfalls ein physisches, erspart bleibt, gilt der Lebenszusam– menhang von christlicher Existenz und persön– lichem Hineingenommenwerden in das Geheim– nis der Eucharistie auch uns Christenn heute. Existenzielle Eucharistiewerdung muss sich auch in unserem Leben vollziehen. Denn wer in die Nachfolge Jesu treten will, erhält von selbst Anteil am Passahgeheimnis der verblutenden Liebe Jesu am Kreuz.
Dies zeigt mit besonderer Deutlichkeit Jesu Antwort auf das Ansinnen der Mutter der Zebedäussöhne, Jesus solle ihnen das Sitzen zu seiner Rechten und Linken in seiner Herrlichkeit garantieren. Jesus aber erklärt ihnen unmiss– verständlich, dass dieses Sitzen in der Herrlichkeit des Himmels allein an die Erfüllung des Willens Gottes gebunden ist, und nennt als elementarste Zulassungsbedingungen für seine Nachfolge Kelch und Taufe: „Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?“ (Mk 10, 38). Die entscheidenden Stichworte in der Antwort Jesu – Kelch, Taufe und damit Liebe – bringen es an den Tag, dass Nachfolge Jesu nicht auf das Moralische eingeengt werden darf, sondern eine elementar christologische Kategorie ist und erst von daher zu einem moralischen Auftrag wird.
Kreuzesnachfolge ist kein Moralismus, der das Leben mit einer negativen Brille betrachtet, aber auch kein Masochismus für Menschen, die sich ohnehin nicht mögen, sondern wirklich Frohe Botschaft, die Leben durch den Tod hindurch verheisst. Nachfolge Jesu ist deshalb stets an das Passahgeheimnis gebunden und gewiss kein Sonntagsspaziergang. Denn sie schliesst die Bereitschaft ein, „ein Simon von Cyrene zu sein auf dem Kreuzweg Jesu in allen Jahrhunderten der Geschichte“.
Das gemeinsame Tragen des Kreuzes hält im Glaubensbewusstsein wach, dass nicht ein kreuzloses, sondern ein kreuzvolles Christentum der Normalfall ist, wie die Kirche seit ihrem Beginn immer wieder neu erfahren musste. Ein beredtes Zeugnis davon legt bereits der Erste Brief des Johannes ab, der seinen Adressaten in Erinnerung ruft: „Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen: der Geist, das Wasser und das Blut; und diese drei sind eins“ (1Joh 5, 6-8).
Beim ersten Hinhören klingt dieses Wort sehr rätselhaft. Verstehen lässt es sich nur auf dem Hintergrund des Passionsberichtes beim Evange– listen Johannes, in dem es heisst, aus der Seitenwunde Jesu am Kreuz seien Blut und Wasser geflossen (Joh 19, 34). Blut und Wasser sind für Johannes Bilder für die beiden Grundsakramente der Kirche, nämlich Taufe und Eucharistie. Johannes bringt damit zum Aus– druck, dass die Sakramente von Taufe und Eucharistie und damit die Kirche selbst vom Kreuz Jesu herkommen. Auf diesem Hinter– grund wird nun verständlich, dass sich Johannes in einer sehr polemischen Weise gegen ein Christentum zur Wehr setzt, das nur noch die Taufe Jesu als Heilsereignis anerkennen will, seinen Tod am Kreuz und seine Vergegenwär– tigung in der Eucharistie jedoch aus dem Glaubensbewusstsein ausblendet. Johannes hat es folglich mit einem Christentum zu tun, das nur das Wasser der Taufe, nicht aber das Blut der Eucharistie und damit des Kreuzes Jesu will. Vom Christentum bleibt nur noch das Wasser übrig; und so wird es ein wässriges oder gar verwasche– nes Christentum: „Christentum wird blosse Lehre, blosser Moralismus und Sache des Intellekts, aber Fleisch und Blut fehlen ihm.“
Wer könnte und wollte ehrlichen Herzens bestreiten, dass auch das Christentum heute immer wieder von di...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Zum Geleit
- 1. Christenverfolgungen in Vergangenheit und Gegenwart
- Über den Autor
- Following Christ Together
- Resolution
- Christenverfolgung heute – Gedenket der Märtyrer
- Impressum