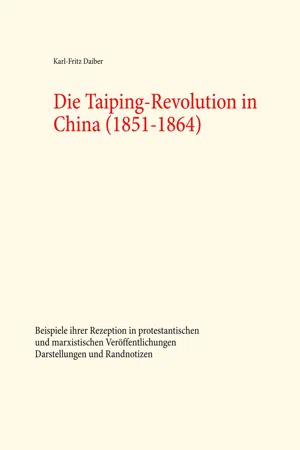
eBook - ePub
Die Taiping-Revolution in China (1851-1864)
Beispiele ihrer Rezeption in protestantischen und marxistischen Veröffentlichungen. Darstellungen und Randnotizen
- 220 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Taiping-Revolution in China (1851-1864)
Beispiele ihrer Rezeption in protestantischen und marxistischen Veröffentlichungen. Darstellungen und Randnotizen
Über dieses Buch
Die Taiping-Revolution in China (1851-1864).Ihre Wahrnehmung durch Missionare der Basler Mission und durch Karl Marx, Friedrich Engels, Mao Zedong und in der auf ihrer politischen Philosophie aufbauenden chinesischen Geschichtsschreibung in Einzeldarstellungen mit Randnotizen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Taiping-Revolution in China (1851-1864) von Karl-Fritz Daiber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Die Wahrnehmung der Taiping-
Revolution in Schriften von Karl Marx und
Friedrich Engels sowie bei Mao Zedong
(Rezeptionsanalyse 1)
Marx und Engels haben in seltener Wachheit nicht nur die europäischen politischen und ökonomischen Entwicklungen zu ihrer Zeit verfolgt und in vielen Einzelaufsätzen beschrieben und analysiert, sondern ihren kritischen Blick auch auf die Vorgänge in Ostasien geworfen. So ist es nicht überraschend, dass sich die Spuren der Taiping-Bewegung in China in ihren Arbeiten der 1850er und 1860er Jahre finden. (Im Folgenden nenne ich diejenigen Texte, die sich durch das Register der Marx-Engels-Gesamtausgabe, erschienen im Dietz-Verlag (MEW), auffinden ließen.)
Die erste Erwähnung einer sich anbahnenden „gewaltigen Revolution“ in China findet sich in einem Aufsatz von Karl Marx und Friedrich Engels, in dem sie die politische und wirtschaftliche Situation in Europa und Nordamerika Revue passieren lassen. Der Hauptteil wurde am 31. Januar 1850 abgeschlossen und etwas später durch eine Analyse neuester Entwicklungen in Preußen ergänzt, das Ganze unter dem Titel „Revue“ im Februar 1850 in der Rheinischen Zeitung publiziert (MEW 7, 213-225). Der Hauptteil endet mit einem Hinweis auf neuere revolutionäre Entwicklungen in China:
„Zum Schluß noch ein charakteristisches Kuriosum aus China, das der bekannte deutsche Missionär Gützlaff mitgebracht hat. Die langsam aber regelmäßig steigende Übervölkerung des Landes machte die dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse schon lange sehr drückend für die große Majorität der Nation. Da kamen die Engländer und erzwangen sich den freien Handel nach fünf Häfen. Tausende von englischen und amerikanischen Schiffen segelten nach China, und in kurzer Zeit war das Land mit wohlfeilen britischen und amerikanischen Maschinenfabrikaten überfüllt. Die chinesische, auf der Handarbeit beruhende Industrie erlag der Konkurrenz der Maschine. Das unerschütterliche Reich der Mitte erlebte eine gesellschaftliche Krise. Die Steuern gingen nicht mehr ein, der Staat kam an den Rand des Bankerotts, die Bevölkerung sank massenweise in den Pauperismus hinab, brach in Empörungen aus, mißkannte, mißhandelte und tötete des Kaisers Mandarine und Fohis Bonzen. Das Land kam an den Rand des Verderbens und ist bereits bedroht mit einer gewaltigen Revolution. Aber noch schlimmer. Unter dem aufrührerischen Plebs traten Leute auf, die auf die Armut der einen, auf den Reichtum der andern hinwiesen, die eine andere Verteilung des Eigentums, ja die gänzliche Abschaffung des Privateigentums forderten und noch fordern. Als Herr Gützlaff nach 20jähriger Abwesenheit wieder unter zivilisierte Leute und Europäer kam, hörte er von Sozialismus sprechen und frug, was das sei? Als man ihm dies erklärt hatte, rief er erschreckt aus:
‚Ich soll also dieser verderblichen Lehre nirgends entgehn? Grade dasselbe wird ja seit einiger Zeit von vielen Leuten aus dem Mob in China gepredigt!‘
Der chinesische Sozialismus mag sich nun freilich zum europäischen verhalten wie die chinesische Philosophie zur Hegelschen. Es ist aber immer ein ergötzliches Faktum, daß das älteste und unerschütterlichste Reich der Erde durch die Kattunballen der englischen Bourgeois in acht Jahren an den Vorabend einer gesellschaftlichen Umwälzung gebracht worden ist, die jedenfalls die bedeutendsten Resultate für die Zivilisation haben muß. Wenn unsere europäischen Reaktionäre auf ihrer demnächst bevorstehenden Flucht durch Asien endlich an der chinesischen Mauer ankommen, an den Pforten, die zu dem Hort der Urreaktion und des Urkonservatismus führen, wer weiß, ob sie nicht darauf die Überschrift lesen:
République chinoise
Liberté, Egalité, Fraternité…“
(MEW 7, 221-222)
Der Schluss des Aufsatzes verweist auf die Quelle der Informationen: Sie beruhen auf Berichten von Karl Gützlaff, der auf seiner letzten Geldbeschaffungsreise in Europa auch Vorträge in London gehalten hat. Und er ist es auch, der von Leuten berichtet hat, die die Umverteilung des Eigentums bis hin zur Abschaffung des Privateigentums propagieren. Gützlaff weiß nichts davon, dass ähnliche Bestrebungen in Europa aufgetreten sind, und dass diese unter dem Begriff „Sozialismus“ agieren, weiß er ebenfalls nicht. Gützlaff hat sich offenbar von den chinesischen Akteuren eines solchen Sozialismus bemerkenswert distanziert. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass die revolutionäre Bewegung unter der verarmten Bevölkerung Chinas von Marx und Engels nicht näher beschrieben wird. Auch Namen von Revolutionären werden nicht genannt, ebenso wird nichterwähnt, dass es sich um Leute aus dem Umfeld der protestantischen Mission handelt: die God Worshipping Society, um die es hier nur gehen kann, ist 1843 gegründet worden, und zwar genau von jenen, die 1851 das Taiping Himmlische Königreich ausgerufen haben. Jedenfalls scheint Gützlaff selbst über die Entwicklungen informiert gewesen zu sein. Für Marx und Engels ist die religiöse Basis dieses „Sozialismus“ indessen entweder unbekannt oder nicht erwähnenswert.
In den folgenden Jahren finden sich in den Publikationen immer wieder Spuren, die erkennen lassen, dass sowohl Marx als auch Engels die Entwicklungen in China verfolgen. Im Mittelpunkt steht für sie die Frage nach den Ursachen der Aufstände sowie ihren politischen und ökonomischen Folgen. In einem Beitrag für die New York Daily Tribune vom 14. Juni 1853 schreibt Marx der „chinesischen Revolution“ einen erheblichen Einfluss auch auf die Entwicklung in Europa zu. Zur Frage der Ursachen dieser Revolution schreibt er:
„Was immer die sozialen Ursachen sein mögen, die zu den chronischen Aufständen in China in den letzten Jahren geführt und die sich jetzt zu einer einzigen, ungeheuren Revolution zusammengeballt haben, und welche religiösen, dynastischen oder nationalen Formen sie auch annehmen mögen: ausgelöst wurde dieser Ausbruch ohne Frage dadurch, daß die englischen Kanonen China das Rauschgift aufzwangen, das wir Opium nennen. Vor den britischen Waffen ging die Autorität der Mandschu-Dynastie in Scherben; das abergläubige Vertrauen in die Unvergänglichkeit des Reichs des Himmels brach zusammen…“ (MEW 9, 95-96)
Die Denkrichtung der Analyse bleibt deutlich: Es sind die politischen und ökonomischen Kräfte, die hier wirksam sind und die die einschneidenden Folgen produzieren. Angesichts des Selbstverständnisses der Taiping erscheint die These, „das abergläubige Vertrauen in die Unvergänglichkeit des Reichs des Himmels“ sei zusammengebrochen, höchst gewagt. Das neue Nanking-Reich war ja genau das Taiping Himmlische Reich; die Kontinuität blieb zumindest im Selbstverständnis der führenden Revolutionäre gewahrt.
In einem weiteren Beitrag für die New York Daily Tribune vom 15. November 1853 bezieht sich Marx auf Berichte aus Kanton, in denen die Ansicht vertreten wird, dass infolgedessen, dass sich die Aufständischen über das ganze Land verbreiteten, sich für den Handel, vor allem mit Tee und Rohseide, nach und nach eine ruinöse Situation entwickle (MEW 9, 450-451).
In einem Beitrag zur Kriegspolitik Frankreichs und Englands sowie über den griechischen Aufstand und die Situation in Spanien vom 3. März 1854 (New York Daily Tribune vom 18. März 1854) kommt Karl Marx auch auf die Situation in China zu sprechen. Die Aufständischen seien im Vormarsch. Die Rebellen hätten einen „regelrechten Kreuzzug gegen die Buddhisten“ unternommen, sich damit aber auch die Tibeter und die „Tataren“ zu Feinden gemacht. Der Sturz der Mandschu-Dynastie scheine möglich zu sein. Angesichts dieser Situation sei in Fortsetzung ein Religionskrieg zwischen den Taiping und den buddhistischen Nachbarvölkern denkbar. Marx schließt seine Analyse mit dem Satz: „Folglich kann man den großen Religionskrieg zwischen Chinesen und Tataren, der sich über die Grenzen Indiens ausdehnen wird, in naher Zukunft erwarten.“ (MEW 10, 115-116)
Hier taucht das Religionsthema in einer überraschenden neuen Variante auf, nämlich in der Variante der dezidiert antibuddhistischen Politik der Taiping. Warum sie diese Politik betreiben, bleibt ungesagt. Die Zerstörung alter religiöser Kultstätten und Bilder stand ja schon am Anfang der öffentlichen Aktionen von Hong Xiuquan. Damit praktizierte er seinen christlichen Glauben und den Gehorsam gegenüber dem Gott, der ihn berufen hatte. Ob Marx dies alles einfach nicht gewusst hat? Diese Frage kann vom Textmaterial her nicht beantwortet werden.
Friedrich Engels äußerte sich in seinem Artikel „Persien – China“ 1857 zur Lage in China (veröffentlicht in der New York Daily Tribune vom 5. Juni 1857, MEW 10, 210-215). Inzwischen war der zweite Opiumkrieg (1856-1860) ausgebrochen und wurde in brutaler Härte geführt. Engels konstatiert, im Gegensatz zum ersten Opiumkrieg handle es sich jetzt, im „neuen Englisch-Chinesischen Krieg“, um einen Volkskrieg der Chinesen gegen eindringende Ausländer. Angesichts dessen, dass die Herrschaft der Mandschu-Dynastie durch die Rebellen bedroht sei, sei in nicht allzu ferner Zeit das Ende des ältesten Kaiserreiches der Welt gekommen. Engels erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Rebellenkönig von Nanking. Er scheine sich völlig sicher zu fühlen, einzig bedroht von den Intrigen der eigenen Anhänger. Dieser kleine Hinweis zeigt, dass Engels offenbar über mehr Informationen verfügte, als er im Zusammenhang seines Aufsatzes mitteilt. Erstaunlich ist, dass nicht einmal andeutungsweise der christlichprotestantische Hintergrund des Nankinger Himmelssohnes angesprochen wird. Von Engels hätte man dies eigentlich erwarten können, hat er sich doch mit dem deutschen Bauernkrieg und seinen christlich-protestantischen Hintergründen ausführlich befasst (Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg, MEW 7, 327-413). Parallelitäten hätten zumindest angedeutet werden können.
Ein letzter Beitrag zu den Taiping, überschrieben mit „Chinesisches“, veröffentlicht in „Die Presse“ vom 7. Juli 1862 (MEW 15, 514-516), stammt von Karl Marx.
Anlass des Artikels ist die Eroberung der Stadt Ningbo durch die Taiping. Ningbo ist etwa 200 km südlich von Shanghai gelegen und war Vertragshafen der westlichen Mächte. Grundlage der Informationen ist ein Brief des britischen Konsuls in Ningbo an den britischen Gesandten in Peking. Der Brief schildert offensichtlich eindrücklich die Grausamkeit und Brutalität der Kriegsführung der Taiping. Marx berichtet, davon ausgehend, auch über die Besoldung der Armeen, über die Rekrutierung der Soldaten und über angewandte Strategien der Kriegsführung.
Was er nicht berichtet, ist, dass die Schlacht um Shanghai zwischen den Taiping und den Kaiserlichen zwar im Gange, aber noch nicht entschieden war. Sie wurde kurze Zeit nach der Abfassung des Aufsatzes von den kaiserlichen Truppen mit Hilfe der Engländer und Franzosen gewonnen.
Seine Ablehnung der Taiping-Bewegung wird schon im ersten Teil des Artikels deutlich zum Ausdruck gebracht: Politische Ziele im Sinne einer völligen Umgestaltung der Gesellschaft erkennt er nicht mehr. Sein Vorwurf: die Taiping arbeiteten nur an einem Dynastiewechsel. Als revolutionäre Bewegung hätten die Taiping von vornherein einen „religiösen Anstrich“ gehabt, aber das hätten sie „mit allen orientalischen Bewegungen gemein“. Und dann formuliert Marx:
„Die Macht ungezügelter und schrankenloser Ausschweifung für sie selbst scheint ihnen in der Tat ebenso wichtig als die Zerstörung fremden Lebens. Diese Ansicht von den Taipings stimmt in der Tat nicht mit den Illusionen englischer Missionäre [überein], die von der ‚Erlösung Chinas‘, der ‚Wiedergeburt des Reiches‘, der ‚Rettung des Volkes‘ und der ‚Einführung des Christentums‘ durch die Taiping fabelten. Nach zehn Jahren geräuschvoller Scheintätigkeit haben sie alles zerstört und nichts produziert.“ (515)
Es ist nicht ganz deutlich, ob Marx hier den Konsul sprechen lässt oder ob er sein letztes eigenes Urteil formuliert. Sicher ist, dass er die Taiping eher als Störung eines Wegs zur kommunistischen Revolution wahrgenommen hat denn als Bundesgenossen.
Innerhalb der verschiedenen Äußerungen von Marx, auch von Marx und Engels gemeinsam, kommt es gegen Ende des Taiping-Reiches zu einer deutlichen Verschärfung der Ablehnung. Latente Skepsis war von Beginn an vorhanden. Für Marx und Engels sind die Taiping keine Vorläufer einer großen proletarischen Revolution.
Genau an dieser Stelle folgt Mao Zedong Marx und Engels nicht. Im Blick auf die Wertung der Taiping-Rebellion hat Mao bewusst schon früh einen eigenen, eben den chinesischen Weg eingeschlagen. Es begann damit, dass er die kleinen Bauern als mögliche Träger der Revolution wahrnahm. Damit war eine Brücke für die Einstufung der Taiping-Rebellion als frühe revolutionäre Bewegung in der chinesischen Geschichte gegeben. Dokumentiert wird dies etwa im II. Kapitel der Arbeit „The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party, December 1939“ (Mao Tse-tung, Selected Works, Volume 2: https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/msw2_23htm (07.10.2016)). Hier wird übrigens auch nicht nur von der Taiping-Rebellion gesprochen, sondern vom „Movement of the Taiping Heavenly Kingdom“.
Die offizielle Geschichtsschreibung ist dem gefolgt. Nur wenige Jahre nach der kommunistischen Machtübernahme, nämlich 1958, wurde in Nanjiing das „Historical Museum of the Taiping Heavenly Kingdom“ eingerichtet. Inwieweit dieses Museum auch die Verbindung der Führer der Taiping-Bewegung zu protestantischen Missionaren aufzeigt, ist mir nicht bekannt geworden. Allerdings gibt es im Internet einen Hinweis auf eine Museumskooperation im Jahr 2011. Damals wurde im Hongkonger „Museum of Coastal History“ in Verbindung mit dem Nankinger Museum eine Ausstellung zu den Taiping gezeigt. Im Bericht darüber wird darauf hingewiesen, dass ein zweiter wichtiger Führer der Taiping-Bewegung, nämlich Hong Rengan, jahrelang in Hongkong gelebt und dort gute Beziehungen zu protestantischen Missionaren unterhalten habe (http://www.info.gov.hk/gia/general/201105/19/P201105190091.htm (17.10.2016)). Jedenfalls bestätigt dies, dass der kommunistische chinesische Staat auch heute noch das Taiping Heavenly Kingdom zumindest als national wichtiges Ereignis seiner neueren Geschichte bewertet und die Erinnerung daran wachhält. Offen bleibt hier die Frage, wie der chinesische Protestantismus sich zur Taiping-Revolution verhält, konkreter gesagt, offen bleibt die Frage, welcher Stellenwert in der Lehre der protestantischen theologischen Colleges der Gegenwart diesem Teil protestantischer chinesischer Geschichte zukommt.
Die Wahrnehmung der Taiping-
Revolution in zwei der kommunistischen
Partei der Volksrepublik China nahestehenden
Veröffentlichungen seit der Endphase
der Kulturrevolution (Rezeptionsanalyse 2)
In einem ersten Schritt wurden zeitnahe Dokumente von Karl Marx und Friedrich Engels sowie erste Annäherungen an eine Würdigung der Taiping durch Mao Zedong analysiert. Dieser Arbeitsschritt wird jetzt noch ergänzt durch die Analyse von Dokumenten aus der Zeit nach der Kulturrevolution (1966-176). Für nicht Chinesisch sprechende Forscher steht nicht gerade reiches Material zur Verfügung, ganz im Gegensatz zu den reichhaltig vorhandenen chinesischen Forschungsdokumenten. Indessen zeigen die beiden hier präsentierten Arbeiten, in welche Richtung die Analysen gehen. Hauptproblemstellung ist auch in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit die Taiping-Bewegung als religiöse Bewegung, ja sogar als protestantische Bewegung wahrgenommen wird.
Veröffentlichung 1
Die Taiping-Revolution, zusammengestellt vom Kollektiv für die „Serie der Geschichte des modernen China“, Peking: Verlag für die fremdsprachige Literatur.
Der Band stellt eine Übersetzung der chinesischen Ausgabe von 1973 dar: Tai ping tian guo ge ming. Auf die Erscheinungszeit wird am Schluss noch eingegangen werden. Zum Verlag: Bestseller in Deutschland und anderswo ist die kleine rote „Mao-Bibel“: Worte des Vorsitzenden Mao-Tse-Tung. Zur Romanisierung ist zu bemerken: Alle Namen wurden von mir auf die heute gängige Romanisierung in Pinyin umgestellt.
Die Darstellung der Taiping-Revolution erfolgt in 17 Kapiteln.
I. Wetterleuchten vor dem Sturm, 1-12
„Nach dem Opiumkrieg von 1840 kam zur alten feudalen Unterdrückung die Aggression des ausländischen Kapitalismus, und die Lage des chinesischen Volkes wurde schlimmer denn je. Die Widersprüche der chinesischen Gesellschaft spitzten sich zu, und die Krisen wurden größer“. (1) Mit diesem Satz beginnt die Situationsanalyse. Aufgezeigt wird im Folgenden die gesellschaftliche Entwicklung in Südchina, insbesondere im Grenzgebiet der Provinzen Guangxi und Hunan. Die von den Briten erzwungene Einfuhr von Opium, das mit Silber bezahlt werden musste, führte zu dessen Verteuerung und damit zu einer Inflation der Kupferwährung. Die Handwerker verarmten und die Bauern verarmten.
Hinzu kam, dass die Briten Textilprodukte nach China einführten, wodurch die einheimische Textilproduktion zum...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Entstehungshintergrund und Zielsetzung der Untersuchung
- Die Taiping-Bewegung und ihr protestantischer Hintergrund nach dem Forschungsstand der letzten Jahrzehnte
- Die Wahrnehmung der Taiping-Revolution in Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels sowie bei Mao Zedong (Rezeptionsanalyse 1)
- Die Wahrnehmung der Taiping-Revolution in zwei der kommunistischen Partei der Volksrepublik China nahestehenden Veröffentlichungen seit der Endphase der Kulturrevolution (Rezeptionsanalyse 2)
- Die Wahrnehmung der Taiping-Revolution in der Zeitschrift der Basler Mission und in den missionswissenschaftlichen Arbeiten des Basler Missionars Wilhelm Oehler (Rezeptionsanalyse 3)
- Literatur
- Anhang
- Impressum