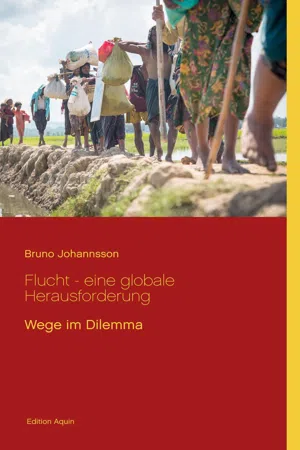![]()
Teil 1
Existenzielle Entscheidungen
1.1. Flüchten oder bleiben?
Ethik in der Not
1.1.1. Was ist Flucht?
Flucht und Auswanderung gehen vielfach ineinander über. Bei der Flucht ist die unmittelbare Zwangslage zum Verlassen eines Ortes gravierender und damit das Interesse an Rückkehr evtl. größer.
Die Alternative „Flüchten oder Bleiben“ hat sich im Laufe der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte sicherlich schon hunderten von Millionen Menschen gestellt. Der Report 2016 der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR spricht von ca. 65 Mio. Menschen, die sich Ende 2016 auf der Flucht befanden, d. h. „gewaltsam vertrieben als Ergebnis von Verfolgung, Konflikt, allgemeiner Gewalt und Menschenrechtsverletzungen“ waren. Dabei macht UNHCR einen Unterschied zwischen den ca. 40 Mio. Binnenvertriebenen (engl. internally displaced persons), den ca. 22 Mio. Flüchtlingen (engl. refugees) und den ca. 3 Mio. Asylbewerbern (engl. asylum seekers). 1
Die Unterscheidung von UNHCR in Binnenvertriebene hat nicht nur statistische Bedeutung sondern prägt auch die Politik von UNHCR. Daraus wird deutlich, dass es nicht ganz unwichtig ist, welchen Begriff von Flucht man in Theorie und rechtlich-politischer Praxis unterstellt. Darauf weist auch Piskorski hin und führt als eines von vielen Beispielen die vietnamesischen Boat People an, die offiziell als Wirtschaftsflüchtlinge deklariert und als Folge davon repatriiert wurden.2 Es macht also durchaus Sinn, einen Moment über das Wesen von Flucht nachzudenken, zumal es auch in der weiteren Betrachtung darauf ankommen wird, zwischen echten und unechten Flüchtlingen zu unterscheiden, weil davon ihre Rechtsansprüche an die nationale und globale Flüchtlingshilfe abhängen. Im Falle der vietnamesischen Boat People wurden diese abgelehnt.
Eine weitere vor allem rechtlich relevante Quelle für die Abgrenzung des Fluchtbegriffs ist die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)3, die in ihrem Artikel 1 den Begriff „Flüchtling“ definiert. Als einzige Gruppe von Fluchtgründen lässt sie Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung und/oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe gelten. Krieg, Bürgerkrieg, Folter, Naturkatastrophen finden hier keine Erwähnung, werden aber de facto von UNHCR akzeptiert. Die Überschreitung der Grenze des eigenen Staates und damit die Nicht-Inanspruchnahme seines Schutzes sind gemäß GFK Bedingung für die Flüchtlingseigenschaft. 4 Diese Bedingung hat UNHCR möglicherweise zu der oben erwähnten Unterscheidung in Flüchtlinge und Binnenvertriebene veranlasst. Aber auch für Letztere fühlt sich UNHCR zuständig.
Für unsere weitere Betrachtung ist es wichtig, eine Vorstellung von Flucht zu umschreiben, die über die aktuelle Statistik und Politik hinausgeht. „Flucht ist eine Reaktion auf Gefahren, Bedrohungen oder als unzumutbar empfundene Situationen. Meist ist die Flucht ein plötzliches und eiliges, manchmal auch heimliches Verlassen eines Aufenthaltsortes oder Landes. Die eilige Bewegung weg von der Bedrohung ist oft ziellos und ungeordnet, eine Flucht kann aber auch das gezielte Aufsuchen eines Zufluchtsortes sein. Fluchtverhalten gehört zum natürlichen Verhaltensrepertoire von Tieren. 5 Man darf getrost hinzufügen: Flucht gehört auch zum natürlichen Verhaltensrepertoire von Menschen, wobei diese evtl. eine sorgfältigere Entscheidung treffen, wenn ihnen genügend Zeit gegeben ist. Einen weiteren Punkt möchte ich dieser Definition als wesentlich hinzufügen: Der Flüchtende möchte den Standort, an dem er sich zum Zeitpunkt der Flucht befindet, eigentlich halten. Es war zu diesem Zeitpunkt der Ort seiner Wahl, in vielen Fällen sogar – subjektiv empfunden – seine Heimat, in der er Wurzeln geschlagen hat. Dieser Ort ist evtl. stark mit der Lebensgeschichte des Flüchtenden verbunden, er verbürgt Traditionen und ist möglicherweise das Ergebnis von Investitionen wie z. B. bei einem eigenen Anwesen. Je mehr diese Faktoren gegeben sind umso näher liegt es, dass der Flüchtling eigentlich zurückkehren möchte, sobald die gefährliche Situation beseitigt ist. Diese Rückkehrwilligkeit möchten wir als ein Merkmal von Flucht im Auge behalten. Sie unterscheidet Flucht von Auswanderung, obwohl auch dabei das Heimweh mitunter auf dramatische Weise zur Rückkehr drängt.
Insbesondere bei der Flucht vor plötzlichen Naturkatastrophen wie Stürmen und Vulkanausbrüchen muss sehr schnell, mitunter geradezu überstürzt, gehandelt werden. Aber es gibt auch Fluchtarten, bei denen eine langfristige Planung nicht nur möglich sondern auch unumgänglich ist. Ich denke an manche Flucht aus der DDR, die jahrelang sorgfältig geplant wurde.6 In solchen Fällen ist Flucht häufig auch zielgerichtet, ist somit nicht nur eine Bewegung weg von einem Ort, sondern gleichzeitig eine gezielte Bewegung hin zu einem bestimmten anderen Ort. Im Falle des DDR-Flüchtlings war dies meistens Westdeutschland. Im Zuge der nahöstlich-europäischen Flüchtlingskrise 2015/16 waren die Zielorte häufig europäische Länder mit einer besonderen Präferenz für Deutschland. Allerdings muss man bedenken, dass die große Mehrzahl der Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan auch in dieser Krise in einem der Anrainerstaaten Türkei, Jordanien und Libanon gelandet ist. Die Rückkehr von dort in die Heimat ist sehr viel leichter zu bewerkstelligen. Aus diesem und anderen Gründen dürfte die Rückkehrwilligkeit bei diesen mehr als 4 Millionen Menschen ausgeprägter sein als bei denen, die in Europa angekommen sind. Bei letzteren spielte der Aspekt „Flucht wohin“ teilweise eine größere Rolle als der in Not geborene Gedanke „Flucht wovor“. Daraus ergibt sich eine beträchtliche Zahl von Asylbewerbern, deren Antrag abgelehnt wird, weil die Gerichte eher Auswanderungsmotive als Fluchtgründe unterstellen.7
Wir beobachten in der Menschheitsgeschichte die Rückkehrwilligkeit insbesondere auch nach Vertreibungen, die man als durch eine politisch-militärische Macht unmittelbar erzwungene Flucht betrachten kann. Ein eindrucksvolles Beispiel bieten uns über Jahrtausende hinweg die Juden, die nach ihrer Babylonischen Gefangenschaft als Volk wieder zurückkehrten und nach ihrer Zerstreuung durch die Römer knapp 1900 Jahre später wieder einen Staat bildeten Auch die deutsche Geschichte weist eindrucksvolle Beispiele auf. Wir wissen z. B. nicht genau, wie viele Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in den 50er und 60er Jahren zurückgekehrt wären, wenn man ihnen ihr Grundeigentum zurückerstattet hätte. Es könnten Hunderttausende und mehr gewesen sein, wenn man die Aktivitäten der Heimatvertriebenen in den Jahrzehnten nach dem Krieg betrachtet.
Wir haben damit Flucht zumindest grob gegenüber Auswanderung abgegrenzt und Vertreibung als einen Sonderfall von Flucht eingeordnet. Als Ursachen für Flucht kommen weiterhin in Frage: Naturkatastrophen, Hungersnot, Verfolgung, Unterdrückung, Bürgerkrieg, Krieg und wirtschaftliche Not. Der Freiheitsspielraum des potentiellen Flüchtlings ist bei den einzelnen Ursachenkomplexen unterschiedlich. Während es bei plötzlich auftretenden Naturkatastrophen häufig um das nackte Überleben durch schnelles Handeln geht, können sich Vertreibung und Unterdrückung über einen längeren Zeitraum hinziehen, der evtl. eine gewisse Fluchtvorbereitung ermöglicht. Unterdrückung kann man grob umschreiben als die gewaltsame Hinderung an der Ausübung der Menschenrechte.
1.1.2. Der Flüchtling – ein mehrfach Geschlagener
Der Flüchtling ist ein vielfach Geschlagener: Von seinem Ursprungsort musste er weichen, dann eine beschwerliche Flucht auf sich nehmen und am Zufluchtsort zahlreiche Schwierigkeiten bewältigen.
Die Flüchtlingskrise 2015/16 hat vielen Menschen in Europa und besonders in Deutschland etwas in Erinnerung gebracht, was manche schon fast vergessen, die meisten aber noch nie erlebt hatten: Das Leid eines Flüchtlings. Die letzte große Fluchtbewegung in Europa war die aus der DDR.8 Der Zielort war überwiegend Westdeutschland, das dazu geeignet war, die in der These angeführten Leidfaktoren besonders niedrig zu halten: Die wirtschaftliche Eingliederung verlief häufig zügig, sodass der materielle Verzicht durch Verlassen der Heimat bald ausgeglichen war, zumal das Konsumgüterangebot am Zufluchtsort deutlich besser war. Der Fluchtweg war vor dem Mauerbau kurz und unproblematisch, danach evtl. durch Umwege über die Ostsee oder den Balkan länger bzw. wegen des Schießbefehls an der Mauer viel gefährlicher. Immerhin hat er ca. 1000 Menschen das Leben gekostet.9 Durch die Willkommenskultur der Bundesrepublik und evtl. vorhandene Verwandte waren die Startschwierigkeiten begrenzt. Ich erinnere mich, dass allein meine Eltern mindestens 6 Flüchtlingen erheblich geholfen haben. Trotzdem: Ein vertrautes Umfeld wurde verlassen. Nicht immer hat sich der ehemalige DDR-Bürger im „kapitalistischen Westen“ gut eingewöhnen können. In wieweit die Integration der DDR-Flüchtlinge zumindest in der zweiten und dritten Generation gelang, kann man vielleicht daran erkennen, dass sich der Rückstrom in die Heimat nach der Wiedervereinigung in Grenzen hielt. (Vgl. Frage 1). Das bedeutet, dass viele DDR-Flüchtlinge ihr Ziel erreicht haben: Leben in einem freieren und wirtschaftlich stärkeren Land mit größeren Entwicklungschancen.
Die ökonomische Wirtschaftstheorie hält hier ein aussagekräftiges Gleichnis bereit, das uns in diesem Buch begleiten wird: Ein Bergsteiger befindet sich auf dem Weg zu einem bescheidenen Gipfel und sieht in der Ferne einen viel höheren und attraktiveren Gipfel. Er entschließt sich zum Abstieg, um sich an den Fuß des anderen Berges zu begeben, der ihm so viel mehr Chancen bietet. Dort muss er zwar von vorn anfangen, aber er hat die Perspektive eines viel höheren Gipfels. Insoweit ein DDR-Bürger nicht politisch verfolgt wurde, aber das System mit seinen begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten satt hatte und aus diesem Grund nach Westdeutschland ging, konnte man ihn bestenfalls als Wirtschaftsflüchtling einstufen. Er war in diesem Falle eher ein Auswanderer als ein Flüchtling. Er war weniger ein Geschlagener als ein Frustrierter. (Vgl. Frage 2)
Die Flucht 2015/16 aus dem Nahen Osten über die Balkanroute hatte demgegenüber ganz andere Dimensionen: Höherer Leidensdruck durch Bürgerkrieg und Verfolgung am Ursprungsort, ein langer und entbehrungsreicher Fluchtweg durch unfreundliche Länder und über schwierige Grenzen, das Ankommen in der völlig fremden Kultur eines europäischen Landes. Ein syrischer Flüchtling musste sich in seiner Heimat geschlagen geben, sei es gegenüber Bombenangriffen, einem heranrückenden Islamischen Staat oder der Bedrohung durch Verhaftung und Folter. Er musste sein Heim verlassen und in das nächst verfügbare Lager in Jordanien, dem Libanon oder der Türkei ausweichen. Wenn er Pech hatte musste er dort mit seiner Familie Hunger und andere Not leiden. Er wieder ein Geschlagener und musste seine Flucht fortsetzen. Wenn er Pech hatte, ist er in das Netz von Schleppern geraten und ausgebeutet worden oder gar zu Tode gekommen. Hat er diesen Schlag verkraftet, so kann ihn das Pech weiter verfolgt haben, dass er in Idomeni vor einer unübersteigbaren Mauer ankam und schließlich wieder in einem türkischen Lager gelandet ist. Gehörte er zu den Glücklichen, die vor dem Bau der Balkanmauern nach Europa gelangten, so kann es ihm passieren, dass sein Antrag auf Asyl abgelehnt und er abgeschoben wird. Darf er bleiben, so findet er sich in einer fremden Kultur, die er nicht wirklich gewählt hat und die ihm viele Schwierigkeiten bereitet, z. B. in Form von langen Wartezeiten und rechtsextremen Anfeindungen.
Die Formen des geschlagen seins sind von Fall zu Fall und auch von Region zu Region natürlich sehr unterschiedlich. Haben wir es beispielsweise mit einer Hungersnot zu tun, so ist der Feind die Natur und weniger der Mensch. Für den Bedrohten ist es wichtig so rechtzeitig aktiv zu werden, dass er und seine Familie noch die Kräfte haben, um einen längeren Fluchtweg in eine bessere Region bewältigen zu können. Wenn er schon in die Lethargie des Hungernden verfallen ist, bekommt er den Start nicht hin. Daran erkenne wir auch, dass sich der Flüchtige sich mit seinem Schicksal ganz in der Nähe des Verhungernden befindet. Letzterer hat nicht mehr die Kraft, dem Tod zu entfliehen. Der Flüchtling hat sie noch, auch wenn der Tod in Form von Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung und Folter droht.
In obiger Beschreibung sind wir von einem echten Flüchtling ausgegangen, bei dem im Anfangsstadium die „Flucht wovor“ nahezu zwingend war. Es ist bei drohenden dramatischen Lebenssituationen nur allzu verständlich, dass jemand versucht frühzeitig zu reagieren, um nicht einem totalen Zeitdruck ausgesetzt zu sein und die Bewegung weg von einem gefährlichen Ort umzugestalten in eine Bewegung hin zu einem möglichst viel besseren Ort, z. B. Europa.
Offene Fragen
- Wie viele DDR-Flüchtlingen in der ersten, zweiten bzw. dritten Generation sind nach der Wiedervereinigung wieder in ihre Heimat zurückgekehrt?
- Wie viele der ca. 3,5 Mio. „DDR-Flüchtlinge“ waren von ihrer Ausgangslage und Zielsetzung her eher Auswanderer als Flüchtlinge?
1.1.3. Die Freiheitsspielräume eines potentiellen Flüchtlings
Die Handlungsalternativen potentieller Flüchtlinge sind je nach Art der Notlage, ihren Persönlichkeitsmerkmalen und ihren Ressourcen sehr unterschiedlich. Sie reichen vom Ausharren bis zum überstürzten Aufbruch.
Die Handlungsalternativen eines potentiellen Flüchtlings kann man wie folgt abstufen:
- Bleiben und versuchen, die Gefahr abzuwehren,
- Bleiben, aber Frau, Kinder und evtl. wertvolle Vermögensteile in Sicherheit bringen,
- Rückzug zum nächsten sicheren Ort innerhalb desselben Staates evtl. mit der Absicht, bei nächster Gelegenheit in das Geschehen einzugreifen bzw. zurückzukehren,
- Flucht in einen anderen mehr oder weniger fernen Staat mit oder ohne Rückkehrabsicht.
Der Freiheitsspielraum des potentiellen Flüchtlings ist bei den schon erwähnten Ursachenkomplexen Naturkatastrophe, Vertreibung, Verfolgung, Unterdrückung, Krieg, Bürgerkrieg und wirtschaftliche Not unterschiedlich. Während es bei plötzlich auftretenden Naturkatastrophen häufig um das nackte Überleben durch schnelles Handeln geht, können sich Vertreibung und buchstäbliche Verfolgung über einen längeren Zeitraum hinziehen, der evtl. eine gewisse Fluchtvorbereitung ermöglicht. Unterdrückung kann man grob umschreiben als die gewaltsame Hinderung an der Ausübung der Menschenrechte. Hier hat das Individuum zahlreiche Handlungsmöglichkeiten: Flucht, Widerstand, Ertragen der Unterdrückung, evtl. bis zum Märtyrertod. Krieg ist eine soziale Katastrophe, bei der zumindest für gesunde Erwachsene die Option im Raum stehen kann, an den militärischen Handlungen aktiv teilzunehmen, um ihren Ausgang im Sinne der eigenen Interessen zu beeinflussen. Für Kinder besteht diese Option nicht. Sie müssen in Sicherheit gebracht werden. Noch etwas weiter können wie oben bereits erwähnt die Handlungsspielräume bei wirtschaftlicher Not sein. Bei einer mit einer plötzlichen Naturkatastrophe verbundenen Hungersnot ist wieder schnelles Handeln erforderlich. Anders ist die Lage bei einer allgemeinen Wirtschaftskrise oder einer sehr schlechten Wirtschaftslage mit hoher Arbeitslosigkeit und Inflation. Hier besteht mitunter d...