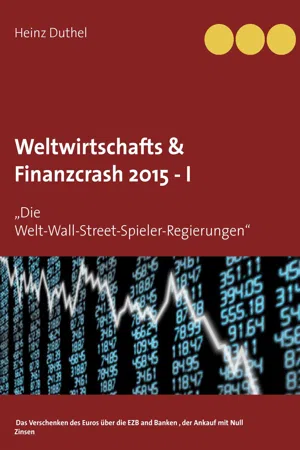![]()
Wirtschaftsforum in Davos
So viele Teilnehmer gab es noch nie: In Davos diskutieren mehr als 2000 Menschen über die Zukunft der Weltwirtschaft. Auch das halbe deutsche Kabinett ist dabei. Aber braucht man diese Konferenz überhaupt?
Dr. Marc Beise leitet die Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Der gebürtige Mainzer (Jahrgang 1959) ist in Hessen aufgewachsen und mit Kickers Offenbach sozialisiert worden; heute ist er Dauergast in der Bayern-Arena. Schon als Schüler war der
Journalismus sein Berufsziel, das er nie aus den Augen verloren hat und auch 30 Jahre nach den ersten Schreibversuchen nicht bereut. Ein Wechsel in die Wirtschaft kam für ihn nie in Frage. Schon während des Studiums (1977 bis 1984 Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt am Main, Lausanne und Tübingen) war Beise Volontär der Offenbach-Post. Nach dem Juristischen Referendar-Examen arbeitete er dort 1985 bis 1989 als Redakteur, zuletzt als Ressortleiter Politik, Wirtschaft und Nachrichten. 1989 bis 1995 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator der interdisziplinären DFG-Forschergruppe "Europäische und Internationale Wirtschaftsordnung" an der Universität Tübingen. In dieser Zeit entstand die Doktorarbeit "Die Welthandelsorganisation (WTO). Funktion, Status, Organisation", Nomos 2001. 1995 kehrte Beise in den Journalismus zurück als Redakteur des Handelsblatts in Düsseldorf, das er als Ressortleiter Wirtschaftspolitik 1999 in Richtung München verließ. Bei der Süddeutschen Zeitung in München gehört Beise längst zum Inventar. Er begann dort als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft, seit 2007 leitet er die Wirtschaftsredaktion. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Wirtschaftspolitik. Beise bezeichnet sich selbst als "Neoliberalen" und "Ordnungspolitiker" in der Worte ursprünglicher Bedeutung: Er ist also für einen funktionierenden staatlichen Rahmen, innerhalb dessen die Wirtschaft sich aber frei entfalten können muss. Hätte man das ausreichend bedacht, wäre es nie zur Finanzkrise gekommen. Umgekehrt gilt aber auch: Der Staat ist wichtig, aber er kann nicht alles leisten. In seinem wöchentlichen Video-Blog "Summa summarum" auf sueddeutsche.de gibt er Einblicke in sein Denken und sein Arbeitszimmer, überladenen Schreibtisch inklusive. Im Urlaub schreibt Beise Bücher, zuletzt: "Viel Geld haben", Econ 2010, "Ausplünderung der Mittelschicht", DVA 2009, "Deutschland - falsch regiert?", Hanser 2006.
Als Weltwirtschaftskrise bezeichnet man den 1929 einsetzenden schweren volkswirtschaftlichen Einbruch in allen Industrienationen, der sich unter anderem in Unternehmenszusammenbrüchen, massiver Arbeitslosigkeit und Deflation äußerte. Die Gleichzeitigkeit der Krisenerscheinungen wurde gefördert durch die gewachsene Verzahnung der Einzelwirtschaften und Finanzströme (Kapitalmobilität). Die Weltwirtschaftskrise beendete die „Goldenen zwanziger Jahre“.
Übersicht
In den 1920er Jahren kam es in den USA zu einer deutlichen Ausweitung der Konsumgüterproduktion und der landwirtschaftlichen Produktion. Gleichzeitig bestand eine sehr ungleiche Vermögensverteilung, der Großteil der Bevölkerung hatte ein zu geringes Vermögen, um aus eigenen finanziellen Mitteln einen ausreichenden Absatzmarkt zu bilden. Die Expansion der Konsumgüterindustrie beruhte zum Teil darauf, dass viele US-Bürger einen Teil ihres Konsums über Kredite finanzierte. Während die Kredite für Konsumzwecke im Jahr 1919 noch 100 Millionen $ betrug, stieg dieser Betrag bis 1929 auf über 7 Milliarden $. Mit dem Schwarzer Donnerstag begann das Vertrauen in die Wirtschaft zu schwinden. Banken vergaben Kredite vorsichtiger, Unternehmen drosselten die Produktion und entließen Arbeiter und die Konsumenten wurden vorsichtiger und gaben weniger Geld aus. Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen. Viele Banken hatten zu unvorsichtig Kredite vergeben und fielen in Insolvenz. Zusätzlich wurde das Bankensystem von Bank Runs destabilisiert. Durch den Zusammenbruch des Bankensystems wurde es für Unternehmen und Konsumenten immer schwieriger Kredite zu bekommen. Daraus entwickelte sich eine wirtschaftliche Abwärtsspirale, die in die Depression führte.
Die „Goldenen Zwanziger“ in Europa wurden hauptsächlich über kurzfristige Kredite in Milliardenhöhe finanziert. Diese forderten die Vereinigten Staaten beim Einbruch der dortigen Volkswirtschaft zurück, da die Banken zahlungsunfähig waren. Viele Bürger hatten sich zur Zeit des Aufschwungs durch den Kauf von Aktien an der guten wirtschaftlichen Lage und der Hausse beteiligen wollen. Der Verkauf von über 16 Millionen Aktien am 24. Oktober 1929, dem Schwarzen Donnerstag, ließ den US-amerikanischen Aktienmarkt zusammenbrechen. Dies führte zu einer Umkehr der Finanzströme. Gelder, die in den Jahren davor in andere Volkswirtschaften investiert worden waren, wurden überstürzt abgezogen. In vielen europäischen Staaten und in anderen Staaten der Welt löste dieser Kreditabzug schwerste wirtschaftliche Krisenerscheinungen aus. In der Kette der Ereignisse kam es unter anderem zu Massenarbeitslosigkeit und einem massiven Rückgang des Welthandels durch protektionistische Maßnahmen.
In den einzelnen Staaten wurde unterschiedlich auf die Herausforderung reagiert: Ausgehend von den skandinavischen Ländern, insbesondere Schweden, begannen die funktionierenden Demokratien mit dem Übergang zum Wohlfahrtsstaat, in das Marktgeschehen einzugreifen. Zaghafte Reformansätze des US-Präsidenten Hoover, um die Große Depression zu überwinden, wurden ab 1933 als New Deal von seinem Nachfolger Franklin D. Roosevelt verstärkt, so auch durch wachstumsfördernde öffentliche Investitionen, die durch Deficit spending (vermehrte Schuldenaufnahme) finanziert wurden. Viele Staaten wie Großbritannien koppelten ihre Währungen vom Golddevisenstandard ab und konnten so wenigstens ihre Währungsreserven erhalten. Das Deutsche Reich unter Reichskanzler Heinrich Brüning versuchte dagegen, durch Stärkung seiner Währung, einhergehend mit rapidem Sozialabbau, aus der Krise zu kommen. Dies trug zu einer Radikalisierung der Politik bei, die den Aufstieg des Nationalsozialismus begünstigte.
Als eine Folge der Weltwirtschaftskrise fand ein Paradigmenwechsel in der Volkswirtschaftslehre statt: Die bisher geltende klassische Wirtschaftstheorie wurde weitgehend vom Keynesianismus abgelöst. Dieser forderte stärkere staatliche Eingriffe und stellte die Nachfrage in den Vordergrund. Diese Änderung der Wirtschaftspolitik wurde in den Folgejahrzehnten teilweise rückgängig gemacht.
Ursachen
Über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise besteht in der Forschung noch kein Konsens.
Wirtschaftshistoriker
Viele Wirtschaftshistoriker sehen in der Weltwirtschaftskrise eine Strukturkrise. Angestoßen durch die Nachfragesteigerung während des Ersten Weltkrieges und verstärkter Mechanisierung (Produktivitätssteigerung) kam es zu einer Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion. Für die Produktionsausweitung fand sich aber keine ausreichende Nachfrage mehr, so dass die Preise für landwirtschaftliche Produkte fielen. Im industriellen Sektor kam es in den Goldenen Zwanziger Jahren zu einer schnellen Expansion der Konsumgüter und Investitionsgüterindustrie. Da die Unternehmensgewinne deutlich schneller stiegen als die Löhne und Gehälter und gleichzeitig die Kreditkonditionen sehr günstig waren, bestand ein scheinbar günstiges Investitionsklima, das zu einer Überproduktion führte. Im Jahr 1929 kam es dann zu einem Einbruch der (ohnehin zu niedrigen) Nachfrage und zu einer extremen Verschlechterung der Kreditkonditionen.
Der Börsenkrach an der New Yorker Börse vom Oktober 1929 hatte eine ähnliche Wirkung. Er war die Folge von Überproduktion und kreditfinanzierter Massenspekulation. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die USA ihre Produktionskapazitäten – vor allem bezüglich der neuen Konsumgüter wie Automobile, Kühlschränke, Fotoapparate – massiv ausgebaut, um den aus dem Nichts entstandenen landesweiten Bedarf decken zu können. Als der Markt gegen Ende der zwanziger Jahre zunehmend gesättigt war, stand die Industrie vor einem Abgrund. Gleichzeitig mit dem industriellen Aufschwung hatte sich ein Spekulationsfieber ausgebreitet, das auch die nicht traditionell mit der Börse in Verbindung stehenden Gesellschaftsschichten erfasste ('Milchmädchen-Hausse'). Um Aktien kaufen zu können, von deren baldigem dramatischem Kursgewinn sie überzeugt waren, nahmen viele Menschen kurzfristige Kredite auf, teilweise zu horrenden Zinssätzen. Sobald sich an der Börse die ersten Anzeichen eines Abschwungs regten, stießen viele Spekulanten, um sich vor dem Schlimmsten zu retten, ihre Wertpapiere ab, was den Verfall der Kurse noch weiter beschleunigte. Zwar wird der 25. Oktober 1929 als Schwarzer Freitag bezeichnet, die stärksten Rückgänge des New Yorker Dow Jones Index wurden allerdings am 24. Oktober um 12,8 Prozent und am 29. Oktober um noch einmal 11,7 Prozent festgestellt.
Der Absturz vom Boom in die Depression erfolgte 1929 völlig überraschend, und die Schockwellen der Krise breiteten sich von der Wall Street rasch in Amerika und in der ganzen Welt aus. Obwohl der Außenhandel nur fünf Prozent des Nationaleinkommens ausmachte, nahmen die Vereinigten Staaten doch eine herausragende Position in der Weltwirtschaft ein: 1929 erzeugten sie fast die Hälfte der industriellen Güter und waren mit Abstand die größte Exportnation.
Neben dem Börsenkrach und dem Preisverfall auf den Rohstoffmärkten spielte beim Ausbruch der weltweiten Krise noch die zunehmend protektionistische Zollpolitik einiger Länder eine Rolle. Hier machten die USA mit dem Smoot-Hawley-Tarif 1930 den Anfang, der eine Welle von ähnlichen Zollerhöhungen in den Partnerländern zur Folge hatte. Diese Schutzzölle auf bestimmte Güter dämpften den Welthandel erheblich. Im Deutschen Reich entstanden beispielsweise Importpreise, die das Zweieinhalbfache des Weltmarktpreises betrugen. Der Krach selbst machte sich auf den internationalen Märkten als Wegfall der amerikanischen Nachfrage bemerkbar, wodurch die Preise international sanken. Daraus resultierten Produktionssenkungen und Arbeitslosigkeit.
Wirtschaftswissenschaftler
Zeitgenössische Erklärung
Die zeitgenössische Wirtschaftswissenschaft war nicht in der Lage die Depression zu erklären. Die Vorstellungen beruhten auf den zwei klassischen makroökonmischen Säulen, dem Sayschen Theorem nach dem jedes Angebot seine Nachfrage selbst schafft, und dem Glauben an die Selbstheilungskräfte des Marktes. Viele Wirtschaftswissenschaftler erklärten, dass man nur warten müsse, bis Löhne und Preise sich ausreichend anpassen und es dadurch wieder zu Vollbeschäftigung kommt. Im Regierungsapparat von Präsident Herbert Hoover und in der US-Notenbank (Federal Reserve) dienten einige „liquidationists“, welche der Ansicht waren, dass massenhafte Insolvenzen in Kauf genommen werden sollten. Die Depression wurde als wirtschaftliche Strafe für die spekulativen Exzesse der 1920er Jahre angesehen. Diese "Medizin" gelte es zu schlucken, dann werde alles wieder in Ordnung kommen. Finanzminister Andrew W. Mellon empfahl Präsident Hoover:
“Liquidate labor, liquidate stocks, liquidate the farmers, liquidate real estate... It will purge the rottenness out of the system. High cost of living and high living will come down. People will work harder, live a more moral life. Values will be adjusted, and enterprising people will pick up the wrecks from less competent people.“
„Arbeitsplätze abwickeln, Kapital liquidieren, die Landwirte abwickeln, Immobilien veräußern... Das wird die Fäulnis aus dem System spülen. Hohe Lebenshaltungskosten und ein hoher Lebensstandard werden sich anpassen. Die Menschen werden härter arbeiten und ein moralischeres Leben führen. Die Werte werden sich anpassen und unternehmungslustige Leute werden die Ruinen von weniger kompetenten Leute übernehmen.“
– Andrew W. Mellon
![]()
Joseph Schumpeter
Joseph Schumpeter sah die Weltwirtschaftskrise als historischen Unfall, in dem drei Konjunkturzyklen, der langfristige Kondratjew-Zyklus technischer Innovation, der mittelfristige Juglar-Zyklus und der kurzfristige Kitchin-Zyklus im Jahr 1929 gleichzeitig ihren Tiefststand erreichten. Schumpeter wird ebenfalls zu den Nichtinterventionisten bzw "liquidationists" gezählt. Österreichische Schule
Im Gegensatz zu den späteren keneysianischen und monetaristischen Erklärungen sahen Ökonomen der Österreichischen Schule in den 1920er Jahren eine starke Expansion der Geldmenge, also eine Inflation, woraus eine Fehlallokation von Kapital entstanden sei. Die Depression müsse daher als unvermeidliche Folge der negativen Effekte der falschen Expansion in den 1920er Jahren ausgestanden werden. Staatliche Intervention jeglicher Art wurde für falsch gehalten, weil sie die Depression nur verlängern und vertiefen würde. Während Autoren wie Randall E. Parker und J. Bradford DeLong die Österreichische Schule den "liquidationists" zuordnen und annehmen, dass diese die Politik von Präsident Hoover und der Federal Reserve im Sinne eines Nichtinterventionismus beeinflusst bzw. gestützt hat, vertritt Lawrence White die Ansicht, dass Friedrich August von Hayek die Passivität der Federal Reserve (anders als Murray Rothbard) in Anbetracht der Kontraktion der Geldmenge nicht befürwortet hatte, wenngleich er in der entscheidenden Phase Anfang der 1930er Jahre keine Handlungsemfehlung gegeben hatte.
John Maynard Keynes
Keynes hatte genau wie Hayek eine Wirtschaftskrise vorhergesehen. Hayek hatte allerdings auf Basis der Theorie der Österreichischen Schule die 1920er Jahre als eine (Kredit-) Inflationsperiode angesehen. Die Theorie dahinter war, dass aufgrund der gestiegenen Produktionseffizienz die Preise hätten fallen müssen. Folglich befürwortete Hayek eine kontraktive Geldpolitik der US-Notenbank um eine milde Deflation und Rezession zu initiieren, welche Gleichgewichtspreise wieder herstellen sollte. Sein Opponent Keynes widersprach dem. Im Juli 1928 erklärte er, dass es zwar Spekulationsblasen an der Börse gebe, der entscheidende Indikator für Inflation sei aber der Rohstoffindex und der habe keine Inflation angezeigt. In Anbetracht mehrerer Erhöhungen des Diskontsatzes durch die US-Notenbank warnte er im Oktober 1928, dass dass Risiko einer Deflation größer sei als das einer Inflation. Er erklärte, dass eine längere Hochzinsphase zu einer Depression führen könne. Die Spekulationsblasen an der Wall Street würden nur eine generelle Tendenz zur Unterinvestition der Unternehmen verdecken. Die längere Hochzinsphase führte nach Keynes Analyse dazu, dass mehr Geld gespart bzw. in rein spekulative Anlagen investiert wurde und weniger Geld in betriebliche Investitionen floß, denn einige Preise wie Löhne, Pachten und Mieten seien nach unten wenig flexibel, folglich würden hohe Zinsen zunächst nur die betrieblichen Gewinne reduzieren.
Als Antwort auf die Deflation befürwortete Keynes die Abkehr vom Goldstandard um eine expansive Geldpolitik zu ermöglichen. In seinem Tract on Monetary Reform von 1923 hatte er festgestellt, dass Schwankungen der Geldmenge Verteilungseffekte haben können, da einige Preise wie Löhne und Mieten „klebriger“ (weniger flexibel) sind als andere. Dies kann sich auf Wirtschaftswachstum und Beschäftigung auswirken. Deshalb forderte er, dass Zentralbanken eine Politik der Preisstabilität verfolgen sollten.
Die Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes erklärte die Länge und Schwere der Depression damit, dass Investitionsentscheidungen nicht nur von den Kosten der Finanzierung (Zinssatz), sondern auch von positiven Geschäftserwartungen abhängig sind. Demnach kann eine Situation eintreten, in der die Unternehmer so pessimistisch sind, dass sie auch bei extrem niedrigen Zinsen nicht investieren (Investitionsfalle). Die Unternehm...