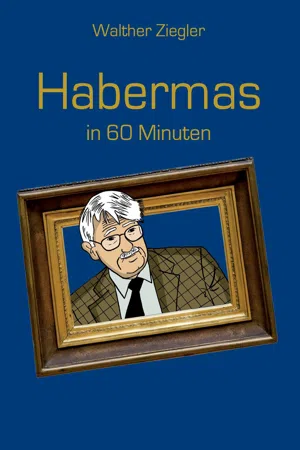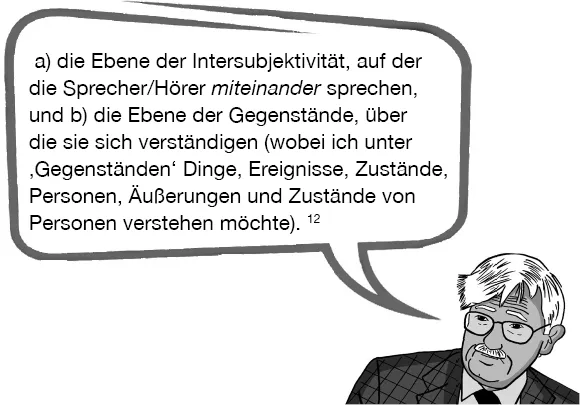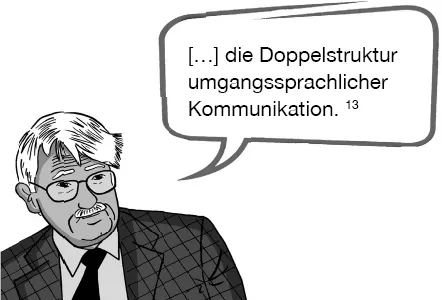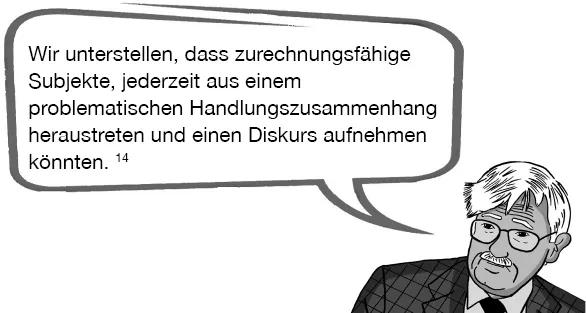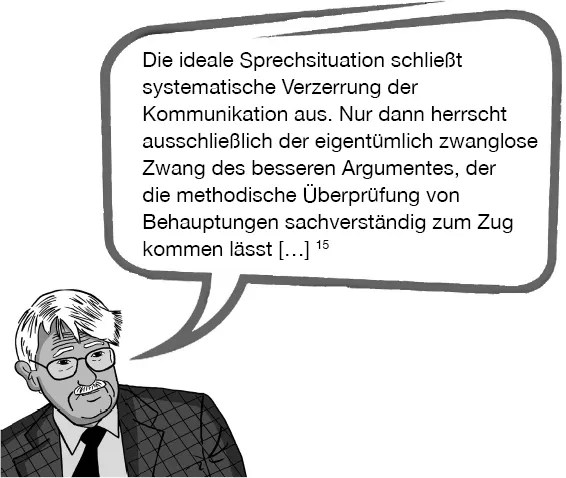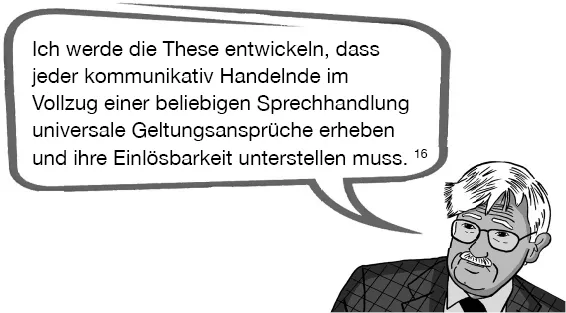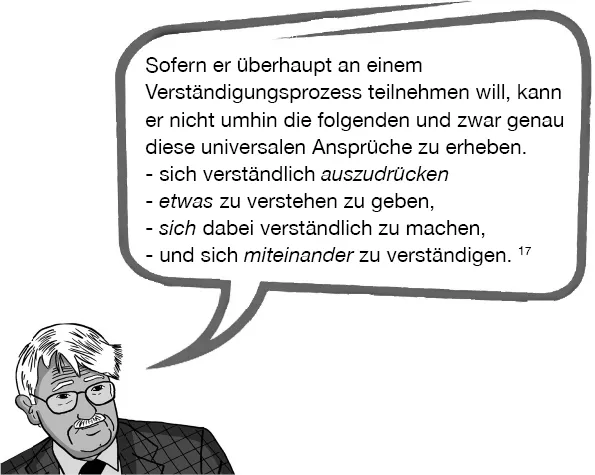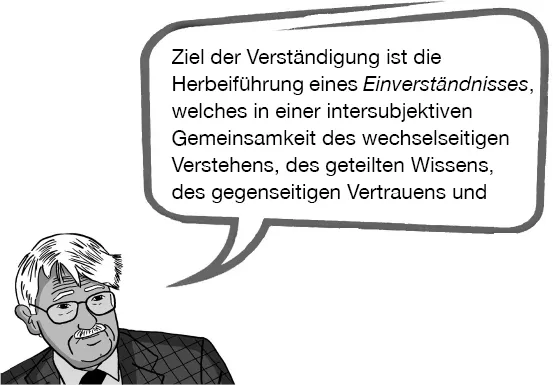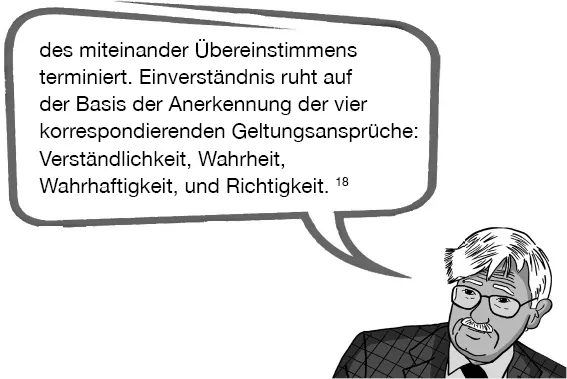![]()
Der Kerngedanke von Habermas
Die Doppelstruktur der menschlichen Sprache
Bereits vor der Ausarbeitung seines Hauptwerkes macht Habermas in einer Vorstudie eine interessante Entdeckung. Die sprachliche Verständigung, so Habermas, hat eine schillernde Doppelstruktur. Sie läuft gleichzeitig auf zwei verschiedenen Ebenen ab, der Inhaltsebene und der Beziehungsebene, wobei wir die zweite Ebene meistens übersehen oder nur unterschwellig wahrnehmen. Sie ist aber immer präsent. Denn, sobald wir als Sprecher und Hörer mit einem anderen Menschen ins Gespräch kommen, geht es keineswegs nur um das inhaltlich Gesagte, sondern gleichzeitig auch darum, wie wir es sagen und wie wir miteinander umgehen, also um die Beziehungsebene oder wie Habermas sagt, um die Dimension der ‚Intersubjektivität‘. Wir begeben uns automatisch auf die zwei folgenden Ebenen:
Das bedeutet, dass wir in jedem Gespräch einerseits miteinander reden, also zum Beispiel mit einem alten Freund, einem Kollegen, der Mutter, der Freundin oder einem Unbekannten, dem wir vielleicht sogar misstrauen und anderseits reden wir immer über irgendein Thema, über Fußball, Politik oder das Wetter. Wir unterhalten uns also stets ‚mit‘ jemand über ‚etwas‘, somit hat jedes Gespräch eine ‚Beziehungs-‘ und eine ‚Inhaltsebene‘.
Die beiden Ebenen sind in den Alltagsgesprächen in der Regel miteinander verwoben. In manchen Gesprächen werden auch gleich beide Ebenen, also die Beziehungs- und die Inhaltsebene direkt thematisiert. Wenn zum Beispiel ein Jugendlicher zu seiner Freundin am Handy sagt: „Ich schwöre dir, dass ich diesmal 100prozentig nicht zu spät komme und dich morgen echt pünktlich um 18 Uhr am Bahnhof abhole. Ich bin sogar 10 Minuten früher da.“, dann hat er auf der intersubjektiven Beziehungsebene seiner Freundin zu verstehen gegeben, dass sie ihm sehr wohl wichtig ist und er sie so sehr schätzt und liebt, dass er sich vorgenommen hat, sie diesmal nicht, wie in früheren Fällen, durch zu spät kommen zu enttäuschen. Auf der Inhaltsebene hat er nur gesagt, dass er sie morgen um 18 Uhr am Bahnhof vom Zug abholt. Das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen ergibt nach Habermas:
Diese Unterscheidung klingt zunächst völlig trivial, ist aber in manchen Gesprächssituationen folgenreicher als man denkt. Das kann man an einem ganz Habermas in 60 Minuten einfachen Beispiel sehen. Jeder von uns hat schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein Gespräch so richtig schief gegangen ist, obwohl es auf der Inhaltsebene eigentlich gar keine so großen Differenzen gab. Der Grund dafür, dass Gespräche manchmal aus dem Ruder laufen, liegt darin, dass der Austausch der inhaltlichen Argumente von einem unterschwelligen Konflikt auf der Beziehungsebene überschattet wird. Wir legen unser bewusstes Augenmerk in der Regel nur auf die Inhaltsebene, streiten uns verbissen über Details und wundern uns am Ende, dass es in der Sache zu keiner Verständigung gekommen ist, obwohl unsere Argumente doch eigentlich gut waren.
Wenn wir aber später in uns gehen, spüren wir ganz genau, warum das Gespräch gescheitert ist. Wir haben den anderen vielleicht beleidigt oder uns umgekehrt vom anderen beleidigt gefühlt. Und wenn sich erst mal einer von beiden oder beide Gesprächsteilnehmer auf der Beziehungsebene herabgesetzt fühlen, sind die Argumente auf der Inhaltsebene meist wirkungslos, da ohnehin keiner mehr dem anderen noch irgendetwas zugestehen will. Es wird dann zwar verbissen weiterargumentiert, aber natürlich vergebens, wenn der zu Grunde liegende Konflikt nicht thematisiert oder aufgelöst wird.
Interessanterweise aber, so Habermas, führen solche Erfahrungen gescheiterter Kommunikation keineswegs zu einer Resignation. Im Gegenteil – bei jedem neuen Gespräch gehen wir wieder optimistisch davon aus, dass eine echte Einigung im Prinzip möglich ist, dass wir uns also auf der Inhaltsebene jederzeit verständigen können ohne dass uns die Beziehungsebene dazwischenkommt. Wir unterstellen nämlich bewusst oder unbewusst immer, dass wir notfalls die Beziehungsebene thematisieren, die Bedürfnisse offen legen und dann auf der reinen Inhaltsebene weiterdiskutieren können, was in vielen Gesprächen ja auch gelingt. Habermas formuliert das so:
Einen Diskurs aufnehmen‘ bedeutet, dass wir aus etwaigen Verstrickungen und Problemen der Beziehungsebene ‚heraustreten‘ und dann in einer zwanglosen Atmosphäre auf der reinen Inhaltsebene unsere Argumente weiter austauschen und zu einer Einigung kommen. Unter ‚Diskurs‘ versteht Habermas also etwas anderes, als unter Alltagskommunikation. Der Diskurs stellt im Hinblick auf die Wahrheitsfindung eine qualitativ höhere Ebene dar. Ein Diskurs ist also im Unterschied zur Alltagskommunikation ein Gespräch, das eben nicht, oder nicht mehr, von unterschwelligen Beziehungsverwerfungen belastet oder verzerrt ist, sondern in einer bereinigten ‚idealen Sprechsituation‘ stattfindet:
Diese ‚ideale Sprechsituation‘, in der nur noch das ‚bessere Argument‘ zählt, ist aber keinesfalls eine Idealisierung oder irgendein utopisches Ziel, sondern nach Habermas eine Unterstellung, die wir hunderte Mal am Tag machen, und zwar immer dann, wenn wir zu sprechen beginnen. Wir verlassen uns nämlich auch in der Alltagskommunikation immer schon darauf, dass wir etwaige Konfliktfälle auf der Beziehungsebene notfalls thematisieren, ausblenden und damit auf die Diskursebene wechseln können. Letztlich, so Habermas, können wir gar nicht anders, als beim Sprechen automatisch zu unterstellen, dass das Gespräch zu einer echten Übereinkunft führen kann und unser diesbezüglicher Anspruch auch eingelöst wird:
Jeder Mensch, so Habermas, geht also immer wieder hartnäckig davon aus, dass sein Wunsch nach Verständigung eingelöst wird, auch wenn natürlich nicht alle Gespräche optimal verlaufen.
Die vier Geltungsansprüche und der hartnäckige Wunsch nach Verständigung
Und damit sind wir bereits beim Kerngedanken von Habermas. Wenn wir nämlich zu Beginn und während eines Gesprächs tatsächlich unterstellen bzw. den Anspruch erheben, dass wir uns im Prinzip mit dem anderen auch wirklich einigen können, dann stellt sich die Frage, was diese Unterstellung im Einzelnen bedeutet. Und genau das ist die große philosophische Entdeckung von Habermas. Er schaut mit dem Vergrößerungsglas des Sprachphilosophen und Kommunikationsforschers auf den Beginn einer jeden ‚beliebigen Sprechhandlung‘ und untersucht, welche Ansprüche die Gesprächsteilnehmer stellen, wenn sie zu reden beginnen, oder genauer gesagt, welche Ansprüche sie stellen müssen, damit ihr Reden sinnvoll ist. Und – so viel sei vorweggenommen – er entdeckt vier universale Geltungsansprüche, die jeder Mensch auf der ganzen Welt stellt und stellen muss, wenn er zu reden beginnt. Denn, so Habermas:
Habermas behauptet also, dass wir alle, sobald wir den Mund aufmachen und einen Satz sagen, automatisch genau diese vier von ihm entdeckten Ansprüche stellen.
Der erste Geltungsanspruch ist die Verständlichkeit. Es geht mir erst einmal darum, dass ich beim Reden auch verstanden werde. Ich gehe also bewusst oder unbewusst immer schon davon aus, dass es mir gelingt, so laut und deutlich in einer Grammatik und in hinreichend gut formulierten Sätzen zu sprechen, dass der andere eine Chance hat, mich generell zu verstehen, sonst würde ich ja gar nicht erst zu reden beginnen. Es wäre ja auch völlig sinnlos, nur kryptisch zu glucksen. Also lautet mein erster Geltungsanspruch: Ich will als einer gelten, der sich verständlich ausdrückt.
Der zweite Geltungsanspruch, den wir laut Habermas automatisch stellen, bezieht sich auf den Inhalt. Es geht mir nämlich immer auch darum etwas, also darum, irgendeinen Inhalt weiterzugeben. Ich gehe, wenn ich zu reden beginne, bewusst oder unbewusst davon aus, dass ich es schaffen kann, einen konkreten Inhalt, z.B. eine Meinung, eine Idee, einen Fakt, einen Sachverhalt, etc. wiederzugeben, den der andere als einen solchen erkennen kann, auch wenn er diesen Inhalt vielleicht nicht gut findet oder sogar kritisiert. Er weiß zumindest, was ich sagen wollte. Also lautet der zweite Geltungsanspruch: Ich will als einer gelten, der etwas zu sagen hat, der also etwas zu verstehen gibt.
Der dritte Geltungsanspruch bezieht sich auf meine Aufrichtigkeit oder wie Habermas selbst sagt, auf meine ‚Wahrhaftigkeit‘. Es geht mir nämlich bei jedem Gespräch bewusst oder unbewusst immer auch darum, dass das, was ich inhaltlich von mir gebe, auch dem entspricht, was ich wirklich meine und wozu ich stehe und innerlich verbindlich bin und nicht irgendetwas, an das ich selbst nicht glaube. Also lautet der dritte Geltungsanspruch: Ich will bewusst oder unbewusst, dass die anderen, wenn ich zu reden beginne, davon ausgehen, dass das, was ich sage auch aufrichtig und ehrlich von mir gemeint und nicht einfach nur dahin gesagt oder gar gelogen ist. Ich will als einer gelten, der wahrhaftig ist und sich ehrlich mitteilt.
Der vierte und letzte Geltungsanspruch bezieht sich, so Habermas, auf die ‚Richtigkeit‘ meiner Aussage, also auf die Korrektheit und allgemeine Gültigkeit dessen, was ich sage. Ich will nämlich bewusst oder unbewusst auch immer schon, dass das von mir Gesagte generell ‚wahr und richtig‘ ist. Damit ist der vierte und letzte Geltungsanspruch vielleicht der höchste oder anspruchsvollste. Ich wünsche mir nämlich am Ende nicht nur, dass das von mir Gesagte verständlich ausgedrückt ist (1. Geltungsanspruch), einen griffigen Inhalt hat (2. Geltungsanspruch) und von mir auch ehrlich so gemeint ist (3. Geltungsanspruch). Nein – ich will darüber hinaus auch noch, dass das Gesagte im Gespräch als ‚wahr und richtig‘ gelten kann und das bedeutet im Idealfall, dass alle anderen, mit denen ich rede, das von mir Gesagte gleichermaßen als ‚richtig bestätigen, mir zustimmen und die gemeinsam erkannte ‚Wahrheit‘ mit mir teilen, oder aber, falls sie aus ihrer Sicht der Dinge nicht zustimmen können, mit mir über den Wahrheitsgehalt so lange diskutieren, bis wir uns auf eine gemeinsame „Wahrheit“ einigen können. In jedem Fall aber lautet der vierte Geltungsanspruch: Ich will als einer gelten, der einen Vorschlag dazu macht, was ‚wahr und richtig ist und sich darüber mit den Vorschlägen der anderen, also mit dem, was diese für ‚wahr und richtig halten, verständigen und auf eine gemeinsame Wahrheit einigen kann.
In der Summe und in ihrem Zusammenspiel, zielen diese vier Geltungsansprüche, die wir in jedem Gespräch automatisch erheben, letztlich auf die Herbeiführung eines ‚Einverständnisses‘ ab. Denn, so Habermas:
Ziel der Verständigung ist die Herbeiführung eines Einverständnisses, welches in einer intersubjektiven Gemeinsamkeit des wechselseitigen Verstehens, des geteilten Wissens, des gegenseitigen Vertrauens und
Stimmt das? Hat Habermas Recht? Zielt wirklich jede „beliebige Sprechhandlung“ auf der ganzen Welt auf „wechselseitiges Verstehen, geteiltes Wissen, gegenseitiges Vertrauen und Übereinstimmung“ ab? Stellt also tatsächlich jeder Mensch, der zu sprechen beginnt vier und zwar genau diese vier...