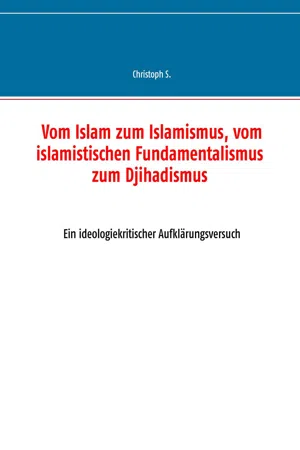![]()
Hauptteil
1. Der Islam
Die Zahl der Veröffentlichungen über den Islam ist Legion, so dass jedem interessierten Leser der Zugang zu dieser Religion leicht gemacht wird, die in Deutschland die drittstärkste Konfession bildet. Deshalb wird hier ein schon differenziertes Vorwissen über diesen weltumspannenden Glauben an einen Gott, Allah, einkalkuliert und nur eine erste zusammenfassende Darstellung vorangestellt. Die sich entwickelnde Problematik verlangt dann im Verlauf der Erörterung ein genaueres Eingehen auf einzelne zu erfragende Teilbereiche.
Deskriptiv (religionswissenschaftlich) gesehen, ist der Islam eine Schöpfung des Propheten Mohammed (geb. um 570 n. Chr.), der sich von Allah inspiriert glaubt, Gottes Wille den Menschen verkünden zu müssen. Mohammed lebt als Händler und Kaufmann in Mekka und lernt als Karawanenführer das Christentum und Judentum kennen; er selbst ist Anhänger des Polytheismus, der von den arabischen Stämmen praktiziert wird. Die Kaaba in Mekka, heute das höchste Heiligtum des Islam, genießt als religiöses Heiligtum bei vielen Polytheisten hohes Ansehen. Den vielen oft miteinander befehdeten Stämmen entsprechen auch verschiedene polytheistische Systeme, so dass Mohammed mit einer Fülle von Gottheiten, die sich oft auch noch befehden, in Berührung kommt. Er zieht sich, weil er sich als wahrer Gottsucher in dieser sich widersprechenden Götterwelt fühlt, in die Wüste zurück und meditiert.
Im Jahre 610 n. Chr. beginnt seine prophetische Phase; er nimmt in Gestalt des Engels Gabriel die Stimme seines, des einigen Gottes wahr, die ihm nach einem Einblick in den Ur-Koran die wahre Gotteslehre zumutet und auch den Auftrag, diese allen Menschen zu verkünden. Nach seinem Tod werden, da Mohammed selbst Analphabet ist, seine Visionen, die schon einzeln schriftlich fixiert worden sind, in dem „Buch“, im Koran zusammengefasst, leider nicht chronologisch, sondern nach Länge der Suren, die sich immer mehr verkürzen.
Der Islam kann sich auf zwei Quellen berufen; den Koran, das Worte Gottes, und das gottgefällige Leben des Propheten. Das in Arabisch, der ‚Sprache’ Gottes verfasste „Buch“, ist gemäß seiner als göttlich angenommenen Abkunft nicht in andere Sprachen übersetzbar, es ist die Wahrheit schlechthin, überzeitlich gültig, für jeden Muslim in allen Lebensbereichen verpflichtende Richtschnur. Der Korantext ist nach Willen Mohammeds das direkte Wort Gottes; er selbst ist nur „das Siegel der Propheten“ (33:40). Damit besteht der Koran, hermeneutisch gesehen, nur aus einem einschichtigen Text, dessen Wahrheit offen vorliegt und nicht aus Schichten verschiedener Wahrheitsstufen, so dass eine Tiefeninterpretation nicht nötig ist. Dieser Meinung wird von Hermeneutikern heftig widersprochen, weil sie beweisen können, dass der Koran an vielen Stellen sehr missverständliche und widersprüchliche Texte enthält, die ihren Grund nur in sich widersprechenden Hintergrundprämissen und historischen Einflüssen haben können. Deshalb soll der gläubige Anhänger des Islam (Ergebung in den Willen Gottes) den Koran nicht reflektieren, analysieren und interpretieren, sondern Gottes Wort in den gemeinten Sinne eins zu eins überführen. Und das geschieht am besten, wenn man den Text auswendig lernt.
Das gottgefällige Leben des Propheten, dem aber jede Göttlichkeit abgesprochen werden muss, bietet eine zweite Basis für die Lehren des Islam, denn dieses gottgeleitete Leben ist Vorbild für jeden Muslim, aber in seiner wahrheitsgeleiteten Stringenz unter den Koran einzuordnen. Aussprüche, Handlungen, Fragen, viele davon den Alltag betreffend, zu denen der Prophet Stellung bezogen hat, wurden von seiner Umgebung gesammelt und von den vier ersten Kalifen kommentiert. Neben der Schrift gibt es also eine kurze Tradition im Islam, in der diese Anweisungen gesammelt werden, deren Stellenwert meiner Ansicht nach viel zu hoch bewertet wird, da sie keine Gottesworte und vom Koran nicht autorisiert worden sind. Eine solche in sich geschlossene Anweisung wird Hadith genannt, von denen „bis zu einer Million [...] in sechs kanonischen Büchern zirkulieren“ (Barth 2003, 63), was eine nicht zu übersehende Fülle von Auslegungsvarianten zulässt, auch wenn nur etwa 9000 Hadithe anerkannt werden und zu vielfachem Anlass von Streitigkeiten innerhalb des Islam führen.
Im Augenblick scheint es so zu sein, als ob Mohammed ein höheres Ansehen als Gott bei den Muslimen genießt. Die in den Hadithen enthaltenen Anweisungen, die dort, wo der Koran keine Regelung vorgesehen hat, ihre Anwendungen finden, bilden zusammen mit dem Koran die Sunna, das, was gemäß dem Vorbild des Propheten „Brauch“ geworden ist.
Davon zu unterscheiden ist die Umma, die „Gemeinschaft aller Muslime“ (Tibi 2001, 30), wie sie Mohammed eingerichtet hat. Sie ist die inkorporierte Staatsidee des Islam und besagt, dass alle Muslime in einer staatlichen Gemeinschaft leben sollen. Oberhaupt eines solchen universalistischen Staates solle in der Nachfolge Mohammeds ein Kalif oder ein gerechter Imam sein. In der Moderne gibt es eine solche Umma nur als Utopie, weil nur islamische Nationalstaaten existieren, aber noch kein übergreifender Staatenverbund Wirklichkeit ist. Für den Islam aber ist die universalistische Idee einer Umma, einer „Weltmacht Islam“, (38) unterschwellig immer politisches Programm.
Es bleibt noch, die umstrittene Institution „Scharia“ vorzustellen, für viele Europäer ein negativ besetztes Reizwort. Er ist „der Sammelbegriff für islamische Lebensregeln, religiöse Pflichten und das religiös begründete, auf Offenbarung zurückgeführtes Recht des Islam“ (Barth 2003, 67). Auch regionale Modifikationen oder frauenfeindliche Lebens- und Bekleidungsvorschriften haben in diesem das ganze Leben des Muslims umfassende, religiös legitimierten Gesetzeswerk Eingang gefunden. Mohammeds Herabstufung der Frau in die zweite Reihe hat einen machohaften Männlichkeitswahn gefördert, den wir häufig bei jungen Türken und Jugendlichen anderer muslimischen Staaten wahrnehmen. Frauenrechte sind im Laufe der Geschichte des Islam immer stärker reduziert worden. Zu einem Existenzproblem wird, wenn andersgläubigen Minderheiten die Scharia aufgezwungen wird. Sie ist die Summe aus Koran, Sunna, Hadithen, Konsens und Analogieschluss. Wir haben hier ein umfassendes Rechtssystem, welches das gesamte menschliche Leben umschließt; es ist total, weil es alle Lebensbereiche regelt, damit eine große Lebenssicherheit vermittelt, es ist totalitär für diejenigen, die die Scharia als Bevormundung wahrnehmen.
Damit gibt es im Islam eine stufenförmig zu denkende Wahrheitspyramide. An der Spitze stehen Gott und der Koran; es folgen die Aussprüche Mohammeds, die Hadithe, zusammengefasst in der Sunna, der Analogieschluss, in dem Fragen, die nicht explizit im Koran und den Hadithen aufgeführt und gelöst worden sind, gemäß Ähnlichkeit mit ihnen entschieden werden, und der Konsens, die übereinstimmende Meinung von islamischen Theologen, der als Fatwa gutachterliches Ansehen genießt. Die Scharia umfasst alle diese Stufen insoweit, wie in sie Regelungen der vier Rechtsquellen eingeflossen sind.
Das Glaubensgut des Islam, in das Christliches, Jüdisches und Polytheistisches assimilierend aufgenommen worden sind, kann in zwei Bereiche gegliedert werden, Glaubensinhalte und Glaubenspraktiken.
Unverzichtbare Glaubensinhalte sind „die Einheit Gottes (monolithischer Monotheismus), die Macht der Engel, die Offenbarung, das Prophetentum, die Existenz des jenseitigen Lebens und der Glauben an die Vorherbestimmung“ (76). Als die fünf Säulen des Islam gelten die Glaubenspraktiken: das Glaubensbekenntnis, das fünfmal abzuleistende Tagesgebet, das Almosengeben, das Fasten und die Pilgerfahrt, die Hadsch.
Ehe jetzt die These ‚Der Islam besitzt ein implizites Ideologiepotential, das besonders leicht aktivierbar ist und als Islamismus heute den Islam und seine politischen Grundlinien bestimmt’, geprüft werden kann, ist eine eigene Standortbestimmung notwendig, die auf anthropologischer Grundlage beruht, weil nämlich der Begriff „Ideologie“ gemäß der Theorie Tepes zu der dem Menschen eigentlich konstituierenden Bestimmung seines Wesens wird. Seine Definition des Menschen als „illusionsanfälliges Tier“ (1988, 7) ist wegen ihrer zunächst befremdlich anmutenden Begriffswahl erklärungsbedürftig.
![]()
2. Darstellung des eigenen ideologiefunktionellen Standpunktes aus Sicht der Kulturanthropologie im Vergleich zum islamischen Menschenbild
Zwischen dem islamischen Menschenbild, das im Koran niedergelegt ist, und dem der wissenschaftlichen Kulturanthropologie bestehen, wie nicht anders zu erwarten, fundamentale Unterschiede, die sich in den letzten Jahrzehnten noch verschärft haben, weil eine muslimische Immigration nach Europa eingesetzt hat, die statt zu Assimilation zu Parallelgesellschaften geführt hat. Die räumliche Nähe hat beide Wertsysteme also nicht zusammengeführt, sondern immer mehr voneinander entfremdet.
Durch das Satellitenfernsehen sind die Moslems täglich mit ihrer Heimat verbunden und nehmen die sie umgebende Wirklichkeit hauptsächlich aus dieser Perspektive wahr. Sie sind „mit ihrem Kopf in der Heimat, mit ihrem Körper in Deutschland“; doch dadurch, dass diese unterschiedlichen Wertsysteme ständig mehr auseinanderdriften, drohen sie die persönliche Identität der Muslime und die der politischen Identität der Einwandererstaaten zu zerreißen. Den Unterschied zwischen dem Menschenbild der Kulturanthropologie und dem des Korans gilt es jetzt, namhaft zu machen.
2.1 Kulturanthropologische Prämissen
Nach dieser Theorie ist der Mensch kein Wesen, das von Gott sicher durch diese Welt geleitet wird, er ist ein instinktreduziertes Wesen mit offenen genetischen Programmen, die Lernen ermöglichen. Das Tier ist durch AAMs (Angeborene Auslösende Mechanismen) a priori an seine Welt angepasst, die wenig Modifikationsspielraum zulassen. Das Instinktrepertoire eines Lebewesens, ein genetisch verankertes Vorwissen für charakteristische Aktionen und Reaktionen, passt dieses im Voraus so seinem Lebensraum an, dass es überleben kann.
Doch bei der Evolution des Menschen hat eine Instinktreduktion stattgefunden; das in den Genen gespeicherte antizipierende Wissen von der Außenwelt besteht teilweise nur noch in offenen Lernprogrammen. Während AAMs, etwa ‚Feindbilder’, die zur Flucht nötigen, nur sehr selektiv und attrappenhaft ansprechen, haben sich beim Menschen sehr stark erweiterte Formen der Wissensantizipation entwickelt, die von Kant entdeckten und von Lorenz (1997) naturhistorisch gedeuteten Kategorien, die gleichsam Regeln der Gegenstandserkennung enthalten, und zwar a priori. Was ein möglicher Gegenstand der Erfahrung sein kann, wird vom Menschen schon im Voraus gewusst, und in jedem konkreten gedachten Gegenstand sind die Anschauungsformen Raum und Zeit wie auch die Kategorien Quantität, Qualität, Relation, Modalität mitrepräsentiert. Sie arbeiten, indem sie vorgängig ein Ordnungssystem antizipieren, durch das die einströmende Datenmenge strukturiert wird. Dadurch wird der Mensch ein „weltoffenes Tier“ (Tepe), das unendlich viele mögliche Gegenstände wahrnehmen, beschreiben und entsprechend auf sie reagieren kann. Doch diese Evolution hin zur Flexibilität und gleichzeitiger Abstreifung der instinktgeleiteten Verhaltensweisen muss der Mensch mit Entlassung aus der Sicherheit dieses schützenden Schirmes und Schildes bezahlen.
Damit bekommt er ein Problem: Er ist, paradox gesprochen, gezwungen, frei zu sein. (Es ist kein Gegenargument, dass viele Menschen diese Freiheit zugunsten von institutionellen Sicherheiten aufgeben und sich unter deren Schutz begeben. Religionen z.B. bieten dem Verunsicherten das Gefühl der eigenen Sicherheit.) Seine Selbsterkenntnis lässt ihn unablässig spüren, dass er ein ständig gefährdetes, ständig leidumdrohtes, sterbliches Wesen ist, da es keine leitenden Instinktprogramme mehr gibt. „Realitäts- und Leidensdruck“ (Tepe / Topitsch) hemmen jede Lebensbewältigung. Jetzt helfen ihm auch die offenen Lernprogramme nichts; denn wozu soll der Mensch etwas lernen?
Er ist zuvörderst gezwungen, sich einen Instinktersatz zu schaffen, der ihm die lebensnotwendige Sicherheit seines Lebensvollzuges garantiert. Dieser ist notwendig, denn der Normalmensch ist kein Romulus und Remus und auch kein Robinson, die in Isolation aufwachsen können, sondern ein Wesen, das in Kultur eingebettet ist. Der Mensch ist ein „Kulturwesen von seiner Natur her“ (Gehlen / Lorenz), d.h. eine menschliche Natur als Artbestimmung gibt es nicht, was einer gemeinsamen biologischen Grundausstattung nicht widerspricht, weil seine ‚Natur’ in der notwendigen Aufnahme von Kultur besteht, so dass er ein von der Kultur zum zweiten Male erschaffenes Wesen wird, das selbst wieder Kultur hervorbringen kann, die sich in einer unüberschaubaren Vielfalt präsentiert.
Diese Kultur begegnet dem Menschen in einer unübersehbaren Fülle von Entwürfen, bedeutet aber durch „Institutionalisierung“ (Gehlen) Stabilisierung seiner Bedürfnisse. Sie erfüllt ähnliche Aufgaben wie der Instinkt: der Mensch wird in eine bestimmte Kultur hineingeboren, deren Aprioris und Werte er assimiliert. Staatliche und gesellschaftliche Institutionen, durch Tradition, Sanktionen und Moral festgeschriebene Regeln des Zusammenlebens, mythische und religiöse Bräuche, gemeinsame Sprache und gemeinsame Vergangenheit sind der Kitt, der jetzt einen sinnerfüllten Lebensvollzug ermöglicht. Man kann deshalb sogar von einem metaphysischen Bedürfnis des Menschen nach ewig geltenden Werten sprechen; doch die menschliche Geschichte besteht im Gegenteil aus einer Abfolge sich ablösender Wertsysteme. Während die drei Grundverhaltensweisen Kognition, Emotion und Willen das tierische Leben als Verhalten, als Einheit von Wissen, Fühlen und Handlungsbereitschaft gestalten, haben sich diese Vermögen beim Menschen differenziert. Das Gehirn als Überlebensorgan ist evolutiv zusätzlich zum Erkenntnisorgan geworden, das relativ unabhängig von Gefühlen und persönlichen Interessenlagen urteilen kann. Im Wissenserwerb steckt also Objektivität, es (das Wissen) kann nicht ganz falsch sein, obwohl es verschiedenen kulturellen und persönlichen Quellen entspringt; denn Leben braucht Sicherheit. Unsere Ratio ist, so die realistische Prämisse, fähig, die Realität, wenn auch in bescheidenem Maß, abzubilden.
Was den Menschen durch den „objektiven Geist“ (Hegel), Kultur genannt, sehr lange verborgen bleibt, ist, dass dieser in Wirklichkeit nur ein Produkt des „subjektiven Geistes“ ist, Produkt des menschlichen Geistesschaffens, das mit ihm entsteht, sich wandelt und vergeht. Solange, wie Mythisches und Religiöses als ewig Dauerndes zusammen mit einer dazu passenden lebensnahen Rationalität der Wahrnehmung der Natur als Realität aufgefasst werden, ist eine psychische Existenzgrundsicherung gegeben, die jedoch schon ins Wanken gerät, als Mythen und Religionen sich verschriftlichen und damit eine hermeneutische Befragung nach ihrem Wahrheitsgehalt zulassen müssen. Sie sind – so das Ergebnis der Befragung – keine Objektivationen des Göttlichen oder Geistigen, sondern nur noch Symbole einer vorher gelebten Wirklichkeit, die nun zur Fiktion wird. Sie sind nur lebensnotwendige Täuschungen (falls sie einen objektiven Wahrheitsanspruch anmelden), sie ermöglichen ein persönlich erfülltes und sozial getragenes Leben dem, der glaubt, so dass Tepe vom Menschen als dem ideologieverfallenen Wesen sprechen kann, dessen anthropologische Konstante die Angewiesenheit auf essentialisierte Illusionen (kulturbewahrende Institutionen) beschreibt.
Man kann es eine Tragödie nennen, dass die Untersuchung der mythischen und religiösen Wertsysteme den naiven Glauben an die Wahrheit der Identität stiftenden Symbolwelt zerstört hat. Es stellte sich nämlich bald heraus, dass diese ontologischen Entwürfe nicht stimmen, dass sie kollektive Projektionen des menschlichen Wollens sind, damit das, was im Mensc...