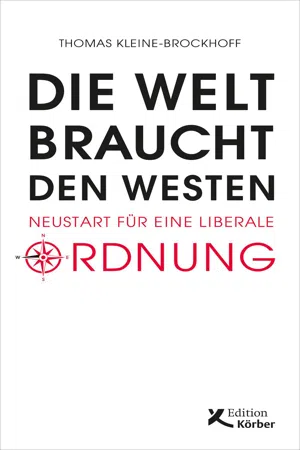
- 208 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die USA sind verloren, der Westen ist tot, die internationale Ordnung am Ende – Untergangsprognosen haben Konjunktur. Doch wer so argumentiert, ergibt sich kampflos dem nationalistischen Zeitgeist, meint Thomas Kleine-Brockhoff. Statt zu jammern, sollten die Verteidiger der liberalen Demokratie lieber in die Offensive gehen. Der Berliner Politikberater stellt deshalb das Prinzip des robusten Liberalismus vor, um Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit des Westens wiederherzustellen.
Klar benennt Kleine-Brockhoff die Fehler des Westens nach 1989 und fordert eine Abkehr von der missionarischen Idee, die ganze Welt müsse die westliche Ordnung annehmen. Stattdessen wirbt er für einen zurückhaltenden und realistischen Liberalismus, der seinen Idealen einfacher treu bleiben, seine Regeln besser befolgen und sie erfolgreicher verteidigen kann. Was das konkret bedeutet, zeigt Kleine- Brockhoff anschaulich an drei drängenden Fragen unserer Zeit: dem Schutz von Flüchtlingen, der humanitären Intervention und dem Handel mit China.
Dieses Buch ist ein Mutmacher für die Freunde der Freiheit und die Kräfte der Mitte. Der vielgescholtene Westen und seine Ideale – sie werden noch gebraucht.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Welt braucht den Westen von Thomas Kleine-Brockhoff im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & International Relations. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1.Wider den neuen Fatalismus
Ein Vierteljahrhundert lang war die Einschätzung verbreitet, die Demokratie habe mit der Zeitenwende von 1990 einen historischen Sieg errungen, der weltweit in ein Zeitalter der liberalen Demokratie münden werde. In westlichen Gesellschaften zählte die selbstgewisse, ja, triumphalistische Erzählung vom unausweichlichen Fortgang der Geschichte zum politischen Katechismus. Wie alle erfolgreichen Narrative erfasste sie wichtige Elemente der Wirklichkeit und übersah dafür andere – oder ließ sie einfach weg. Diese selektive Wahrnehmung sorgte auf dem Marktplatz der Meinungen zunächst für eine gewisse Ordnung. Über die Jahre führte sie aber dazu, dass die Erzählung vom demokratischen Zeitalter ein zunehmend ungeeigneter Rahmen für die Erfassung der Wirklichkeit wurde.3
Heute droht eine ähnliche Gefahr: dass der Glaube an einen demokratischen Determinismus vom Glauben an einen populistischen Determinismus abgelöst wird. Dieses Denken sieht den neumächtigen Populismus (in seiner rechtsgewirkten Variante) auf einem nicht zu stoppenden Siegeszug. Der Populismus drohe, das politische Leben in den entwickelten Industriestaaten auf Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte zu dominieren. In dieser Lesart wurzelt der Populismus in übersehenen oder unterschätzten Kräften, die auf Jahre Wirkung entfalten und die Amtszeiten einzelner Politiker überdauern würden. Deshalb sei auch die mögliche Abwahl von Führungspersonen (etwa US-Präsident Donald Trump) letztlich nicht wirkmächtig, weil ihre Nachfolger ähnlichen Grundströmungen im Wahlvolk ausgesetzt seien. Also quasi vom Ende der Geschichte zum ewigen Populismus.4
Außenpolitisch rechnet dieses lineare Denken mit dem Ende des Westens, dem Tod der NATO und dem Zerfall der liberalen internationalen Ordnung. Aus den Vereinigten Staaten sieht diese Denkrichtung auf lange Sicht nichts Gutes kommen, jedenfalls keinen Multilateralismus, keine Bündnisorientierung, keinen Pro-Europäismus. Und sollte die populistische Welle doch irgendwann abebben, sei in den internationalen Beziehungen nichts mehr wie zuvor.
Weil die neuen Fatalisten dem Nationalismus auf Jahre Durchsetzungsmacht zuschreiben, nennen sie jene gern »Nostalgiker«5 (oder »Dinosaurier« oder »Transatlantiker«), die an der Unausweichlichkeit eines populistischen Zeitalters zweifeln, eher auf die Anpassungs- und Reformfähigkeit der heutigen Ordnung und ihrer Institutionen setzen und deshalb rufen: »Nicht so schnell!«
Wie jedes lineare Denken führt die einfache Fortschreibung von Trends zum Ausblenden gegenläufiger Tendenzen. In der Analyse der neuen Fatalisten taucht kaum auf, dass der Nationalismus überall in den westlichen Gesellschaften die Opposition, die ihn zu Fall bringen könnte, – wie Antikörper – selbst erzeugt. Krisen des Nationalismus, schon gar nicht sein krachendes Scheitern, besonders das des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump – das alles sieht die Kontinuitätsthese nicht vor und damit auch nicht das mögliche Abwenden vieler seiner Wähler. Aus den realen Krisensymptomen der Gegenwart können die Fatalisten nichts anderes ableiten als das Ende des Westens und seiner Ordnung, und das in naher Zukunft. Mit Krisenbewältigung oder einem Übergang zu einem neuen, zeitgemäßen Gleichgewicht in angepassten Strukturen rechnet der linear geprägte Zeitgeist nicht. Damit unterschätzt er die Widerstandsfähigkeit, die Reform- und Wandlungsfähigkeit von Institutionen, die sich aus der Selbstheilungskraft der Demokratie speisen. Und er übersieht, dass der Anpassungsprozess liberaler Ordnungselemente vielerorts längst begonnen hat.
So drehen die Alarmisten die Analysespirale immer weiter und produzieren immer extremere Untergangsphantasien – als sei »Hau den Lukas« ein intellektueller Sport.6 Es scheint, als wollten die Analysten ihre Irrtümer der Vergangenheit wettmachen. Das Unvermögen, den Brexit, die Wahl Donald Trumps und damit die ganze populistische Welle vorherzusehen, wollen sie nun offenbar überkompensieren, indem sie alles für möglich und den jeweils radikalsten Ausgang für den wahrscheinlichsten halten. Zu beobachten ist ein prognostischer Immerschlimmerismus. Und die populären Sachbücher unserer Tage tragen Titel wie »Über Tyrannei«, »Der Weg in die Unfreiheit« oder auch »Wie Demokratien sterben«.
Weil dramatische Einschätzungen drastische Konsequenzen erfordern, rechnen die Fatalisten mit sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Sie schreiben dem neuen Nationalismus Prägekraft über nicht weniger als ein ganzes Zeitalter zu, statt mit der Verunsicherung und der Prognoseungewissheit zu leben, die die gegenwärtige Übergangszeit mit sich bringt.
In solchen Phasen gilt es, sich nicht der Verführungskraft des Kulturpessimismus zu ergeben. Davor hat der Historiker Fritz Stern bereits vor 40 Jahren gewarnt. Er mahnte, sich nicht in endlosen Jeremiaden über den angeblich bevorstehenden Niedergang des eigenen Landes, des eigenen Kontinents, ja, der ganzen Idee des Westens zu ergehen. Wenn nämlich Kulturpessimismus umschlägt in kulturelle Verzweiflung, so sagt uns Fritz Stern, dann singt so mancher in seiner großen Verstimmung über die Moderne »Rhapsodien der Irrationalität«.7 Daraus könne leicht eine zerstörerische politische Kraft werden.
Das Menschengeschlecht hat schon immer Transformationsphasen durchlebt – und überwunden. Schon immer wurde es von bedrohlich erscheinenden Veränderungen aus Perioden eines relativ widerspruchsfreien und identitätssicheren Lebens herausgerissen – etwa während der industriellen Revolution oder der kopernikanischen Wende, die einen Grad an Entwurzelung und Entheimatung produzierten, der heute nur noch schwer nachvollziehbar ist.
Phasen von existenzieller Geborgenheit sind weltgeschichtlich nur flüchtige Sequenzen. Eine solche Periode von Stabilität und Selbstgewissheit hat die westliche Welt in den vergangenen Jahrzehnten erlebt – und darüber beinahe schon vergessen, dass, wie Ian Kershaw in seiner großen Geschichte des Nachkriegseuropa schreibt, »Unsicherheit ein Kennzeichen des modernen Lebens« bleiben wird.8
In diesem nüchternen Geist will die vorliegende Streitschrift darauf verzichten, ein weiteres Bedrohungsszenario für das fraglos fragil gewordene Gebäude der liberalen internationalen Ordnung vorzulegen. Vielmehr soll es um die Grenzen all der Untergangsszenarien gehen, um die Haltelinien. Die Frage lautet: Was bleibt? Was muss bleiben? Was liefert Stabilität im gegenwärtigen Wirbel aus Veränderungen? Wie kann eine Anpassungsstrategie an veränderte Umstände aussehen?
Denn es ist keineswegs ausgemacht, dass der Westen todgeweiht ist. Zwar steht sein normatives Projekt unter Beschuss. Aber zugleich wächst eine neue Verbundenheit mit der alten Idee des politischen Westens heran. Und zwar weil die Alternative so furchteinflößend ist, die von den rechten Kulturrelativisten präsentiert wird: der civilisation state9, der mehr sein will als eine Staatsnation, der eine scheinbar festgefügte Zivilisation umfassen soll und der – in seiner gegenwärtig auf der äußersten Rechten populären Variante – weiß, fremdenfeindlich, religiös intolerant und sich nach außen abschottend ist.
Dabei ist keineswegs schon entschieden, dass die liberale internationale Ordnung gänzlich zerfällt. Zwar leiden die Nachkriegsinstitutionen an Auszehrung. Es mag auch sein, dass es künftig wieder einen Wettbewerb unterschiedlicher Ordnungsmodelle geben wird und die westlich geprägte Teilordnung weniger global, weniger integriert und weniger liberal sein wird. Aber solange die Zahl der Probleme wächst, die nur über Staatsgrenzen hinweg gelöst werden können, bleibt ordnender Multilateralismus die plausible Antwort.
Auch ist keineswegs gewiss, dass Amerika für die Idee eines westlichen Bündnisses und multilateraler Bindungen verloren zu geben wäre. Zwar kann sich die Politik des gegenwärtigen US-Präsidenten auf verbreitete Interventionsmüdigkeit und Globalisierungskritik in der Bevölkerung stützen. Darin liegt aber kein Wählerauftrag zur Zerstörung der NATO und der gesamten liberalen Ordnung.10 Nicht die Ewigkeitsannahme national-imperialer Außenpolitik sollte den Umgang mit den Vereinigten Staaten prägen, sondern die Erwartung von Erschütterungen, die sich aus dem denkbaren Scheitern dieser Außenpolitik ergeben.
Statt in Selbstmitleid zu baden und die Unabwendbarkeit einer antiliberalen Ära zu beklagen, sollten die Kräfte der demokratischen Mitte besser heute als morgen darangehen, ein Konzept für die Reform der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Die Welt braucht dazu den Westen, einen erneuerten Westen. Es gilt, Abschied zu nehmen von der Vorstellung des demokratischen Weltfriedens und den Realitäten einer Welt ins Auge zu schauen, die geprägt ist von Machtkonkurrenz. Ein realistischeres Bild der Wirklichkeit wird es ermöglichen, die Grundlagen internationaler Zusammenarbeit konzeptionell zu überarbeiten. Es gilt, die wichtigsten Herausforderungen zusammenhängend zu betrachten: Sicherheit und Verteidigung, Finanzmarkt und Währungsunion, Freihandel und grenzüberschreitende Steuerpolitik, Migration und Flucht. Mit einer großen und zusammenhängenden Reformanstrengung lässt sich neues Vertrauen für die Idee erwerben, dass gegenseitige Abhängigkeit in der Welt nicht Unsicherheit und Kontrollverlust für den Einzelnen bedeutet, sondern die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die sonst unlösbar blieben.
Dieses Konzept zur Erneuerung der freiheitlichen Ordnung hat einen Namen: robuster Liberalismus. Es denkt den Westen neu, indem es sehr wohl auf den Prinzipien der Freiheitlichkeit besteht, zugleich aber die liberale Überdehnung beendet und den demokratischen Bekehrungseifer einhegt. Robuster Liberalismus setzt auf einen Universalismus, der weniger verspricht und mehr hält. Er zieht gerade aus der Selbstbegrenzung sein Selbstbewusstsein und seine Überzeugungskraft. In einem zunehmend spannungsgeladenen Umfeld stattet er sich mit stabilen Institutionen, soliden Regeln und Instrumenten zur Selbstverteidigung aus.
Neonationalismus ist kein Schicksal und muss kein Ewigkeitsphänomen sein. Wer dessen politisches Momentum brechen will, muss aber Alternativen anbieten. Robuster Liberalismus ist diese Alternative. Es ist ein Projekt der Mitte für eine Politik der Mitte. Es verbindet Erneuerung mit Moderation und Bescheidenheit mit Prinzipientreue.
2.Um den Westen kämpfen
Ohne Zweifel befindet sich der Westen in einer Krise.11 Hie und da wird im Debattengetümmel bereits das Totenglöckchen geläutet. Manche sehen am Horizont schon »die Morgenröte einer anbrechenden Post-West-Ära« aufscheinen, beobachtet Gernot Erler, der frühere Staatsminister im Auswärtigen Amt.12 Wer den Westen mit seinen gegenwärtigen Institutionen gleichsetzt, dem ist der Endzeitton zu verzeihen, denn der Bedeutungsverlust dieser Institutionen ist schwer zu übersehen.13
Nun ist aber schon die Begriffsdefinition Teil langjähriger Deutungskämpfe, und es gibt bis heute verschiedene Vorstellungen vom Westen, weshalb es sich empfiehlt, von Traueranzeigen zunächst abzusehen. Im Gegenteil: Wer genau hinsieht, wird bemerken, dass der Bedeutungsverlust von Institutionen nicht der einzige beobachtbare Trend ist. Denn zugleich hat ein neuer Kampf um den Westen begonnen, um dessen Wesen und Zukunft.
Stark vereinfacht lassen sich vier Definitionen des Westens unterscheiden: Da ist erstens der Westen als Synonym für eine historisch gewachsene Kulturgemeinschaft, die auf christlichem oder jüdisch-christlichem Erbe fußt. Dann gibt es zweitens eine rassistische Deutung, die den Westen über das Weißsein definiert. Drittens steht der Westen für die moderne Zivilisation, also für die Gemeinschaft der entwickelten und technologisch führenden Länder. Und viertens lässt sich der Westen als eine politische Gemeinschaft liberaler Demokratien beschreiben.14
Letztere, also die politische Definition, wurde erst während des Kalten Krieges prägend. Und vollends durchgesetzt hat sie sich (gegen die Konkurrenz der technologischen, der rassistischen und der kulturalistischen Definition) erst nach dem Ende der Sowjetunion.15 Dieser politische Westen ist nicht eine bloße Staatengemeinschaft, sondern eine Idee, ein normatives Projekt, das auf die Ideenwelt der Aufklärung zurückgeht.16 Seinen ersten Auftritt hatte der politische Westen während der atlantischen Revolutionen von 1776 und 1789, mit der Grundrechteerklärung von Virginia und der französischen Menschen- und Bürgerrechtserklärung. Der Westen beruht somit auf Prinzipien, die diese Revolutionen etabliert haben: unveräußerliche Menschenrechte, Herrschaft des Rechts, Gewaltenteilung und repräsentative Demokratie. Der Westen – das sind letztlich politische Werte mit universalistischem Kern. Die westlichen Demokratien sind der Versuch einer Institutionalisierung dieser aufklärerischen Grundwerte. Die Institutionen mögen sich wandeln, der Wertekern nicht.
Dieses Verständnis des Westens, wiewohl prägend, stand zugleich immer schon in der Kritik. Da gibt es jene, die unterstellen, der Westen sei im Grunde bis heute nichts anderes als ein exklusiver, andere ausschließender Club. Dabei ist der heutige Westen, auch wenn er von Anrainern des Atlantiks gegründet wurde, gerade keine geografische, sondern eine politische Standortbestimmung. Er ist offen für alle, die seine Werte teilen, leben und schützen. Man findet den Westen überall dort, wo der Schutz der Menschenrechte und die Freiheit des Individuums als Kernelemente der staatlichen Legitimation gelten. Westen beschreibt eine Herkunft, keine Mitgliederbeschränkung. Wer den politischen Westen plausibel kritisieren will, sollte ihm deshalb nicht seine angebliche Geschlossenheit, sondern im Gegenteil gerade seine Offenheit vorhalten. Aus seinem Universalismus lassen sich viel plausibler expansionistische Gelüste konstruieren.
Letztlich haben aber die Anwürfe jener mehr Einfluss, die dem Westen Doppelzüngigkeit vorwerfen. Diese Kritiker behaupten, das Konzept des Westens sei bloß eine in hübsche Worte verpackte Form von Heuchelei. Die wohlklingende Rede von den westlichen Werten sei nichts als eine ideologische Überhöhung egoistischer Interessen atlantischer Nationen.
Es stimmt ja: Widersprüche gibt es, und zwar seit dem 18. Jahrhundert. Thomas Jefferson war (Ko-)Autor jener Menschenrechtsrhetorik, auf die wir uns heute gern berufen; zugleich aber Sklavenhalter. Das Preußen Immanuel Kants war zwar Heimat aufklärerischer Ideen, die Eingang in den westlichen Kanon fanden; zugleich ist Deutschland aber jenes Land, das wie kein anderes Widerstand leistete gegen die politischen Konsequenzen der Aufklärung, gipfelnd in der rassistisch motivierten Massenvernichtung von Juden. Und der Gebrauch der Folter in amerikanischen Gefängnissen und ihre Beschönigung als »verbesserte Verhörtechniken« gehört zu jenen Unentschuldbarkeiten, die den Weg in die gegenwärtige Krise des Westens ebneten.
Ein gewisses Maß an Scheinheiligkeit gehört zu jedem universalistischen Projekt dazu, wie der bulgarische Intellektuelle Ivan Krăstev nachzeichnet. Allerdings hat die antiwestliche Kritik inzwischen Scheinheiligkeit als »Achillesferse der westlich dominierten liberalen Ordnung« ausgemacht.17 Dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, unterscheidet den Westen aber allenfalls von solchen politischen Projekten, die einen Anspruch an sich selbst gar nicht erst formulieren. Wo reiner Machtzynismus regiert, stehen keine universalistischen Ideale, kein Wille zur Wahrheit und kein Bekenntnis zur Selbstkritik im Weg. Das Projekt des Westens war von Anfang an auch ein Prozess des Westens, eine Zielsetzung und eine Beschreibung des Weges zur Integration aufklärerischer Werte in die Politik. Dieser Anspruch dient als Korrektiv der Regierungspraxis, und das Korrektiv ist entscheidend für den Wert des Anspruchs. Was der Westen beanspruchen darf zu sein, das entscheidet sich im Umgang mit den eigenen Verfehlungen. Zwar wird der Westen ewig unvollendet bleiben. Nicht auszudenken allerdings, gäbe es die Ideale des Westens erst gar nicht.
Nur darf die Abweichung der normativen Prämissen von der politischen Praxis nicht dauerhaft und nicht gravierend sein. Sonst erodiert die Unterstützung in den westlichen Ländern, und die Kulturrelativisten haben neuen Anlass, die Heuchelei-Keule zu schwingen. Die neuen, rechtsgewirkten Relativisten wollen den Westen ohnehin lieber kulturell definieren oder rassistisch, was in der Form ihres offen aggressiven Bekenntnisses eine Art Wiederentdeckung ist. Sie fühlen sich bedroht und überwältigt von einem ausgreifenden Universalismus, der gewisse Rechte allen Menschen und nicht allein Staatsbürgern zuschreibt. Viktor Orbán, Donald Trump, Marine Le Pen, Jarosław Kaczyńskyi, Alice Weidel und ihre Weggefährten wollen den Westen enger und exklusiver definieren. Für sie ist der Westen eine kulturelle Verteidigungsliga, ein Identitätsclub der christlich (und auch jüdisch, so sagen sie) geprägten Nationa...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelei
- Widmung
- Inhalt
- Warum dieses Buch?
- 1. Wider den neuen Fatalismus
- 2. Um den Westen kämpfen
- 3. Die freiheitliche Weltordnung erneuern
- 4. Amerika nicht verloren geben
- 5. Die liberale Überdehnung erkennen
- 6. Auf robusten Liberalismus setzen
- 7. Flüchtlingsschutz: Das Globale mit dem Nationalen versöhnen
- 8. Intervention: Der demokratischen Mission Grenzen setzen
- 9. Welthandel: Internationale Regeln durchsetzen
- 10. Das nationalistische Fieber senken
- Anmerkungen
- Über den Autor
- Körber-Stifung