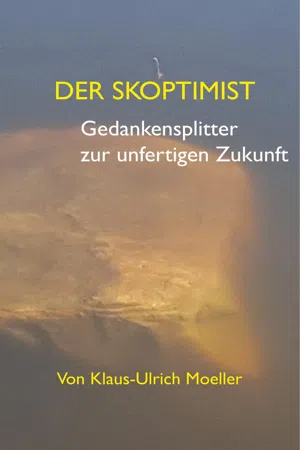![]()
17. BLOGS FOR FUTURE
Was Greta Thunberg kann, kann ich schon lange – dachte ich mir und habe meinen Zukunfts-Gedanken, die ich seit einem Jahr in Form es Blogs veröffentliche „Blogs for Future“ genannt. Da er zwar unregelmäßig, aber immer dienstags erscheint, hätte ich ihn analog zur „Friday for Future“-Bewegung auch „Tuesdays for Future“ nennen können – an dem Tag in der Woche ist sonst nicht viel los, selbst Champions League nicht. Ich drucke die wichtigsten Zukunfts-Blogs hier gerne mit ab für alle, denen mein Geschreibsel im ersten Teil des Buches zu lang, zu kompliziert, zu komplex und überhaupt nicht lesenswert erschien. Auch für alle Verleger, Chefredakteure, Redakteure von Magazinen, Zeitungen, Klatschblätter und Heimatzeitungen, die von mir gerne etwas zum Abdrucken hätten. Die Blogs sind sehr konzentriert gehalten – Lesedauer niemals länge als fünf Minuten, obwohl ich weiß, in der Tinder-Zeit ist auch das schon lang. Sie werden vieles, das Sie auf den letzten 200 Seiten gelesen haben, in konzentrierter Form wiederfinden. Das ist genau so gedacht, weil diese Kolumnen für all die sind, die irgendeinen Gedanken von mir gerne in eingedampfter Form lesen, irgendwo abdrucken oder ihn in den sozialen Netzwerken teilen wollen. Quasi der Teller Erbesensuppe als Astronautennahrung. Dieses Teilen ist ausdrücklich erwünscht – sofern Sie deutlich machen, wo die Urheberschaft liegt und woher Sie den Artikel haben.
![]()
SKEPSIS IST DER NEUE OPTIMISMUS (Februar 2019)
Wie würde ein Beobachter, der im Jahr 2119 lebt, die Zeit, in der wir uns gerade befinden, wohl beschreiben? Wohlgemerkt aus einer Distanz von 100 Jahren? Wären ihm Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Populismus überhaupt ein einziges Wort wert? Würde er wirklich vom Eintritt in die postindustrielle Wissensgesellschaft sprechen, wo doch gerade erwiesen zu sein scheint, dass wir weltweit eher wieder dümmer als klüger werden? Vielleicht wäre ihm das Ende der letzten Demokratien auf diesem Planeten eine Erwähnung wert oder - geopolitisch gesehen - der Aufstieg Chinas und Indiens zu Supermächten. Smartphones, Dieselkrise, AfD, Shitstorms und Plastikmüll-Debatte? Wohl eher nicht. Oder gibt es unseren Beobachter des Jahres 2119 gar nicht mehr, weil ein Atomkrieg uns alle dahingerafft hat, das Ökosystem kollabiert ist oder kluge Roboter beschlossen haben, dass sie uns Menschen nicht mehr benötigen auf dieser Erde?
Ich höre immer wieder, dass wir in einer "Übergangszeit" leben. Das mag stimmen, ist aber eine beschönigende Umschreibung für den Umstand, dass wir nicht die leiseste Vorstellung davon haben, wohin die Reise wirklich geht. Ob intelligente Robotic die Welt wirklich verändern, ob sie gar in der Lage sein wird, klügere Lösungen für die großen Herausforderungen zu finden als wir - offen. Ob die Nationalstaaten in der Globalisierung zerbrechen oder sich revitalisieren - offen. Wo und ob wir Menschen einen neuen Sinn finden, wenn uns die Arbeit ausgeht - offen. Ob wir in der Smartphone-Gesellschaft verblöden oder eine ganz neue Art der transhumanen Intelligenz ausbilden - offen. Das Positive an dieser Zukunftsoffenheit ist, dass wir und immer mehr Menschen diese Welt in einem Ausmaß gestalten können wie wohl noch nie zuvor. Nichts läuft automatisch ab, alles unterliegt unseren eigenen Entscheidungen. WIE wir die Zukunft gestalten, verlangt allerdings einen sehr offenen, einen demokratischen, einen sicher auch anstrengenden Diskurs.
Mit wieviel Optimismus müssen wir diese Diskussion bestreiten? Und wieviel Skepsis brauchen wir? Hilft uns eher ein positiver Blick in die Zukunft weiter oder sollten wir nicht eher misstrauisch sein gegenüber allem, was uns da an Behauptungen, angeblichen Fakten und Weltbeglückungsprogrammen jeden Tag vorgesetzt wird? Wie sieht die richtige Balance aus? Oder gibt es einen "Skoptimismus", die optimale Mischung zwischen Zweifeln und Optimismus? Wie verkrustet diese Diskussion über den besten Weg in die Zukunft ist, sehen wir exemplarisch an unseren Unternehmen, die ja schließlich diese Zukunft in starkem Maße mitgestalten. In Firmen, das sagt mir meine rund 20-jährige Erfahrung, haben Zweifel, Bedenken, Kritik und Ängste so gut wie keinen Platz. Da ist schnell abgestempelt als Miesmacher, Schwarzseher, Bedenkenträger, wer sachliche Einwände vorbringt. Da dominieren die Berufsoptimisten, die Zukunftschancen-Schwadroneure und die Himmelsstürmer, die mit Tschaka und Team-Events das nächste ultimativ-geile Projekt anstoßen. Je höher die Hierarchiestufe, desto optimistischer hat man zu sein. Man wird ja schließlich dafür bezahlt. Oder können Sie sich einen CEO vorstellen, der offen Zweifel äußert, ob die Strategie, die er da gerade entwickelt hat, wirklich die richtige ist? Ein Meeting, in dem derjenige belobigt wird, der den kritischsten Einwand vorbringt? Einen Mitarbeiter des Monats, der die Nachhaltigkeit der Firma bezweifelt?
Mit der überkünstelten Optimismus-Kultur in unseren Unternehmen, so viel ist sicher, werden wir weder den Herausforderungen gerecht noch binden wir die Mitarbeiter ein, die berechtigte Zweifel und Skepsis äußeren. Ihnen wird im Ernstfall nahegelegt, dann doch bitte das Unternehmen zu verlassen. Noch aus dem ersten Weltkrieg gibt es flackernde Filmstreifen, in denen ein Oberkommandeur rief "Mir nach!" und seine ganze Kohorte ins tödliche Kreuzfeuer des Gegners führte. Und können wir behaupten, dass der gut bezahlte Zwangs-Optimismus in unseren Vorstandsetagen, die bedingungslose Gefolgschaft ganzer Führungsmannschaften, wirklich zu besseren Ergebnissen geführt hat - oder nicht ebenso oft im Untergang sein Ende gefunden hat?
Was lernen wir daraus: Nicht nur die Berufsoptimisten, sondern auch die Zweifler, Skeptiker, Bedenklichen können ein gewaltiger Produktivfaktor für die Zukunft eines Unternehmens sein. Man muss ihnen nur in der Unternehmenskultur Raum geben, sie vernünftig einbinden und ihnen nicht gleich den Stuhl vor die Tür setzen. Zweifel sind nicht störend, sie sind hilfreich. Begründete Bedenken sind hilfreicher als eine gedankenlose ´"Wird schon"-Kultur. Willkommen im Zeitalter des "Skoptimismus".
![]()
DER UNTERNEHMER 4.0 – WIE ICH WIRKLICH
ZUKUNFT GESTALTE (Juli 2019)
Wenn ich Menschen frage, wen sie für einen großen Redner halten, sind die Antworten fast immer identisch: Steve Jobs, Barack Obama und - Gregor Gysi. Yes. Man weiß über alle drei nicht all zu viel, aber Steve Jobs hatte immer tolle Produktvorstellungen, von Barack Obama kennt man den Satz "Yes we can" und von Gregor Gysi weiß man, dass es immer lustig war, wenn er redete. Nun ist das Problem, dass der eine tot, der andere nicht mehr im Amt und der dritte auch ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist. Bei der Frage, von welchem Deutschen man aktuell eine große Rede, einen wichtigen Impuls oder einen bemerkenswerten Satz in Erinnerung hat, herrscht tiefes Schweigen - der YouTuber Rezo wird öfter genannt als Annegret Kramp-Karrenbauer oder Kevin Kühnert. Man könnte ironisch anmerken: Glücklicherweise.
Wo aber, habe ich mich gefragt, bleiben eigentlich unsere deutschen Unternehmer, unsere Führungskräfte, Manager, Selbstständige, die uns doch mit ihren Produkten und Leistungen ins neue zukünftige digitale Zeitalter führen sollen? Die doch dafür sorgen sollen, dass wir auch künftig gut und komfortabel und rücksichtsvoll leben. Die mit ihren Unternehmen die Welt stärker gestalten als die Politik dies je kann. Zur bitteren Wahrheit gehört es, dass wir die wichtigsten Unternehmer in Deutschland nicht einmal mehr kennen. Können Sie auf Anhieb die CEOs der Commerzbank, von ThyssenKrupp, Fresenius oder Bayer nennen? Die S-Dax- oder TEC-Dax-Unternehmen müssen wir gar nicht erst versuchen. Wir kennen sie nicht, wir wissen nichts von ihnen und wir haben nicht die geringste Ahnung, in welche Welt sie uns eigentlich treiben. Ich bezweifele, dass sie es selbst wissen. Und die Chefs der großen mittelständischen Firmen, darunter viele Weltmarktführer, fallen schon mal ganz aus. Der deutsche Mittelstand arbeitet, aber denkt nicht öffentlich nach.
Das einzige, was ich weiß, dass sie alle die Rendite und ihr Wachstum steigern wollen, dass sie ständig in der ganzen Welt auf der Suche nach Kunden und Absatzmärkten sind, sich bei Fusionen meist heillos verzetteln und im schlimmsten Fall wegen Korruption und Betrug im Gefängnis landen und jeweils von alledem nichts gewusst haben. Demenz nicht als Krankheit, sondern als Führungseigenschaft. Das ist keine grundsätzliche Kritik an ihrer Arbeit, sondern eine Kritik an ihrer geistigen Verengung, an ihrem eindimensionalen Blick. Wenn ich Führungskräften die einfache Frage stelle, was sie vom Silicon Valley halten, folgt statt einem flammenden Plädoyer Pro oder Contra meist ein Antwortschnipsel wie "Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt..."; "Wir beobachten das sehr genau...", "...manches kann man übernehmen, manches nicht". Nach solchen lichtvollen Ausführungen wage ich Fragen nach der Künstlichen Intelligenz, dem Zusammenwachsen von Mensch und Technik, der political correctness, der Rolle der großen weltbeherrschenden Plattformen wie Google und Facebook oder dem Zusammenhalt der künftigen Gesellschaft schon gar nicht mehr zu stellen.
Unternehmer, das ist meine Erfahrung, haben eine panische Angst vor der breiten Öffentlichkeit. Nirgendwo herrschen so starke Vorurteile gegenüber Presse und Medien wie in den Vorstandsetagen deutscher Konzerne, Mittelstandsfirmen und Startups bis hin zu den Selbstständigen hierzulande. Der Begriff "Lügenpresse" gehört noch zu den harmloseren Vokabeln in Vorstandssitzungen. Talkshows, Podiumsdiskussionen, Vorträge, die sich mal nicht dem eigenen Unternehmen befassen - das ist für die meisten unserer Unternehmer eine Horrorvorstellung. Man könnte Kunden verlieren, irgendwas Falsches sagen, scharf angegangen werden - Gründe für diese öffentliche Abstinenz sind schnell aufgezählt. Ich zähle noch einen weiteren Grund hinzu: Unternehmer haben sich in den seltensten Fällen Gedanken darüber gemacht, wie unsere Gesellschaft in 10 oder 20 Jahren aussehen soll in einer globalen, durchtechnisierten, künstlich-intelligent gesteuerten und wahrscheinlich wenig friedfertigen Welt. Das einzige, was sie interessiert ist, ob sie ihre Produkte noch verkaufen können. Das aber ist, mit Verlaub gesagt, zu wenig.
Denn es sind es doch gerade sie, die unser Leben gestalten werden. Sie, die sich jahrelang als meinungsführende Elite verstanden, ihr großes Ego spazieren geführt haben. Diesen Status werden sie allerdings nur dann wiedergewinnen können, wenn sie sich nicht länger der öffentlichen gesellschaftlichen und politischen Diskussion verweigern. Sich nicht länger verschanzen in ihren namenlosen Glas- und Aluminium-Büros in anonymen Industrievierteln. Die gesellschaftliche und politische Verantwortung nicht länger delegieren an ihre Verbände, um selbst nicht in die Schusslinie zu geraten. Und aufhören, immer über die gleichen Themen zu jammern - Mindestlohn, Frauenquote, Zölle, Bürokratie. Sondern uns positiv mitnehmen in eine künftige Welt, die lebenswert ist für uns alle. Die sie uns aber erklären, erläutern, kommunizieren müssen. Viele tun ja das Richtige, aber sie sagen das Falsche. Ein Auftritt im deutschen Parlament, eine souveräne Position in den Talkshows unserer Zeit, eine nachdenklich-visionäre Runde bei der IHK statt der Pflichtvorträge "Investieren in China" - das wäre doch schon mal ein Anfang.
Der Unternehmer 4.0. wird, auch das ist der Zeitgeist von morgen, vom Produktgestalter zum Gesellschaftsgestalter. Er muss diese Rolle nur annehmen. Es reicht ja schon, wenn er sich uns weniger als Unternehmer als kreativer Vordenker zeigt. Wenn er mal abseits des Mainstreams irgendetwas sagt, was uns aufrüttelt, was uns nachdenklich macht. Wenn er mal eine Hauptversammlung im Wald abhalten würde. Sich selbst wegen der Frauenquote entlässt. Seinen Bonus der TAFEL spendet und erklärt, wie er Gerechtigkeit versteht. Vielleicht hätte ich es sogar spannend gefunden, wenn sich ein Manager öffentlich zu Mezut Özil, der Gorch Fock und der AfD geäußert hätte - drei Dinge, die wir künftig nicht mehr benötigen. Daraus hätte man eine traumhaft gute, neue, spannende Rede stricken können. Aber dafür war wohl keine Zeit - der Flieger nach Singapur wartete sicher schon.
![]()
DAS WAR DER ALGORITHMUS – WIE WIR NIE
WIEDER SCHULD AN ETWAS SIND (Mai 2019)
Der Einzug von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz hat, das wissen wir, massive Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die Art, wie wir unsere Aufgaben erledigen. Doch anstatt unser eigenes Denken dagegen zu halten, beobachte ich an vielen Stellen bereits das genaue Gegenteil: Mit großer Erleichterung geben wir nur all zu gerne die Verantwortung für Entscheidungen an eben diese Künstliche Intelligenz ab. Ob es um die Frage geht, wer der geeignetste Bewerber für eine freie Stelle ist, um die Frage, wo ich den Kunden in seinem Bewegungsprofil am besten mit meiner Werbung erreiche, ob es um eine Investitionsentscheidung geht oder nur um Ernährungstipps aus meiner Smartwatch - der Satz "Der Algorithmus hat aber gezeigt..." oder "Die Artificial Intelligence hat das so entschieden" entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit zur neuen Entzugsformel für Verantwortung.
Schon bisher haben wir nur allzu gerne finstere anonyme Mächte, die IT oder das Schicksal dafür verantwortlich gemacht, wenn irgendetwas schieflief und wieder einmal ein Projekt gegen die Wand gefahren wurde. Dann waren schuld die Finanzmärkte, die Entwicklungen in China, überhaupt die Digitalisierung, die Zinsentwicklung (die das Ergebnis verhagelt hat), im Zweifel die Zölle und Donald Trump. Wir haben - bis hin in die obersten Vorstandsetagen - eine phänomenale Fähigkeit darin entwickelt, die Verantwortung irgendwohin weg zu delegieren, wo sie nicht mehr greifbar ist. Und was ganz oben vorgelebt wird, wird weiter unten natürlich nachgemacht. Die viel gepriesene Fehlerkultur kann ich nirgendwo erkennen. Das Konzept mag gut klingen, in der Praxis ist es krachend gescheitert.
In der digitalen Welt wird es nun nicht etwas besser, sondern - ich habe das oben beschrieben - eher schlimmer. Mit Algorithmen und Künstlicher Intelligenz, mit selbst lernenden Maschinen und smarten Tools kommt nun eine weitere, extrem machtvolle Instanz ins Spiel, an die wir die Verantwortung abgeben können. Die Erwartung, dass intelligente Systeme uns nur Vorschläge machen und wir dann mit natürlichem Menschenverstand eine autonome - und eventuell andere - Entscheidung treffen, ist in der Realität des Alltags pure Illusion. Künstlich-intelligente Systeme sind die beste Rückversicherung, die wir für Entscheidungen haben und die es je gegeben hat. Wer wird es schon wagen, sich gegen einen Vorschlag der KI zu entscheiden? Wenn diese Entscheidung dann nämlich schief geht, ist nix mehr mit Fehlerkultur. Dann kommt der Vorgesetzte, schaut dich vorwurfsvoll an und wird sagen: "Frau/Herr Meier, wofür schaffen wir denn für viel Geld diese intelligenten Systeme an, wenn Sie deren Empfehlungen einfach ignorieren".
Egal ob es eine um Investitions-, Produkt- oder Personalentscheidung geht: Wir werden uns massenhaft hinter der Artificial Intelligence verschanzen, wir werden ausführen, was uns empfohlen wird - damit sind wir immer auf der sicheren Seite. Es wird eine Menge Arbeit bedürfen bis hinein in die oberen Führungspositionen, den Wert eigenständiger, KI-unabhängiger Entscheidungen in der Unternehmenskultur zu verankern. Die Hoffnung, dass sich das von alleine in die richtige Richtung entwickeln wird, ist wie gesagt schiere Illusion. Dafür sind wir viel zu sehr Mensch.
![]()
MENSCH, WO BLEIBST DU? – WAS UNS IN
ZUKUNFT SINN VERMITTELT (Juni 2019)
Zu den am wenigsten intelligenten Entscheidungen unserer Zeit dürfte es gehören, dass wir gerade dabei sind, alles abzuschaffen, wo wir bisher als Mensch gebraucht wurden und was uns bisher Sinn auf dieser Welt vermittelt hat: Mit Enthusiasmus stürzen wir uns in eine Welt, in der Autos autonom fahren, Fabriken ohne uns auskommen und Supermarktkassen ohne Kassiererin funktionieren. Auch Einkaufen müssen wir nicht mehr und über Virtual-Reality-Brillen holen wir uns bald das Urlaubsparadies ins eigene Wohnzimmer. Man könnte das Positive daran sehen: Der CO2-Fußabdruck des Menschen geht, wenn er sich nicht mehr aus dem Haus bewegen muss, gegen Null und Klima und Welt wären gerettet.
Was aber machen wir eigentlich, wenn wir im Produktionsprozess nicht mehr benötigt werden? Noch reden wir uns die Entwicklung gnadenlos schön: Dass ja nur einfache und belastende Jobs durch Robotic und Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Dass wir uns sinnvolleren und intelligenteren Tätigkeiten widmen können - ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben, was das sein könnte. Dass wir auf interessantere Jobs umschulen, dass wir uns Kunst und Kultur und sozialen Aktivitäten widmen könnten, der Familie, dem Partner - der ja heute oft schon froh ist, wenn er uns nicht den ganzen Tag sehen muss. Verschärft wird das Problem dadurch, dass wir nicht mit 81 oder 82 friedlich ins Grab wechseln, sondern dieses sinnfreie Leben bald bis 100 oder 120 durchhalten müssen, wenn uns die Robotermedizin zu halb-unsterblichen Wesen umbaut. Und, um bei der Kultur zu bleiben, noch mehr Feuerwehrorchester wird die Welt ebenso wenig aushalten wie Bratschen-Ensembles, Volkstanzgruppen oder van-Gogh-Möchtegerns in der Provence.
Es ist also dringend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, worin der Sinn unseres Lebens besteht, wenn wir ohne Arbeit auskommen müssen. Einen Vorgeschmack bekommen wir, wenn in vielen Gegenden ab 15 Uhr Kolonnen von Pkws die Werkstore verlassen und die Insassen insgesamt weitere 7 Stunden sinnvoll verbringen müssen, bis sie um 22 Uhr ins Bett gehen dürfen. Mit Schwimmbad, Golfen, Weinfesten, Eisessen, Rasenmähen und irgendwelchen "Das-musste-immer-schon-mal-gemacht-werden"-Arbeiten im Haus wird sich die Sinnfrage nicht lösen lassen. Entweder gibt es eine andere Art von Arbeit oder wir finden etwas Neues, das uns tieferen Sinn vermittelt. Natürlich bleibt das jedem einzelnen überlassen, ob er seinen Sinn in tibetischer Klang-Yoga, in der Selbstoptimierung, religiösen Heilslehren oder der Kunst der japanischen Gärtnerei findet. Doch gesellschaftlich gesehen war die klassische Erwerbsarbeit mit ihrem Tauschmechanismus Arbeitsleistung gegen Geld jahrhundertelang der große Sinngeber unserer Gesellschaften. Ohne Arbeit zu sein war und ist nach wie vor ein Makel, der einen sozial stigmatisiert. Erst später wurde Arbeitsleistung auch gegen Freizeit getauscht und somit pervertiert sich das System am Ende selber, wenn es jetzt 100 Prozent Arbeitsleistung gegen 100 Prozent Freizeit tauscht. Die Entwicklung ist also nicht wundersam, sondern systemimmanent.
Wer sich einmal in Vereinen engagiert hat, Kuchentheken bei Sportfesten bestücken oder einen Kinderspielplatz ehrenamtlich zusammenzimmern musste, der weiß: Das ist nebenher eine schöne Sache, aber langfristig erfüllen werden einen diese Tätigkeiten nicht. Gibt es also die große Meta-Lösung für das, was den Menschen nicht nur zeitweise glücklich macht,...