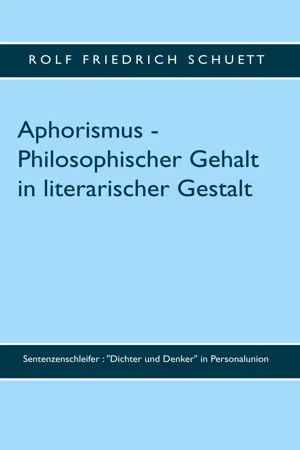![]()
„Dichter und Denker“ in Personalunion?
Dieser Teil geht aus von der These, dass Philosophie noch lange nicht ausgeschöpft hat, was sie von europäischer Moralistik profitieren könnte. S. Maimon sah als erster, daß Dialektik aus den Selbstwidersprüchen nicht der Vernunft, sondern der Einbildungskraft stammt, die die romantische Synthese von Kunst und Philosophie in ironische, von Hegel nicht mehr reintegrierbare Fragmente zerlegte. Friedrich Hegel hatte die aphoristische Mehrdeutigkeit in der Vorrede zur „Phänomenologie“ als eitel subjektive „Konversation“ abgetan, weil er durch dialektische Systematisierung die frühromantischen Ideenfragmente von F. Schlegel und Novalis entschärfen und dann noch überbieten wollte, was der Kieler Neophänomenologe Hermann Schmitz in „Die entfremdete Subjektivität. Von Fichte zu Hegel“ (Bonn 1992) als eines der wahren Hauptmotive von Hegels ganzem „objektiven Idealismus“ interpretierte. Manfred Frank sah in den frühromantischen Aphoristikern „Auswege aus dem deutschen Idealismus“ (Frankfurt/M. 2007) und dessen hypersubjektivistischen Bezugssystemen. Adornos „Negative Dialektik“ wollte die Aphorismen gegen die Wissenssysteme so immunisieren wie alles Individuelle gegen die (potentiell totalitären) Allgemeinheiten. Die Philosophie habe in Nietzsches Nachfolge durch „Verwandlung in Methode“ ihre moralistischen Traditionen „der intellektuellen Nichtachtung, der sentenziösen Willkür und am Ende der Vergessenheit“ überantwortet : „Verschwindet heute das Subjekt, so nehmen die Aphorismen es schwer, dass „das Verschwindende selbst als wesentlich zu betrachten“ sei.“ („Minima moralia“, Frankfurt/Main 1962, S. 9) „Eindeutig praktischen Sinn haben die Maximen insbesondere in der Moralistik.“ (Rüdiger Bubner : „Handlung, Sprache und Vernunft“, Frankfurt/M. 1976, S. 197) „In den Maximen äußert sich die einfache praktische Vernunft.“ (S. 210) Für Bubner „muß alles Handeln, das Ziele verfolgt, maximenfähig sein.“ „Der Bereich möglicher Maximen und der Bereich dessen, was Handlung heißt, ist deckungsgleich.“ (S. 195) „Der kategorische Imperativ lässt sich nämlich nur aussprechen, wenn Maximen schon vorliegen“ (S. 188), die bei Kant dann nur noch auf reine, gesetzförmige Moralität geprüft werden. Der Moralist „Gracian hat die Figur des descifrador, des Entzifferers, geschaffen, der die gesellschaftlichen Masken durchschaut, divinatorisch die eigentlichen Beweggründe des sozialen Lebens erkennt und sie in knappen Formeln benennt.“ (Heinz Schlaffer : „Aphorismus und Konversation“. In : „Merkur“, München 1998)
Heraklit, der Dunkle
Wilhelm Capelle nennt die "von unerhörtem Selbstbewußtsein getragene, in schneidenden Aphorismen gegossene Sprache" Heraklits. ("Die Vorsokratiker", Stuttgart 1968, S. 126). Harald Fricke bestreitet, daß die Vorsokratiker Aphoristiker gewesen seien : "Heraklit und mit ihm die anderen ... sogenannten Vorsokratiker ... haben so wenig 'Fragmente' geschrieben, wie antike Bildhauer ihre Statuen ohne Kopf geformt haben : sie sind uns nur fragmentarisch überliefert." (Harald Fricke : "Der Aphorismus", Stuttgart 1984, S. 41) Dagegen aber spricht Platons Bericht über die Herakliteer : "Wenn du einen etwas fragst, so ziehen sie aus einem Köcher rätselhafte kleine Sprüche hervor und schießen diese ab; und willst du eine Erklärung, wie es gemeint gewesen, so wirst du von einem ähnlichen getroffen ..." (Dialog "Theaitetos", 180 a).
Heraklit von Ephesos hat die ersten Aphorismen geschrieben, aber "Aphorismoi" nannte zum ersten Mal der Arzt Hippokrates seine "Gnome" (Erkenntnisvermögen). Die europäische Aphoristik mit ihren Heilregeln entstammt der griechischen Aufklärung und demokratischen Sophistik, die die Bürger verdarb, indem sie ihnen "Diskussionskompetenz" beibrachte. In den Meinungen dieser nomadischen Wanderlehrer steckten wirkliche Gedanken, welche umgekehrt die bloßen 'Doxai' in Platos Ideen aufdeckten. Daraufhin glaubte Aristokrat Plato, der keine Honorare nötig hatte, sie in den Dialogen "Gorgias" oder "Sophistes" allein dadurch widerlegt, daß er ihnen vorwarf, für ihre Weisheiten Geld zu nehmen. Er hielt sie für zweifelhafte Subjekte, weil sie subjektivistisch dachten und das menschliche Subjekt ernst nahmen, während er als Antidemokrat, der laut Russell eine totalitäre Republik entwarf, die objektive Wahrheit gepachtet zu haben meinte. Diese skeptischen Individualisten und Ur-Pädagogen lebten davon, zu skeptischen Individualisten auszubilden, d. h. zu mündigen Staatsbürgern, in Grammatik, Rhetorik und Dialektik, in Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Diese Relativisten machten nicht den Menschen zu Gott, sondern stellten seine Interessen erstmals in den Mittelpunkt des Interesses. Individuelle Interessen sahen sie durch die Idee „objektiver Wahrheit“ der Oberschicht gefährdet. Sitten und Gesetze seien nur willkürliche Satzungen und keine Naturgesetze. Einige dieser Sozialrevolutionäre waren sogar Frühsozialisten, Feministen und Theoretiker der Sklavenbefreiung. Ihre Domäne war wie bei den späteren französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts die "kritische Betrachtung aller menschlichen Einrichtungen in Staat und Gesellschaft, Religion und Moral, Recht und Sitte.” (W. Capelle, a.a.O., S. 320)
An seinem Vorgänger Xenophanes faszinierte Heraklit die anti-anthropomorphe Vorstellung eines absoluten Gottes, an seinem Vorgänger Anaximandros von Milet beeindruckte ihn das Weltgesetz einer ewigen Bewegung durch Gegensatzpaare hindurch und das unbegrenzte Apeiron, das er dann aphoristisch abgrenzte. Simplicius schrieb : "Anaximandros nimmt die Entstehung nicht infolge einer qualitativen Veränderung des Urelements an, sondern infolge einer Ausscheidung der Gegensätze auf Grund ewiger Bewegung." (Fr. 29) "Von den Philosophen, die eine unendliche Zahl von Welten angenommen haben, hat Anaximandros behauptet, daß sie gleich weit voneinander entfernt seien." (Fr. 35)
Gegen Mathematiker Pythagoras, "Anführer der Schwindler" und "Vieleslerner", sagte Heraklit: "Was man sehen, hören, erfahren kann, das ziehe ich vor." Sein entmythologisierter "Logos", der Homers Götter entthronte, war Einheit von Wort und Sinn, von Rätselsprüchen und Weltvernunft. Dieser erste Aphoristiker war nicht zufällig der erste Europäer, der den Menschen ausdrücklich zum Forschungsgegenstand machte und ihn anthropologisch im Horizont eines nicht-anthropomorphen Absoluten entdeckte. Als erster Abendländer verstand er den Menschen organisch von kosmischen Prinzipien her, den Logos nicht als Logistik und die Mantik nicht als mathematische Mystik. Logisch nannte Herakleitos, "der Dunkle" (Skoteinos), nur seine unlogischen Sprüche, und vernünftige Rede fand er nur in unverständlicher Gnomik. Heraklits Aphorismen sind fulminante Geistesblitze : "Alle Dinge steuert der Blitz."
Empedokles, Plato und Demokritos gelten als die Denker, welche den Statiker Parmenides und den Dynamiker Heraklit versöhnen wollten. Empedokles von Agrigent sah das Entstehen und Vergehen der Dinge als liebende Vereinigung und hassende Trennung zwischen den Ur-Teilen Erde, Wasser, Luft und jenem Feuer, an dem Heraklit seine Aphorismen zünden ließ. Sein Spiel von gespanntem „Sphairos“ und entspannter „Akosmia“ war ein Antagonismus von polemischer Eris und platonischem Eros.
Vielleicht gab es keine Geburt der idealistischen Dialektik aus dem aphoristischen Geist Heraklits, aber Hegel sagte, daß es keinen Spruch des Heraklit gebe, den er nicht in seinem eigenen System gut 'aufgehoben' habe. "Wir steigen in denselben Fluß und doch nicht in denselben; wir sind es, und wir sind es nicht." (Fr. 49 a). Bei Hegel liest sich das 2400 Jahre später so : "Es bewegt sich etwas nur, nicht indem es in diesem Jetzt hier ist und in einem anderen Jetzt dort, sondern indem es in einem und demselben Jetzt hier und nicht hier, indem es in diesem Hier zugleich ist und nicht ist." ("Wissenschaft der Logik, Band II", Frankfurt am Main 1981, S. 76) Erst die von ihm bekämpften Romantiker haben diese Fragmente Heraklits dann wieder aus Hegels System so befreit wie Platons Dialoge aus Hegels Dialektik. G. Cantarutti erklärte sich die Vorbehalte der deutschen Forschung gegen die Aphoristik daraus, daß diese Forschung noch im Bann der Ästhetik Hegels stehe, der den Aphorismus in der Vorrede zur "Phänomenologie" als bloße Konversation abgetan hatte. (siehe Cantarutti: "Neuere Studien zur Aphoristik und Esayistik", Frankfurt/Main 1986)
Hegel hat Schlegel besiegt – bis heute. Erst der genuine Aphoristiker Nietzsche hat Heraklit dann frühromantisch gerettet: „Heraklit wird nie veralten.“
Kants anthropologische Theorie des Geistes
Wenn es nicht nur Eitelkeit anzeige, schreibt Kant, daß "das Paradoxon das Gemüt zur Aufmerksamkeit und Nachforschung erweckt, die oft zu Entdeckungen führt." ("Anthropologie in pragmatischer Hinsicht", Werke Band XII, Frankfurt/M. 1982, S. 410) „Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne uns ihrer bewußt zu sein" : "So ist das Feld dunkler Vorstellungen das größte im Menschen." "Wir spielen nämlich oft mit dunkelen Vorstellungen, ... öfter aber noch sind wir selbst ein Spiel dunkeler Vorstellungen. So ist es mit der Geschlechtsliebe bewandt... " (419) "Das Passive in der Sinnlichkeit (die an sich Pöbel ist, weil sie nicht denkt), was wir doch nicht ablegen können, ist eigentlich die Ursache alles des Übels, was man ihr nachsagt. Die innere Vollkommenheit des Menschen, besteht darin: daß er den Gebrauch aller seiner Vermögen in seiner Gewalt habe, um ihn seiner freien Willkür zu unterwerfen." (433) "Die Sinne betrügen nicht." (436) Kant sagt, daß "ein Oberhaupt ohne Volk (Verstand ohne Sinnlichkeit) gar nichts vermag." (505) "So wie das Vermögen, zum Allgemeinen (der Regel) das Besondere auszufinden, Urteilskraft, so ist dasjenige: zum Besonderen das Allgemeine auszudenken, der Witz (ingenium)." (511)
"Das Vermögen der (Assoziation) Vereinbarung fremdartiger Vorstellungen der Begriffe durch den Verstand ist der schöpferische Witz." (S. 537) "Der Witz paart (assimiliert) heterogene Vorstellungen, die oft nach dem Gesetze der Einbildungskraft (der Assoziation) weit auseinander liegen, und ist ein eigentümliches Verähnlichungsvermögen, das dem Verstande (als dem Vermögen der Erkenntnis des Allgemeinen), sofern er die Gegenstände unter Gattungen bringt, angehört. Er bedarf nachher der Urteilskraft, um das Besondere unter dem Allgemeinen zu bestimmen, und das Denkungsvermögen zum Erkennen anzuwenden." (S. 537 f.) "Baco von Verulam hat an seiner eigenen Person von dieser Kunst, vorläufig zu urteilen, ein glänzendes Beispiel in seinem Organon gegeben, wodurch die Methode der Naturwissenschaft in ihr wahres Gleis gebracht wurde." (538) "Es ist angenehm, beliebt und aufmunternd, Ähnlichkeiten unter ungleichartigen Dingen aufzufinden und so, wie der Witz tut, für den Verstand Stoff zu geben, um seine Begriffe allgemein zu machen. Urteilskraft ... ist aber ernsthaft, strenge und in Ansehung der Freiheit zu denken einschränkend, eben darum aber unbeliebt. Des vergleichenden Witzes Tun und Lassen ist mehr Spiel; das der Urteilskraft aber mehr Geschäfte. – Jener ist eher eine Blüte der Jugend, diese mehr eine Frucht des Alters. – Der im höheren Grade in einem Geistesprodukt beide verbindet, ist sinnreich." − "Witz hascht nach Einfällen; Urteilskraft strebt nach Einsichten." (S. 539) Sofern der Witz "durch das Bildliche, was er den Gedanken anhängt, ein Vehikel oder Hülle für die Vernunft ... sein kann, läßt sich ein gründlicher Witz (zum Unterschiede des seichten) denken." (S. 540 f.) Von einer Hypothese anfangen : „Um etwas zu entdecken (was entweder in uns selbst, oder anderwärts verborgen liegt), dazu gehört in vielen Fällen ein besonderes Talent, ... vorläufig zu urteilen (iudicii praevii), wo die Wahrheit wohl möchte zu finden sein ... Die Logik der Schulen lehrt uns nichts hierüber. Aber ein Baco von Verulam gab ein glänzendes Beispiel an seinem Organon von der Methode, wie durch Experimente die verborgenen Eigenschaften der Naturdinge könne aufgedeckt werden." (S. 542) "Nun heißt das Talent zum Erfinden das Genie", "die musterhafte Originalität" (S. 543). Genie sei ein Talent, "durch welches die Natur der Kunst die Regel gibt." (S. 545)
„Das eigentliche Feld für das Genie ist das der Einbildungskraft, weil diese schöpferisch ist, und weniger als andere Vermögen unter dem Zwange der Regeln steht, dadurch der Originalität desto fähiger ist."
"Geist ist das belebende Prinzip im Menschen. In der französischen Sprache führen Geist und Witz einerlei Namen, Esprit." Was geistvoll heißen solle, müsse "ein Interesse erregen und zwar durch Ideen." (544) Im Alter sei Poesie "in Sachen des kaustischen Witzes, in Epigrammen und Xenien, wo sie aber auch mehr Ernst als Spiel ist." (577) "Das Genie glänzt ... wie sprühende Funken, welche eine glückliche Anwandelung des Geistes aus der produktiven Einbildungskraft auslockt." (667)
Das aphoristische Philosophieren vollzieht genau die von Kant so genannte "sinnreiche" Verbindung von Witz und Urteilskraft. Gewitz(ig)t heißt erfahren, und Aphoristik will unmittelbare Lebenserfahrung vor der Verwissenschaftlichung und sozialtechnischen Verfügbarkeit retten. Aphoristisch denken heißt, daß der Vorwitz den begriffsklassifikatorischen Nachstellungen immer um einen Hakenschlag voraus ist: der Witz an der Sache entwischt dem Erkennnungsdienst. Kants heiteres Alterswerk einer pragmatischen "Anthropologie" von 1798 erkennt das höchste Erkenntnisvermögen im "produktiven Witz". Dieser schöpferische Witz (nicht nur des Genies) hört auf, nur 'geistreich seicht' beliebig neue Gattungsbegriffe zwischen einander fremden Kulturen zu generieren, wenn er zugleich die Urteilskraft (UK) besitzt, erfahrbare Besonderheiten unter die richtigen Allgemeinbegriffe zu subsumieren. Die "Kritik der Urteilskraft" von 1790 versteht diese UK als Vermögen der Zwecke zwischen dem Verstand, der der Natur die Gesetze vorschreibt, und der Vernunft, die sich in Freiheit ihr eigenes Gesetz gibt. Die "Kritik der Urteilskraft" (KU) unterscheidet zwischen reflektierender UK, die Allgemeinbegriffe bildet, und bestimmender UK, die Besonderheiten darunter subsumiert. Kants "Anthropologie" nennt also 'produktiven Witz', was die "KU" neun Jahre früher 'reflektierende Urteilskraft' der 'ästhetischen Ideen' nennt, und 'Urteilskraft' im allgemeinen, was die "KU" eine 'bestimmende Urteilskraft' genannt hatte. Die "Kritik der reinen Vernunft" definiert : "Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, so ist UK das Vermögen, unter Regeln zu subsumieren, d.i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datae legis) stehe oder nicht ... Und so zeigt sich, daß zwar der Verstand einer Belehrung und Ausrüstung durch Regeln fähig, UK aber ein besonderes Talent sei, welches gar nicht gelehrt, sondern nur geübt sein will ... Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen." Der Witz (reflektierende UK) ist induktiv, die (bestimmende) Urteilskraft ist deduktiv, und der Aphorismus will dieses gewitzte Generalisieren und kluge Spezifizieren gekonnt verbinden. Lord Bacon hatte gegen die scholastische Deduktion eine Renaissance für den Witz der aphoristischen Induktion eingeläutet. Den Aphorismus als Einheit von reflektierendem Witz und bestimmender Urteilskraft nennt Kant nicht mehr seicht und geistreich, sondern sinnreich und gründlich. Die "zweckfreie Zweckmäßigkeit" in der spielerischen Konstellation seiner Begriffe will interesselos interessantes Mißfallen erregen, und das gefällt ganz ungemein, wenn auch meist nur dem Aphoristiker. Der Aphorismus ist somit ein Witz der Urteilskraft und das strenge Urteil ein witzloser Aphorismus. Adorno hat das, was Kant bestimmende Urteilskraft nennt, diskreditiert und authentische Philosophie wieder reduziert auf induktiven Witz an der Sache.
Was aber, wenn weder das Besondere noch das Allgemeine 'gegeben' ist, sondern vom späteren Gegen-Stand, der noch gar keinem Subjekt gegenübersteht, vorerst nur eine vag allgemeine Atmosphäre das Subjekt leiblich ergreift und affektiv betroffen macht, wie der Kieler Neophänomenologe Hermann Schmitz schreibt? "Den Schock des drohenden und gerade noch abgefangenen Durchbruchs in primitive Gegenwart gibt es auch ... bei jedem kapierten Witz, aber dann fehlt zum lyrischen Betroffensein die leibliche Ergriffenheit durch die Atmosphäre eines Gefühls, und so pflegt es sich auch beim bloß zündenden Aphorismus zu verhalten." (Brief vom 18. 08. 1993). Aber Gefühlsambivalenzen aus Verstandesparadoxen, die es zum lyrischen Schmelzen allerdings gerade nicht kommen lassen, spielen beim Aphorismus im Gegenteil häufig die Hauptrollen. Das körperliche „Ablachen“ der Witzspannung im § 54 der "KU" ist für Kant eher ein gesundes Psychosomatikum als eine schöne hohe Kunst.
Idealisten, Zyniker und Romantiker
Der bedeutendste Philosoph des Altertums war selbst ein begnadeter Künstler und warf dennoch die Künstler hinaus aus seinem utopischen Staat. Platos Dialogkunst stand im Dienste philosophischer Wahrheitsfindung. Hegel erhob – mit welchem Recht auch immer – den Anspruch, die aufeinanderfolgenden Positionen der platonischen Dialogpartner in die dialektische Selbstbewegung des Begriffs "aufzuheben", aber im Falle der frühromantischen Fragmente gelang ihm diese systematische Integrationsleistung nicht mehr. Sie fallen aus seinem System heraus oder transzendieren es, subjektiv als "eitles Meinen", das angeblich nichts allgemeingültig erkennen will, und objektiv als "faule Existenz", die nicht wirklich vernünftig werden wolle, wie Hegel höhnte und zürnte. Die isolierten Fragmente fragen und antworten einander nicht mehr dialogisch, sie widersprechen ironisch jedes eher sich selbst als einander. Laut Hegel ist der Dialogiker Plato selb...