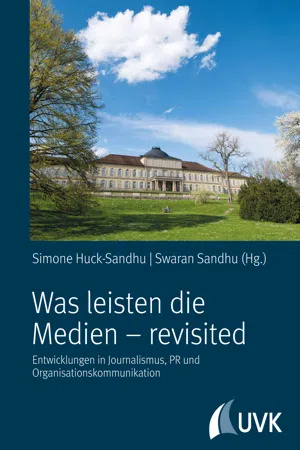
eBook - ePub
Was leisten die Medien – revisited
Entwicklungen in Journalismus, PR und Organisationskommunikation
- 240 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Was leisten die Medien – revisited
Entwicklungen in Journalismus, PR und Organisationskommunikation
Über dieses Buch
Was leisten die Medien?So lautet die prägnante Leitfrage, der sich Claudia Mast in ihrer Habilitationsschrift zuwandte. 1986 im Fromm-Verlag erschienen, analysierte der Band den funktionalen Strukturwandel in den Kommunikationssystemen jener Jahre und legte den Grundstein für drei Jahrzehnte der Forschung und Lehre am Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft, insb. Journalistik der Universität Hohenheim. Anlässlich dieses Jubiläums diskutieren die ehemaligen Doktorandinnen und Doktoranden des Fachgebiets die Kernideen ihrer Dissertationsthemen. Der Band "Was leisten die Medien revisited" bündelt erstmals die Themen der Hohenheimer Schule rund um die Frage nach Leistungen der Medien und von Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Was leisten die Medien – revisited von Simone Huck-Sandhu, Swaran Sandhu, Simone Huck-Sandhu,Swaran Sandhu im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Medien- & Kommunikationsbranche. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Was leisten Medien? Revisited!
Einleitung und thematische Hinführung
Simone Huck-Sandhu & Swaran Sandhu
Was leisten die Medien? Als Claudia Mast diese Leitfrage zu Beginn der 1980er Jahre an den Ausgangspunkt ihrer Habilitationsschrift stellte, befand sich das Kommunikationssystem im Umbruch. Getrieben von technologischen Innovationen standen die traditionellen Massenmedien im Begriff sich von Grund auf zu verändern: „Technische Entwicklungen haben [...] mediale Einzelleistungen in Hinblick auf die Wahrnehmungsdimensionen (Text, Sprache, Bild, Daten) und Vermittlungsleistungen (Reichweiten bzw. Unabhängigkeit von Raum und Zeit) gesteigert“, konstatierte Mast (1986, S. 11). Nicht nur die Rolle der Massenmedien als Vermittlungssysteme veränderte sich. Es entstanden auch gänzlich neue Formen der sozialen Nutzung. Der technologische und gesellschaftliche Wandel führte zu einem erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit (Habermas 1962; Castells 2008).
Die neuen Leistungsangebote, die mit der Telekommunikationstechnologie verbunden waren, erweiterten und ergänzten die bestehenden Medien. Sie unterwarfen „die mediale Bewältigung von Raum, Zeit und Aussagen einem strukturellen Wandel, der sich auch auf die Interaktionsbeziehungen der beruflichen Kommunikatoren und der Rezipienten niederschlägt“ (Mast 1986, S. 11). Die Veränderungen in den Interaktionsbeziehungen hatte Claudia Mast im Rahmen ihrer Berufstätigkeit selbst erfahren: Zunächst als Redakteurin bei Print und Rundfunk, später als Leiterin der Abteilung für gesellschaftspolitische Grundsatz- und Bildungsarbeit der Siemens AG, erlebte sie im Kontext von Journalismus und Public Relations (PR), wie strukturelle Veränderungen „die bislang getrennten Bereiche medialer Aussagenentstehung und kommunikationstechnischer Vermittlung funktionell“ verzahnten (ebd.) und damit die Tätigkeit von Kommunikatoren veränderten.
Neue Leistungen der Medien, individualisierte Formen von Massenkommunikation, funktionelle Verzahnung von medialer Aussagenentstehung mit kommunikationstechnischer Vermittlung – betrachtet man die von Mast beobachteten Veränderungen, so lässt sich die Brücke vom Strukturwandel der 1980er Jahre zu heutigen Entwicklungen schlagen. Vor rund 30 Jahren sortierte und systematisierte Mast die Kategorien des Wandels, beschrieb wie sich der technisch induzierte Strukturwandel der (Massen-)Medien im Kommunikationssystem niederschlug und entwickelte ein Analyseraster. Dieses Raster kann in seinen Grundzügen auch auf den „neuen“ Strukturwandel (Castells 2008), der seit den 2000er Jahren im Kommunikationssystem stattfindet, angewendet werden. Viele der von Mast formulierten Erwartungen sind zwischenzeitlich Realität geworden. So ermöglichen heute z. B. soziale Plattformen wie Facebook oder Twitter eine mass-self-communication, die eine neue Dimension der individualisierten Massenkommunikation eröffnet. Instant Messaging-Dienste vernetzen Gruppen über Zeit und Raum hinweg, so dass Aussagenproduktion, -vermittlung und -rezeption fast zeitgleich stattfinden können. Und mit den Grenzverschiebungen zwischen Journalismus und PR – etwa im Bereich des Corporate Publishings, der Unternehmens-Newsrooms oder der crossmedialen Inhalteerstellung – haben sich auch die Berufsfelder weiter gewandelt.
Ziel dieses Einführungskapitels ist es, Claudia Masts Entwurf des funktionalen Strukturwandels in den Kommunikationssystemen in seinen Grundzügen zu skizzieren und auf die heutigen Bedingungen im Kommunikationssystem zu übertragen. Im Folgenden werden die Kernbegriffe, -konstrukte und -ergebnisse ihrer Habilitationsschrift aufgenommen und im Kontext aktueller Rahmenbedingungen diskutiert. Ausgangspunkt bildet der technologisch induzierte Strukturwandel, der durch Innovationen in der Telekommunikation zu Grenzaufhebungen und neuen Leistungen der Medien führte – vor 30 Jahren und in Übertragung auf die Entwicklungen von heute. Im Kern der Übertragung stehen der Leistungsbegriff von Massenmedien und sein „Update“ zu aktuellen Veränderungen. Die Dimensionen von Medienleistungen werden in ein aktualisiertes Analyseraster überführt. Es dient als Grundlage für die vier Teile dieses Bandes: für die Analyse eines ausdifferenzierten Kommunikationssystems in Form von Journalismus (gesellschaftliche Selbstbeobachtung), PR (organisationale Legitimation und Selbstdarstellung) und interner Kommunikation (interne Orientierungssysteme) sowie im Querschnittsfeld der Organisationskommunikation (Kommunikation von und über Organisationen). Diese vier Teilbereiche prägten und prägen Claudia Masts Forschung am Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hohenheim und die bei ihr entstandenen Dissertationen.
1.1Der Strukturwandel und seine Folgen: Grenzaufhebungen in drei Dimensionen
„Die Angebote der Telekommunikationsmedien kündigen die Veränderungen des Kommunikationssystems an, die aus der Steigerung von Einzelleistungen (Vermittlung, Speicherung, Verarbeitung), aber v. a. aus dem Verschmelzen der Leistungsangebote und der Multifunktionalität der Kommunikationswege und -mittel zu erwarten ist. Bislang getrennte Medienleistungen werden integriert. Die gleichen Mitteilungskanäle werden für verschiedenste Kommunikationsformen benutzt“ (Mast 1986, S. 65).
In den 1980er Jahren führten technische Innovationen sowohl in der Druck- als auch der Telekommunikation zu einem Strukturwandel des Kommunikationssystems. Ab Mitte der 1970er Jahre hatte bereits das Offsetdruckverfahren den Bleisatz mehr und mehr abgelöst. Kosteneinsparungen und eine deutlich bessere, v. a. auch mehrfarbige Druckqualität waren die Folge. Zudem ermöglichte der Einsatz der Elektronik immaterielle Druckformen. Die „elektronische Ausrüstung“ der Nachrichtenagenturen (Mast 1986, S. 23) ab Anfang der 1980er Jahre trug dazu bei, dass sich diese neuen elektronischen Systeme im Druckgewerbe rasch verbreiteten. Das Eingeben und Bearbeiten von Texten und Bildern konnte „schneller, präziser und flexibler“ (ebd.) erfolgen. Mit dem Aufkommen „elektronische[r] Aussagenproduktionssysteme“ (ebd.) konnte der Seitenumbruch elektronisch am Bildschirm ausgeführt und per Knopfdruck in die Lichtsetzanlage übermittelt werden. Die Faksimiletechnik ermöglichte es, den zeit- und kostenintensiven Vertriebsweg von Druckerzeugnissen über den dezentralen Druck zu verkürzen (ebd., S. 24). Und nicht zuletzt führte die neue Technologie des Fotokopierens eine Vervielfältigungstechnik ein, die die preiswerte Vervielfältigung von Gedrucktem ohne fotochemisches Verfahren und Spezialpapier möglich machte. „Die Anwendungen technischer Innovationen haben das drucktechnische Kommunikationssystem verändert“, stellte Mast (1986, S. 26) fest, „indem sie die mediale Bewältigung von Kommunikationsräumen und Themen sowie Leistungen der Aktualität und Periodizität verbesserten“.
Die Bewältigung von Kommunikationsräumen ist mit Blick auf Leistungen der Aktualität v. a. räumlich und zeitlich zu verstehen: Mit dem sogenannten Fernkopieren lag erstmals eine Vervielfältigungstechnik vor, um Gedrucktes zeitgleich über größere Strecken zu verteilen (Mast 1986, S. 31). Zudem waren seit Ende der 1970er Bildfernsprechen und Bildkonferenzen möglich. „Gruppen- und Individualkommunikation, die bisher nur in physischer Anwesenheit der Gesprächspartner ablaufen konnte, wird telekommunikativ vermittelt und erreicht eine räumliche, in vielen Fällen auch zeitliche Befreiung“ (ebd.). Im Jahr 1983 verfügte fast jeder Haushalt in der Bundesrepublik über ein Fernsehgerät. Der Übergang vom Schwarzweiß- zum Farbbild und verbesserte Übertragungsqualitäten führten zu mehr Komfort. Mit der Einführung neuer Technologien wie Videotext, später Bildschirm- oder Kabeltext kamen individualisierte Abruf- bzw. Zugriffsmedien hinzu. Auch das inhaltliche Angebot erweiterte sich durch das Aufkommen des privaten Rundfunks.
Die Folgen dieses Strukturwandels in den Kommunikationssystemen führte Mast (1986) in drei Dimensionen zusammen:
- Erstens beschrieb sie die Grenzaufhebung zwischen Print- und Telekommunikation. „Der Einsatz elektronischer Aussagenproduktionssysteme hat die Printkommunikationsmittel eingebunden in das System immaterieller Produktion und Distribution von Aussagen und zu Spezialisierungs- und Diversifizierungsprozessen geführt“, so Mast (1986, S. 13).
- Zweitens ließen sich die Folgen des Strukturwandels in Form der Grenzaufhebung zwischen Prozessen der Individual- und Massenkommunikation beobachten. Die neu entstehenden Zwischen- und Mischformen hätten den Begriff der Massenkommunikation „ausgehöhlt“ und ihn auf das Konzept der Verteilkommunikation zurückgedrängt und könnten zur „Entgrenzung des Faches Kommunikationswissenschaft“ führen (ebd., S.13).
- Drittens führte der Strukturwandel zur Grenzaufhebung zwischen den Bereichen medialer Aussagenentstehung und kommunikationstechnischer Vermittlung, die insbesondere die Tätigkeit von Journalisten veränderte. Der Journalismus sei zum „informationsverarbeitenden Beruf“ geworden und das journalistische Berufsfeld habe sich mit der Differenzierung der Berufsbilder entgrenzt (ebd., S. 12).
Angesichts dieser drei Grenzaufhebungen sah Mast die Kommunikationswissenschaft und Medienpolitik mit theoretischen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. „[N]icht nur die Grenzen traditioneller, an medientechnischen Ausprägungen orientierter Konzepte und Begriffe, sondern auch die faktische Gliederung der Medienlandschaft“ (ebd.) seien im Begriff sich fundamental zu verändern. Rund drei Jahrzehnte später lässt sich feststellen: Claudia Mast hat Recht behalten. Das „duale Mediengefüge“ aus Print und elektronischen Medien (ebd., S. 42) existiert zwar weiterhin. Aber seit 1986 hat sich das Medienangebot durch neue Formen und Formate sowie durch Online-Kommunikation und mobile Technologien noch einmal stark gewandelt. Medieninhalte sind heute weniger denn je an ein Trägermedium wie Print oder Rundfunk gebunden (Jenkins et al. 2013).
Die Grenzaufhebung zwischen Print- und Telekommunikation ist weiter vorangeschritten: „Content“ wird in der Regel medienneutral digital produziert und in verschiedenen Containern oder Ausspielkanälen verbreitet (Engel und Breunig 2015, S. 310). Das System immaterieller Produktion und Distribution von Aussagen, das Mast in seinen Anfangsjahren beschrieb, hat mit dem Beginn der Digitalisierung in den frühen 2000er Jahren eine neue Qualität bekommen. Zwischenzeitlich ließ sich eine zweite Welle der Grenzaufhebung in den drei identifizierten Dimensionen beobachten: Der explosionsartige Zuwachs an digitalen Medien und Rezeptionsmöglichkeiten – vom klassischen PC über Tablets bis hin zum Smartphone – hat zu einer „permanently online, permantly connected“-Kultur (Vorderer 2015) geführt. Telekommunikationsanbieter („Provider“) stellen die Nabelschnur dar, über die Rezipienten mit einem nahezu unüberschaubaren Medienangebot konfrontiert sind. Gleichzeitig zeigt sich auf der Rezeptionsseite sehr deutlich der „Generationenabriss“ (Best und Engel 2016, S. 25). Die vor 1980 Geborenen nutzen tendenziell stärker klassische Massenmedien ergänzt um Internet-Plattformen. Für die nach 1980 Geborenen nimmt hingegen das Internet die zentrale Position im Medienmix ein. Das bedeutet nicht, dass die gedruckte Zeitung, das Radio oder klassisches Fernsehen verschwinden werden. Für die Mehrzahl der Nutzer sind TV und Radio noch immer die wichtigsten massenmedialen Informationsquellen. Allerdings verändern sich die Nutzungsformen und der symbolische Charakter der Medien, z. B. im Kontext von Second Screen. Die Jüngeren nutzen diese Massenmedien überwiegend im Internet (Engel 2015). Dadurch verändern sich die Nutzungsformen und der symbolische Charakter der Medien, z. B. im Form von paralleler Nutzung über Second Screen, durch Rezeption von Feeds bzw. Streams oder das Teilen von Medieninhalten über soziale Netzwerke.
Die von Mast als zweite große Entwicklung identifizierte Grenzaufhebung zwischen Individual- und Massenkommunikation wurde in jüngerer Zeit v. a. von neuen Plattformen wie Facebook oder YouTube vorangetrieben. Castells (2009) spricht hier von „mass-self communication“. Potenziell hat jeder Nutzer die Möglichkeit, über Plattformen entweder ein sehr spezifisches Publikum (Freunde, Follower) oder ein disperses Publikum anzusprechen. Mit der verstärkten Professionalisierung und Ökonomisierung der digitalen Sphäre greifen zugleich typische Skaleneffekte („the winner takes it all“). Viele klassische Medienmarken konnten ihre Reichweite und Markenbekanntheit in den digitalen Raum übertragen. Sie stehen dort aber immer stärker im Wettbewerber mit neuen Anbietern wie Facebook, Amazon, Google oder Netflix. Deren Marktmacht liegt in ihren technologisch ausgereiften Plattformen begründet, die eine hohe Reichweite haben. War früher der Vertrieb z. B. der Zeitungsinhalte komplett an das Printprodukt und damit auch den Verlag selbst gekoppelt, ist digitaler Inhalt nicht mehr länger plattformgebunden. Die große Reichweite der neuen Distributionsplattformen zwingt auch Medienproduzenten, diese zu nutzen. So ist z. B. ein substanzieller Teil des Netto-Werbebudgets bereits zu den Online-Plattformen hin verlagert worden, nur in die Fernsehwerbung wird noch mehr investiert (BVDW 2015).
Auch die dritte Grenzaufhebung zwischen den Bereichen medialer Aussagenentstehung und kommunikationstechnischer Vermittlung lässt sich unter den aktuellen Rahmenbedingungen neu betrachten: Einerseits schreitet die Entgrenzung des Journalismus durch die Differenzierung der Berufsbilder weiter fort (Lilienthal et al. 2015). Crossmediale Ausspielkanäle erfordern neue Fähigkeiten, die bestehende Anforderungsprofile erweitern oder gänzlich neue Berufsbilder wie Informationsvisualisierer oder Datenjournalist entstehen lassen. Andererseits entstanden neue Bereiche und Mischformen von Content-Produktion bis hin zum Content-Marketing. Journalistische Inhalte werden nicht mehr nur von klassischen Medienanbietern erstellt. Organisationen – vom Verein bis hin zum Weltkonzern – sind zu integrierten Medienproduzenten geworden. Das klassische (gedruckte) Kundenmagazin weicht einer crossmedialen Plattform, die die Marke auf verschiedenen Kanälen erlebbar macht. Die großen Technologie- und Plattformanbieter Google, Facebook oder auch Samsung und Apple drängen als „digitale Konglomerate“ in die Welt der Medien und Meinungen (Altmeppen 2016). Verlage und andere Produzenten von Inhalten entwickeln neue Geschäftsmodelle: Nachrichten werden zur Ware, die als „newsonomics“ (Verbindung von „news“ und „economics“) von Echtzeit-Kennzahlen dominiert werden (Doctor 2010). Was nicht geklickt wird gilt als uninteressant. Was keine Reichweite aufbaut liefert auch keinen ökonomischen Nutzen.
1.2Entstehung neuer Medienlogiken: Vermittlungsleistungen digitaler Medien
„Neue Medien sind mehr als nur zusätzliche massenmediale Angebote, [sie sind] telekommunikative Leistungsmöglichkeiten, die das Kommunikationssystem als Ganzes verändern können“ (Mast 1986, S. 41).
Im Kontext der Grenzaufhebungen veränderten sich in den 1980er Jahren auch die Vermittlungsleistungen der Telekommunikation. Mast beobachtete eine Steigerung telekommunikativer Vermittlungsleistungen, die in fünf Kriterien sichtbar geworden sei:
- zielgenaue Vermittlung: Die „Zielung der Vermittlungsleistung“ im Sinne einer gezielteren Ansprache von Publika (Mast 1986, S. 55) erfolgt nicht mehr länger nur in der Dialogkommunikation. Sie wird auch durch neue Abruf- oder Zugriffsmedien (z. B. Fernkopiermedien, schnurloses Telefon, Teletextsysteme, Pay-TV) erbracht;
- schneller Transport und Zugriff auf Aussagen: Telekommunikationsmedien sind den „Speichermedien“ (z. B. bedrucktes Papier; ebd., S. 56) auch in der Geschwindigkeit des Mitteilungstransports überlegen. „Die elektronische Speicherung befreit die telekommunikativen Mitteilungsprozesse aus der zeitlichen Gebundenheit und steigert die zeitliche Disponibilität“ (ebd., S. 59);
- Erschließung differenzie...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Was leisten die Medien? Revisited!
- Teil 1: Journalismus
- Teil 2: Public Relations
- Teil 3: Interne Kommunikation
- Teil 4: Organisationskommunikation
- Chronik Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft, insb. Journalistik
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Impressum