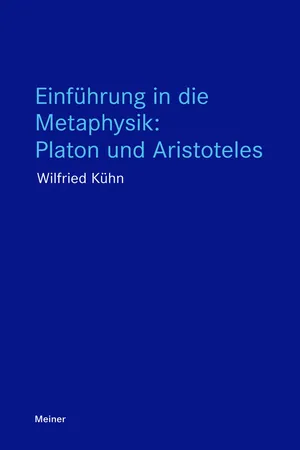
- 240 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Einführung in die Metaphysik: Platon und Aristoteles
Über dieses Buch
Wenn man dem Sophisten Protagoras folgt, kommt uns die Wirklichkeit nur deshalb stabil vor, weil unsere sprachlichen Ausdrücke und Formen konstant sind. An sich aber unterliegt die Wirklichkeit unausgesetzten Veränderungen. Dann wäre alles, was wir sagen, in dem Sinn falsch, dass es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Metaphysik (wie Platon und Aristoteles sie betrieben haben) ist nun das theoretische Unternehmen, das diese sophistische Auffassung von Sprache und Wirklichkeit widerlegen will. Sie zielt deshalb darauf ab, durch Reflexion auf bestimmte Formen des Denkens und Sprechens dauerhafte Strukturen alles Wirklichen zu konzipieren, und argumentiert, dass nichts existieren kann, was nicht so strukturiert ist. Die Aufgabe metaphysischer Theorien ist also die Begründung der Möglichkeit wahrer Aussagen und, darüber hinaus, von Wissen.
Dieses Buch führt in die philosophische Disziplin der Metaphysik ein, indem es die beiden wirkmächtigsten metaphysischen Theorien der Antike im Grundriss interpretiert: die Ideenlehre Platons und Aristoteles' »Erste Philosophie«. Der Autor macht die Quellentexte verständlich, indem er ihre Funktion im historischen Zusammenhang und ihre Aussage mittels der Grundformen der Sprache und des Denkens erklärt. Dabei leitet ihn die Frage, inwieweit die beiden Lehren begründet sind und in welchen Hinsichten sie durch ihre nicht reflektierten Voraussetzungen unhaltbar werden.
Wie Michael Theunissen es einmal formulierte, haben die Grundbegriffe, die die Philosophie in der Antike entwickelte, »Denkmöglichkeiten ausgeschlossen und … die weitere Entwicklung gelenkt«. Deshalb ist die Beschäftigung insbesondere mit den Metaphysiken Platons und Aristoteles' eine unentbehrliche Voraussetzung für das Verstehen der nachfolgenden mittelalterlichen und neuzeitlichen Theorien.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Einführung in die Metaphysik: Platon und Aristoteles von Wilfried Kühn im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Geschichte & Theorie der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
B. Grundzüge der aristotelischen Metaphysik
I. Einleitung
1. Womit haben wir es zu tun?
a) Eine schwer zu fassende Theorie
Wie Goethe ist Aristoteles eine Welt, aber wohl kaum eine wohlgeordnete, ein Kosmos. Seit der Antike versuchen die Kommentatoren, die Ordnung der aristotelischen Welt aufzudecken. Der kopernikanische Interpret wurde jedoch noch nicht gefunden, die vielfachen Deutungsvorschläge gleichen eher denjenigen, die die mittelalterlichen Astronomen zur Verbesserung des ptolemäischen Weltmodells machten. Offenbar leistet Aristoteles’ Werk dem Interesse an Einfachheit und Übersichtlichkeit mehr Widerstand als das Sonnensystem.
Das ist nicht besonders erstaunlich, wenn man zwei Umstände berücksichtigt: Dieses Werk ist in Vorlesungsmanuskripten überliefert, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren; Aristoteles’ Philosophie und insbesondere seine Metaphysik haben sich mit der Zeit entwickelt. Sie können also nicht davon ausgehen, dass die überlieferten Schriften eine Konzeption aus einem Guss enthalten. Ohne Aristoteles zu unterstellen, er habe bestimmte Theorieelemente bewusst nur provisorisch erprobt, kann man rückblickend sagen, dass die Vorlesungstexte eher Experimentiercharakter haben. Deshalb werde ich auch in meinem Leitfaden zum Studium der Metaphysik nicht versuchen, schwer oder gar nicht vereinbare Elemente der Theorie zu harmonisieren und Schwierigkeiten zu verdecken, die auch kundige Interpreten nicht ausräumen konnten. Im Gegenteil, ich werde auf einige hinweisen.
b) Ein erfolgreiches Grundkonzept
Platons Ideenlehre war attraktiv, weil sie die Welt, die physische wie die soziale, mit der wir es zu tun haben, als vorläufig, provisorisch erscheinen ließ und zugleich eine Perspektive auf rationale Politik, auf eine grundlegende Verbesserung der Ordnung des Zusammenlebens der Menschen eröffnete. Im Höhlengleichnis hat Platon diese Konzeption zu einem Bild verdichtet, dem die Widerlegungen der Ideenlehre nichts anhaben konnten.
Aristoteles’ Metaphysik war attraktiv, weil sie ein einfaches Schema zur Einteilung der erfahrbaren physischen Welt einführte, die – uns selbstverständlich gewordene – Unterscheidung zwischen Dingen (Substanzen) und ihren Eigenschaften (Akzidenzien). Da sie die Eigenschaften noch einmal in verschiedene Gattungen wie Quantität und Qualität einteilte, schien die Metaphysik die Welt übersichtlich zu machen. Denn man konnte meinen, dass diese Metaphysik erlaubt, von jedem Wirklichkeitselement, das wir mit einem sprachlichen Ausdruck bezeichnen, ganz allgemein zu sagen, worum es sich da handelt, um eine Substanz (ein selbständiges Ding oder Lebewesen), eine Qualität, eine Beziehung, ein Tun usw.
Zweifellos war das ein bestechendes Ordnungsschema, das wir immer noch gebrauchen. Aber der Anspruch auf Vollständigkeit, mit dem es – wie jede philosophische Theorie – auftrat, ist illusionär. Sie brauchen nur an die Gesetze, physikalische wie politische, zu denken, um das zu bemerken: Sie sind weder Substanzen noch Eigenschaften von solchen, haben also in Aristoteles’ Metaphysik keinen Platz, obwohl sie bestimmen, wie sich Substanzen, Körperdinge oder Bürger, verhalten.62 Insofern markiert Galileis Entdeckung der Fallgesetze das Ende der von Aristoteles dominierten Epoche der Wissenschaftsgeschichte.
Ungeachtet ihres überzogenen Geltungsanspruchs stellte die aristotelische Metaphysik einen schwer zu überschätzenden Fortschritt dar, denn mit ihr arbeitete Aristoteles als erster einen allgemeinen begrifflichen Rahmen für die wissenschaftliche Erkenntnis der Welt der Erfahrung aus. Um diese Leistung auch nur ansatzweise ermessen zu können, sollte man sich die Grundkonzepte von Vorgängern vergegenwärtigen, insbesondere die von Parmenides und Platon.
2. Parmenides
a) Wissen nur vom »Seienden«
Aristoteles’ Metaphysik wird von ihm selbst und seinen Interpreten als eine Theorie des Seins verstanden. Dass das so ist und was es bedeutet, können Sie nicht verstehen, ohne auf Parmenides zurückzugehen. Denn er hat die These formuliert, dass es kein Denken ohne das »ist« gibt und dass das »ist nicht« nicht gedacht werden kann (DK I 28, B 2 u. 8, 34–36). Eine paradoxe These angesichts der Tatsache, dass wir ständig Negationen, auch Negationen von »ist« aussprechen.
Wenn man sich fragt, wie die These dennoch wahr sein kann, erlaubt einer der verschiedenen Sinne von »ist« eine Antwort. Die These ist nämlich unter der Bedingung wahr, dass sie etwas von der Form der Aussagesätze, sofern sie im Unterschied zu Fragen und Bitten Behauptungen sind, betrifft: Wir können sie nicht aussprechen, ohne zu denken und verstehen zu geben, dass es so ist, d. h. sich in Wirklichkeit so verhält, wie wir sagen; anders gesagt, dass das, was wir sagen, wahr ist. Dagegen können wir nicht etwas behaupten und zugleich denken, dass es nicht so ist. Natürlich können wir uns mit unserem subjektiven Fürwahrhalten irren, objektiv kann es sich anders verhalten, als wir behaupten.
Sie könnten den Fall der Lüge einwenden, die man doch mit dem Gedanken begleitet, dass es sich nicht so verhält, wie man behauptet. Darauf ist zu erwidern, dass sich die Lüge parasitär zur Behauptung verhält, sofern sie nämlich nur gelingt, wenn der Belogene glaubt, dass der Lügner für wahr hält, was er sagt; die Lüge setzt also als Form der Behauptung das Fürwahrhalten der Aussage voraus.
Zurück zu Parmenides’ These, Denken sei notwendig Denken von »ist«. Wenn man Denken im Sinn von Behaupten versteht und das »ist« als »ist wahr«, kann man sagen, dass die These zutrifft. Das ist der veritative Sinn von »ist«, den Aristoteles als erster von anderen Sinnen des »ist« unterschied. Allerdings fasste Aristoteles den veritativen Sinn in der Weise auf, dass man eigens »Es ist so, dass« sagt, um im Sinn einer Bestätigung auszudrücken, dass irgendeine konkrete Aussage, die auch eine Negation (»Es regnet nicht«) sein kann, wahr ist: »Es ist so, dass es nicht regnet«.63
Parmenides unterschied aber noch nicht verschiedene Sinne von »ist« oder »sein«, ebenso wenig die Form der Behauptungen von ihrem Inhalt. Deshalb machte er aus der entdeckten Form einen Gegenstand, den Gegenstand der Erkenntnis schlechthin. Dabei kam ihm die griechische Sprache entgegen oder verführte ihn, sofern sie das Partizip auch eines so abstrakten Verbums wie »sein« umstandslos zu verwenden erlaubt. So bildete Parmenides, vom Interesse an umfassendem Wissen geleitet, aus der allgemeinen Form der Behauptungen den abstraktesten aller Gegenstände, »das Seiende«.
Das Wissen besteht dann aus Erkenntnissen vom Seienden, derjenigen z. B., dass es eines ist (DK I 28, B 4 u. 8, 6). Damit überträgt Parmenides die Einheit des Wortes »Seiendes« auf dessen Referenten, d. h. auf das, was man mit dem Wort meint. Wenn das Seiende aber eines ist, kann man es nicht in Gattungen aufteilen, die Unterthemen des Wissens abgäben. Wissen erschöpft sich also in der Bestimmung des einen Seienden. – Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich davon das Wissen von den Ideen nach Platon, denn es bezieht sich auf eine Vielheit von Gegenständen; dasselbe gilt für das, was Aristoteles unter Wissen versteht.
b) Wissen nur vom Ewigen
Ungeachtet dessen müssen Sie im Hinblick auf Platon und Aristoteles aus Parmenides’ Darstellung des Wissens das Theorem zur Kenntnis nehmen, dass das Seiende ewig ist, weder entstanden sein noch vergehen kann (ebd. B 8, 5–21). Warum soll es sich so verhalten? Weil die Voraussetzungen für Entstehen und Vergehen des Seienden unannehmbar sind, was Parmenides mit zwei Argumenten formuliert:
(1) Vor und nach dem Zustand des »ist« müsste es den des »ist nicht« geben; den aber kann man nicht denken.
(2) Damit es entstehen und vergehen könnte, dürfte das Seiende nicht existieren, bevor es existiert und nachdem es existierte.
Von der Sprache her gedeutet, betrifft das erste Argument das bloße Aussagen, das in der Tat nicht mit dem veritativ verstandenen Gedanken »ist nicht (wahr)« zusammen vollzogen werden kann, ganz gleich, wovon jeweils die Rede ist, was also das Subjekt der Aussage ist. Genau darauf kommt es aber in dem zweiten Argument an, denn es bedeutet, dass es widersprüchlich ist, vom Seienden zu sagen, es existiere nicht – wenn auch Parmenides noch keinen Begriff und Terminus für den Widerspruch hat.
Beide Argumente haben keinen Bestand, wenn wir sie kritisch betrachten. Denn das erste Argument trifft wohl für das veritative »ist nicht« zu. Es müsste aber auf das Nicht existieren angewandt werden, um dieses zutreffend auszuschließen, denn Entstehen und Vergehen, die Parmenides bestreitet, sind ja die Übergänge zwischen Existenz und Nichtexistenz. »Existiert nicht« kann man aber wohl denken. So führt im ersten Argument die Nichtunterscheidung der Sinne von Sein (Existenz und Wahrsein) zur Bestreitung von Entstehen und Vergehen.
Das zweite Argument ist schlicht und einfach zirkulär, denn in ihm wird das Seiende von vornherein nicht als das zu einer bestimmten Zeit Existierende, also vielmehr als das immer Existierende oder als das Zeitlose verstanden. Von einem zu einer bestimmten Zeit Existierenden könnte man ja widerspruchsfrei sagen, es existiere zu einer anderen Zeit nicht. Also wird vom Seienden schon vorausgesetzt, was das Argument zeigen soll, dass es nämlich immer oder nicht in der Zeit existiert.
Rückblickend muss man also sagen, dass Parmenides’ Festlegung, die Platon uneingeschränkt und Aristoteles ganz abgeschwächt akzeptierten, nach unseren Begriffen nicht gerechtfertigt ist, die Festlegung, dass alles, was entsteht und vergeht, aus dem Bereich der Gegenstände des Wissens ausgeschlossen ist.
Aber sind denn nicht Entstehen und Vergehen durch Erfahrung evident und insofern gewusst, und hat nicht Parmenides’ älterer Kollege Heraklit die Vernünftigkeit des Naturgeschehens gerade darin gesehen, dass das Werden die Gegensätze wie den von Tag und Nacht zu einer Einheit verbindet (DK II 22, B 57)? Um diesem Einwand zu begegnen, erfand Parmenides die Unterscheidung von Wirklichkeit und Schein: Die Sinne und die gängigen Reden, auch die des Heraklit, täuschen uns, wenn wir sie nicht mit der rationalen Überlegung des Parmenides überwinden und erkennen, wie es sich wirklich verhält (DK II 28, B 7, 3 – 8, 1; 8, 51–52 u. 60–61; 19, 1). Parmenides disqualifiziert also unsere Erfahrungen als Schein, um als Wirklichkeit das Seiende auszuzeichnen, das ihm als der einzig adäquate Erkenntnisgegenstand erscheint – als liefere die Form der Behauptung (»Es ist so und nicht anders«) einen solchen Gegenstand.
3. Platon
Aristoteles’ Lehrer hat das Muster der Konzeption des Parmenides übernommen: Die Welt der sinnlichen Erfahrung genügt nicht den Anforderungen, die an Erkenntnisgegenstände zu stellen sind, insbesondere Eindeutigkeit und Unwandelbarkeit (denken Sie an die Gegenstände der Mathematik!). Wie Parmenides schließt Platon aus dieser Unzulänglichkeit der Erfahrungsdinge, dass wir uns täuschen, wenn wir sie für wirklich (»seiend«) halten (Staat VII, 515 b–c). Welche Voraussetzung erlaubt es den beiden Denkern, diese fundamentale These zu vertreten?
Sie müssen die unbestreitbare Annahme (A), dass alle Erkenntnisgegenstände wirklich sind, in dem Sinn umgekehrt haben (B), dass alles Wirkliche erkennbar ist; dann (C) kann, was nicht erkennbar oder wissbar ist, auch keinen Anspruch auf Wirklichkeit (»Sein«) erheben.64 Wenn wir die wandelbaren, mehrdeutigen Erfahrungsdinge trotzdem für wirklich halten, liegt das Parmenides und Platon zufolge daran, dass sie uns so erscheinen, Wirklichkeit vortäuschen. Da der Schein gerade darauf beruht, dass er nicht als solcher durchschaut wird, leben wir alle in der Verblendung, in unseren Erfahrungen hätten wir es mit der Wirklichkeit zu tun.
Nur die Philosophen überwinden die Verblendung, definieren nach Vernunftkriterien, was wirklich ist, und heben es von den ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Einleitung
- A. Grundzüge von Platons Ideenlehre
- B. Grundzüge der aristotelischen Metaphysik
- Bibliographie
- Siglenverzeichnis
- Personenregister
- Sachregister