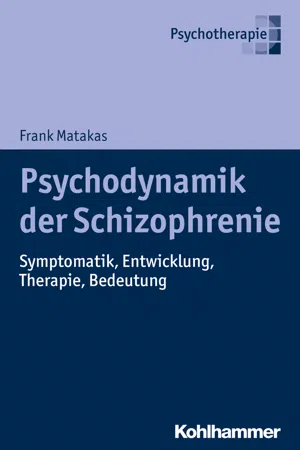![]()
1 Symptome und Erscheinungsweisen
1.1 Psychotische Symptome
1.1.1 Versuch einer Definition
Psychische Symptome, wovon die psychotischen Symptome eine Untergruppe sind, können wir als Ausdruck einer Funktionsstörung der Psyche verstehen. Aber was ist eine Funktionsstörung der Psyche? Das ist nicht immer eindeutig festzulegen, weil die Funktionen des psychischen Apparates nur im Hinblick auf die soziale Umwelt zu bestimmen sind. Und die soziale Umwelt ist nicht eindeutig. Ein etwas zwanghafter Charakter ist in unserer Gesellschaft erwünscht. Rücksichtslosigkeit gegenüber niederen Ständen würde in einer Herrscherfamilie des Mittelalters als gute Eigenschaft gelten, heute eher als Mangel. Ein Mensch mit einer katatonen Bewegungsstarre wird in Indien u. U. als heiliger Mann (Sadhu) verehrt (Doniger, 2009).
Wir haben keinen sicheren Maßstab dafür, was wir als psychische Störung ansehen sollen, was nicht. Halten wir uns an die alten Psychiater (z. B. Schneider, 1950), so sind als Symptom anzusehen Verhaltensweisen oder Zustände, an denen der Betroffene oder die Menschen seiner Umwelt leiden. Die depressive Gemütsverfassung ist ein Symptom, weil der Depressive an seinem Gemütszustand leidet. Wenn jemand permanent auf der Straße herumschreit, gilt das als Symptom, weil die Öffentlichkeit Anstoß daran nimmt. Aber auch z. B. selbstverletzendes Verhalten oder das Hungern im Rahmen einer Magersucht gelten als Symptom, obwohl der, der es ausführt, nicht unbedingt darüber klagt, noch die Gesellschaft dadurch belästigt wird. Verbunden mit Frömmigkeit wird es u. U. und in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen als besondere Tugend angesehen. Die Definition des Begriffs des Symptoms ist also nicht streng an das Leiden irgendeines Menschen gebunden. Darum nehmen wir zu dem Begriff der Normalität Zuflucht. Psychische Symptome sind Verhaltensweisen oder Zustände, die nicht normal sind. Man schneidet sich normalerweise nicht mutwillig mit einer Rasierklinge. Aber was ist normal?
1.1.2 Kommunikative Bedeutung
Mit der Kennzeichnung eines bestimmten Verhaltens als Symptom sehen wir von dem Bedeutungsgehalt und seinem kommunikativen Charakter ab und tun so, als ob Menschen ohne Bezug auf ihre soziale Situation diese sogenannten Symptome entwickeln. Das gilt besonders für die psychotischen Symptome, weil sie implizit auf eine Diagnose, nämlich die Psychose hinweisen. Aber psychische Symptome haben immer eine kommunikative Bedeutung. Goffman (1969) geht noch etwas weiter und meint von den psychotischen Symptomen, dass sie Beziehungsprobleme zum Ausdruck bringen. Wenn also ein Anstaltsinsasse der Anstaltsleitung Pläne für den Umbau der Gebäude, die er auf Butterbrotpapier gekritzelt hat, zukommen lässt, wird der Psychiater dies im Regelfall als unrealistisches Verhalten werten. Er wird darin keine ernst zu nehmende Botschaft sehen. Aber für den, der dieses »Symptom« aufweist, ist es eben doch eine Botschaft, und die Attribution dieser Handlung als Symptom verweigert dem Urheber die Kommunikation. Das Problem ist dann natürlich, welche Botschaft es ist; denn naiv, dass es nur um den Umbau geht, wird man das nicht verstehen wollen. Ähnlich ist es in Familien, die sich aber meist umgekehrt von dem fesseln lassen, was der Inhalt des Symptoms sagt. Den Sohn, der sich in sein Zimmer zurückzieht, versuchen die Eltern unablässig davon zu überzeugen, dass er nicht von einer Gangstergruppe gesucht wird, was der Sohn als Grund für seinen Rückzug angibt. Aber das bleibt natürlich ohne Effekt. Einfach wörtlich nehmen und naiv verstehen, was im Symptom ausgedrückt wird, ist auch keine Lösung.
Für die Behandlung eines psychotischen Menschen ist es wichtig zu verstehen, was er durch das Symptom mitteilen will. Es gibt einmal einen aktuellen Bezug, der meist nur zu verstehen ist, wenn man den sozialen Kontext, in dem das Symptom geäußert wird, kennt. Herr O, der die Ärztin des Krankenhauses fragt, ob in den Wänden Strom sei, fürchtet, dass sie das Thema Scheidung anspricht (
Kap. 1.4.1). Die eigentliche Bedeutung dieser Frage ist damit klar. Der junge Mann, der fürchtet, von einer Gangstergruppe gekidnappt zu werden, meint vielleicht seine Eltern. Vielleicht fürchtet er, dass die Eltern ihn total vereinnahmen. Und Julia, die nach der Untersuchung beim Psychiater meinte, jetzt sei eine Ratte in sie hineingesprungen, wollte damit ihr Verständnis von Psychose, die der Psychiater ihr zugeschrieben hatte, zum Ausdruck bringen. – Dieses letzte Beispiel ist auch Anlass, auf ein Faktum hinzuweisen, welches hinter allem steht, nämlich die Not, aus der heraus erst das psychotische Symptom entsteht.
Die produktiven psychotischen Symptome sind zweitens auch häufig verzerrte Beschreibungen einer kindlichen Erfahrung. Sie teilen insofern etwas über die kindliche Entwicklung mit. Halluzinationen geben oft Stimmen der Eltern wider; was diese wirklich oder vermeintlich gesagt haben oder auch was die Beziehung zu den Eltern beschreibt. Gedankenentzug kann man verstehen als die kindliche Erfahrung, etwas nicht denken zu dürfen, Gedankeneingebung als die Erfahrung, etwas denken zu müssen, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten als die Erfahrung kontrolliert, beeinflusst oder manipuliert zu werden. Das hat schon Tausk früh beschrieben (1919). Im Verlauf einer Therapie hört man nicht selten, dass die halluzinatorischen Stimmen für die Patienten als Stimmen der Eltern erkennbar werden.
1.1.3 Interaktive Bedeutung
Produktive psychotische Symptome sind oft eine Form der Handlung. Manchmal sind sie es direkt durch auffällige Verhaltensweisen.
Herr Fe z. B. schellt bei der Nachbarsfamilie, geht, als ihm die Tür geöffnet wird, ohne ein Wort zu sagen, ins Kinderzimmer und legt sich dort ins Bett. Oder ein »Berber« schreit auf der Straße.
Aber selbst wenn sich der Berber mit halluzinierten Stimmen unterhält, sofern die Umwelt davon etwas mitbekommt, hat es etwas Provozierendes, was auch eine Form von Handlung ist. Die Botschaft, die dahinter steckt, kann leicht übersehen werden.
Das psychotische Symptom, besonders wenn es Handlung ist, verletzt die gesellschaftlichen Normen und ist insofern eine Provokation, die man als Protest verstehen kann (Goffman, 1969). Da die Botschaft des Symptoms oft nicht direkt erkennbar ist, ist der Protest in der Regel das einzige, was zunächst imponiert. Der Protest lässt nicht erkennen, wie er sich begründet. Das führt leicht dazu, dass über eine mögliche Begründung weder vom Kranken noch von der Gesellschaft nachgedacht wird. Man versteht nicht, warum der Kranke so handelt. Die kommunikative Bedeutung des Symptoms bleibt unerkannt. Der nächste Schritt ist, dass diese Leerstelle gefüllt wird, indem Krankheit als Begründung und Erklärung herangezogen wird. Das bedeutet, dass die Möglichkeit einer sachlichen Begründung gar nicht mehr in Erwägung gezogen wird. Als das einzig Sinnvolle erscheint eine Behandlung, die von der Gesellschaft erwirkt wird, oft genug auch ohne Zustimmung des Betroffenen.
Herr Pal, ein psychotischer junger Mann, versucht gegen den Widerstand der Mutter, sich gewaltsam Eingang in deren Wohnung zu verschaffen. Dafür hat er sich mit einem schweren Stein bewaffnet Da er vordem schon wegen einer Psychose in psychiatrischer Behandlung war, ruft die Mutter sofort die Polizei, die den jungen Mann in eine Klinik bringt.
In der aktuellen Situation war das eine sinnvolle Lösung. Aber, wie es die Regel ist, hat sich keiner der Beteiligten, nicht die Mutter, nicht der Sohn, nicht der behandelnde Psychiater die Frage gestellt, was da eigentlich passiert ist. Nach einer Behandlung mit Neuroleptika in der Klinik ist der Sohn friedlich und stimmt mit allen darüber überein, dass sein Verhalten krankhaft war. Für die Beteiligten ist das Ereignis damit ausreichend erklärt – obwohl die Mutter doch um ihr Leben gefürchtet hat. Die nahe liegende Frage, was der Sohn eigentlich von der Mutter wollte und warum er seine Forderung gewaltsam zum Ausdruck brachte, wird nicht gestellt.
Dabei ist die interaktive Bedeutung solcher Ereignisse oft nicht schwer zu erkennen, besonders, wenn es sich im familiären Rahmen abspielt. Herr Pal will etwas von seiner Mutter erzwingen, und sie fühlt sich bedroht. Wir begnügen uns also nicht damit, festzustellen, dass der Sohn psychotisch und darum gewaltsam ist und die Mutter Hilfe sucht. Wir fragen nach der Bedeutung dieser Auseinandersetzung. Diese Sichtweise ist in diesem Buch gewissermaßen selbstverständlich und wird immer wieder ohne besondere Ankündigung eingenommen.
Auch Psychotherapeuten vergessen nicht selten diese Frage nach den Gründen. In vielen Arbeiten, die sich mit der Psychotherapie psychotischer Patienten beschäftigen, wird beschrieben, dass im Verlauf der Therapie die psychotische Symptomatik extreme Ausmaße annimmt. Die Bemühungen der Therapeuten erscheinen fast heroisch. Übersehen wird dabei die interaktive Bedeutung dieser Entwicklung. Als Beispiel sei hier eine jüngere Arbeit zitiert, ein Bericht von Koehler (2009). Er beschreibt die Psychotherapie des Patienten Joseph, der eine schizophrene Psychose hat. Im Verlauf einer hochfrequenten Therapie wird die produktive Symptomatik von Joseph immer heftiger. Aber Koehler erwägt nicht die Frage, ob die Verschlimmerung der Symptomatik eine Antwort von Joseph auf die Anstrengung des Therapeuten ist. Darum erkennt der Therapeut nicht, dass er Joseph zu nahe gekommen ist. In früheren Therapieberichten (z. B. Fromm-Reichmann, 1959) findet man viele Beispiele dafür. Da werden Symptome der Patienten beschrieben, die offensichtlich eine Antwort auf die unhaltbaren Zustände in der Klinik waren. So kommt eine Situation zustande, dass Symptome behandelt werden, an deren Zustandekommen der Therapeut bzw. die Institution beteiligt ist.
1.1.4 Der Abwehrcharakter
Kennzeichnend für psychotische Zustände sind die produktiven Symptome. Produktiv ist ein Symptom, wenn ein Gedanke oder eine Verhaltensweise oder eine Empfindung eine Realität behauptet, die nicht existiert. Dabei hinterfragen wir zunächst dieses Vulgärverständnis von Realität nicht.
Herr A hört, wenn er zu Bett gehen will, ein Klopfen des Nachbarn an der Wand, das ihn daran hindert zu schlafen. Das Klopfen kann aber von niemandem bestätigt werden. Seine Beschwerde beim Nachbar weist dieser zurück. Er klopfe nicht.
Dieses Klopfen unterscheidet sich z. B. von einem Tinnitus, weil Herr A sicher »weiß«, dass es der Nachbar ist, der die Klopfgeräusche macht. Wir vermuten darum, dass sich hinter dem Klopfen etwas verbirgt, nämlich dass sich der Klopfer einsam fühlt. Er war es in der Tat. So liegt es nahe, das Klopfen als Abwehr des Wunsches nach Kontakt zu verstehen. Aber was bedeutet in diesem Fall Abwehr? Bei Tobias, einem jungen Mann, der unter leichten Zwangssymptomen litt, aber keine Psychose hatte, lässt sich die Abwehr eindeutig beschreiben. Die Zwanghaftigkeit, mit der Tobias beim Verlassen des Hauses die Haustür immer wieder überprüft, steht im Zusammenhang mit seinem Wunsch, das Elternhaus zu verlassen, und seinen feindseligen Gefühlen gegenüber dem Vater. Tobias will die Tür endgültig hinter sich zuschlagen. Nachdem Tobias Einsicht in den abgewehrten aggressiven Triebwunsch hat, verschwindet das Symptom. Tobias braucht in der Therapie dazu nur die Angst vor seiner Feindseligkeit gegenüber dem Vater auszuhalten. Nicht oft lässt sich bei einer zwangsneurotischen Störung die Symptomatik so schnell auflösen, wie es bei Tobias war.
Aber bei dem Klopfer war es anders. Er sagte offen, dass er sich nach einer Frau sehne, aber mit dem Klopfen habe das nichts zu tun. Er gab eine Anzeige in der Zeitung auf, bekam etwa 50 Zuschriften, die er mir stolz zeigte, und antwortete auf keine, ja öffnete kaum einen Brief. So bestätigte er einerseits den Gedanken, dass seine Einsamkeit ein Problem für ihn war, andererseits war er nicht in der Lage, Kontakte zu anderen Menschen aufzunehmen.
Wie bei Herrn A verraten viele psychotische Symptome relativ offen einen Wunsch:
Eine psychotische Patientin kommt sehr knapp bekleidet in die Sprechstunde. In der folgenden Sitzung mokiert sie sich über die »Lüsternheit« des Arztes und setzt sich weit weg in eine Ecke des Zimmers.
Der Wunsch wird hier ganz offen gezeigt, so wie die Patientin sich gekleidet hat. Wird in diesem Fall etwas abgewehrt, und wenn ja, was? Den Kontaktwunsch hat der Klopfer offen geäußert, die verführerische Dame durch ihre Handlung auch. Was also Triebwunsch bei beiden gewesen sein mag, er wurde nicht abgewehrt. Eher schon, denkt man, wurde die Möglichkeit der Realisierung abgewehrt.
Wir können in beiden Fällen der Auffassung von M. Klein folgen und alternativ in Erwägung ziehen, dass es nicht eine Triebregung ist, die abgewehrt wird, sondern Angst, die durch die Triebregung ausgelöst wird. Es wäre nicht die gleiche Angst, die Tobias spürte. Bei Tobias war es die Angst vor einer aggressiven Empfindung, die er sich nicht gestatten konnte. Bei dem Klopfer und der knapp bekleideten Dame war es vielleicht auch Angst vor einer Triebregung, aber nicht, weil diese nicht erlaubt war, sondern – so müssen wir vermuten – weil sie bedrohlich war.
Wenn wir sagen, dass Tobias sich die Feindseligkeit gegenüber dem Vater nicht gestatten konnte, ist damit gemeint, dass es bei ihm einen intrapsychischen Konflikt gab zwischen einer Triebregung und seiner Moral, seinem Überich in der Terminologie der Psychoanalytiker. Die Feindseligkeit war in dem Zwangssymptom verborgen. Es war also insofern ein Problem von Tobias allein. Auch als er den Konflikt, der dem Symptom zugrunde lag, noch nicht kannte, war es für ihn doch ein seelisches Problem. Die Zwangssymptome hat er sich allein zugeschrieben. Der Klopfer aber verlegt, wie es für die Psychose typisch ist, den Konflikt nach außen, in die Realität. Der Wunsch, der sich in dem Symptom verrät, muss also nicht abgewehrt werden, sondern die Realisierung. Die erotische Triebregung an sich, so müssen wir folgern, hat der verführerischen Dame keine besonderen Schwierigkeiten gemacht. Es muss etwas anderes sein, was abgewehrt wird, nämlich irgendeine Form der Realisierung. An späterer Stelle wird von diesem Problem noch mehrfach die Rede sein. Menschen mit einer psychotischen Störung können sich nur begrenzt oder gar...