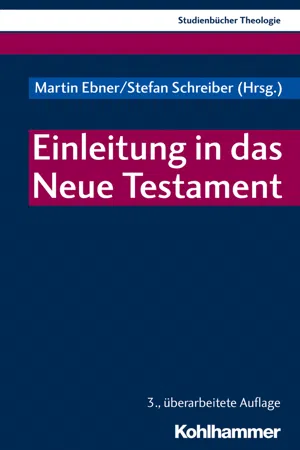
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Einleitung in das Neue Testament
- 614 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Einleitung in das Neue Testament
Über dieses Buch
Well-structured and easy to read the authors of this textbook present this introduction on level with the current academic debate. The writings are at the centre of the work. They are organised in four thematic blocks, preceded by general topics (questions on synopsis, pseudepigrapha). Every writing is analyzed following its structure, its genesis (time, place, author, sources, and hypothesis of separation) and its specific discussion (cultural milieu, situation, content).
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Einleitung in das Neue Testament von Martin Ebner, Stefan Schreiber, Martin Ebner,Stefan Schreiber, Christian Frevel,Gisela Muschiol,Dorothea Sattler,Hans-Ulrich Weidemann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Biblische Studien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
D. Die Briefe
D.I. Briefliteratur im Neuen Testament
In der Antike diente der Brief allgemein als Kommunikationsmittel zwischen räumlich getrennten Partnern, das ein persönliches Gespräch ersetzt. Cicero (106–43 v. Chr.) z. B. beschrieb den Brief als »Gespräch voneinander getrennter Freunde« (amicorum conloquia absentium; Phil 2,7) und sieht die Distanz zum Adressaten beim Schreiben kurzzeitig überwunden: »mit dem Blick auf dich in der Ferne (absentem) und gleichsam vor dir sitzend (quasi coram tecum)« (Fam II 9,2). Natürlich kennen wir den Brief in dieser Funktion auch heute noch, doch kam ihm in der Antike angesichts des Fehlens anderer Formen distanzüberwindender Kommunikation wie Telefon, EMail, SMS oder Skype besondere Bedeutung zu – heute muss die Post werben: »Ein Brief verbindet« (2003). Im Gegensatz zu heute wurde die Briefübermittlung in der Antike jedoch dadurch erschwert, dass kein öffentlich zugängliches Postnetz zur Verfügung stand.
1. Briefpraxis
Die Briefpraxis der Antike unterschied sich in markanten Punkten von heutigen Gewohnheiten. Daher zunächst ein Blick auf die Realien (dazu H.-J. Klauck, Briefliteratur 55–70). Als Beschreibmaterial für Briefe benutzte man Holz, Blei- und Wachstäfelchen, Leinen, Leder und Tonscherben, vor allem aber Papyrus (→ A.II.1.). Auf Täfelchen wurden Buchstaben eingeritzt, auf die anderen Materialien schrieb man mit einer aus Ruß hergestellten Tinte und einem Schreibrohr aus Schilf, das schräg angespitzt war. Lesen und Schreiben zählten übrigens zum Unterricht in den antiken Elementarschulen, so dass diese Fähigkeiten weiteren Kreisen, wenn auch in unterschiedlichen Graden, zugänglich waren. Dennoch war es geläufige Praxis, sich beim Verfassen eines Briefs der Unterstützung eines »Profis« zu bedienen: Man diktierte den Brief einem kundigen Schreiber oder einer Schreiberin. Dies trifft auch auf Paulus zu, wie das Ende des Röm zeigt: In Röm 16,22 meldet sich der Schreiber Tertius (mit Grüßen) zu Wort. Wenn Cicero seinem Bruder Quintus und dem Freund Atticus in der Regel eigenhändig schreibt, signalisiert dies besondere Verbundenheit und Freundschaft; doch wenn die Umstände es angesichts von Krankheit oder Zeitnot erfordern, greift auch Cicero auf die Praxis des Diktats zurück (Quint Fratr III 1,19; Att IV 16,1; V 17,1; VIII 12,1; 13,1). Der Verfasser oder die Verfasserin setzte dann zum Teil eigenhändig einen Schlussgruß mit Unterschrift unter das fertige Schreiben. Im Postskript eines Briefes an Atticus (Att XIII 28,4) merkt Cicero an, nun eigenhändig zu schreiben; auch eine heikle Angelegenheit spricht er lieber mit eigener Feder an (Att XI 24,2). Paulus legt in Gal 6,11–18 noch einmal sein ganzes persönliches Gewicht in die abschließenden Worte aus eigener Hand (vgl. 1 Kor 16,21; Phlm 19; 2 Thess 3,17; Kol 4,18).
Hatte man den Brief beendet, faltete man das Papyrusblatt zusammen und schrieb auf die Außenseite die Adresse. Damit begannen die Schwierigkeiten der Beförderung. Nachdem ein Postsystem nur für die Staatspost existierte, musste alle nichtstaatliche Post durch private Boten und Botinnen (z. B. eigene Sklaven und Sklavinnen) oder Reisende, die man kannte und denen man seinen Brief anvertrauen wollte, überbracht werden. Dass hierbei Verzögerungen und Ausfälle auftraten, verwundert nicht. Die pln Gemeinden und Paulus selbst vertrauten dabei offenbar auf Boten und Botinnen aus den eigenen Reihen; ein intensives Beziehungsgeflecht ermöglichte diverse Briefsendungen. Den Boten kam teilweise noch eine zusätzliche wichtige Funktion zu, da sie über den Brief hinaus mündliche Erläuterungen zu dessen Inhalt geben konnten. In Röm 16,1f. empfiehlt Paulus eine Frau namens Phöbe, die offenbar genau diese Funktion der Briefbotin übernommen hatte.
Ein anschauliches Beispiel für einen familiären Papyrusbrief ist aus dem Ägypten des 2. Jh. erhalten; ein zum Militärdienst rekrutierter junger Ägypter mit Namen Apion gibt nach seiner Ankunft im Militärhafen von Misenum (im Golf von Neapel) seiner Familie Nachricht (BGU II 423; H.-J. Klauck, Briefliteratur 29–33):
»Apion dem Epimachos, seinem Vater und Herrn, vielmals zum Gruß.
Vor allem wünsche ich, dass du gesund bist und (dich) stets, indem es dir gut geht, wohl befindest mitsamt meiner Schwester und ihrer Tochter und meinem Bruder. Ich danke dem Herrn Serapis, dass er, als ich in Seenot war, (mich) sofort errettet hat. Als ich nach Misenum kam, erhielt ich als Marschgeld (viaticum) vom Kaiser drei Goldstücke, und es geht mir gut.
Ich bitte dich nun, mein Herr Vater, schreibe mir ein Briefchen, erstens über dein Wohlbefinden, zweitens über das meiner Geschwister, drittens, damit ich Verehrung erweise deiner Hand(schrift), weil du mich wohl erzogen hast und ich aus dem (Grund) hoffe, rasch zu avancieren, so die Götter wollen.
Grüße Kapiton vielmals und meine Geschwister, auch Serenilla und meine Freunde. Ich habe dir geschickt mein Bildchen durch Euktemon. Es ist mein Name Antonius Maximus.
Dass es dir wohl ergehe, wünsche ich.
Zenturie Athenonike.«
2. Klassifizierungen
Um Funktion und Bedeutung antiker Briefe besser einschätzen zu können, sind Klassifizierungen des Briefcharakters hilfreich (grundlegend, mit vielen Beispielen H.-J. Klauck, Briefliteratur 71–147). Angesichts der Fülle und Verschiedenheit des erhaltenen antiken Briefmaterials bleiben solche Einteilungen freilich immer auch subjektiv und eine Frage der Festlegung. Die Übergänge sind teilweise fließend.
(1) Nichtliterarische Briefe: Hierzu zählen weite Teile der antiken Briefüberlieferung, meist als Originalschriften auf Papyrus eher zufällig erhalten und nicht durch Abschriften für die Verbreitung und Überlieferung bestimmt. Als reine Gelegenheits- und Gebrauchsschriften dienten sie ganz aktuellen Absichten, ohne dabei bereits an eine breitere Öffentlichkeit oder gar die Nachwelt zu denken. Weitere Unterteilungen zeigen das Spektrum dieses Brieftyps: Privatbriefe (an Familienmitglieder oder Freunde), amtliche Briefe (an/von Behörden), Geschäftsbriefe. Dazu kommen verschiedene Ausstrahlungen der Briefform in andere Alltagsbereiche wie z. B. magische Beschwörungen (man fand Fluchtäfelchen, die als Brief an einen Toten stilisiert sind, der die Verwünschung »jenseitig« transportieren soll).
(2) Diplomatische Schreiben: Sie stammten von Herrschern (Königen, Kaisern) und besaßen weitreichendes politisches Gewicht, so dass sie häufig »konserviert« wurden, indem man sie in Stein meißelte oder in Geschichtswerken wörtlich zitierte. Ein Beispiel bietet die sog. Gallio-Inschrift (→ D.II.2.). Häufungen von Titeln in Briefen römischer Kaiser zeigen entfernte formale Ähnlichkeiten mit den verschiedenen Selbstbezeichnungen des Paulus im Präskript seiner Briefe (Röm 1,1–6).
(3) Literarische Briefe: Sie reichen über einen aktuellen Anlass hinaus und waren bereits mit dem Ziel verfasst, eine gewisse Öffentlichkeit zu erreichen. Die Überlieferungsgeschichte zeigt, wo das gelungen ist: Diese Briefe sind in Abschriften und Sammlungen erhalten. Auch hier ist das Spektrum groß: Rhetorische Übungen, Dichtungen (Verse bei Horaz und Ovid, Briefe in Romanen), philosophische Lehrbriefe (z. B. von Epikur, Cicero oder Seneca). Gerade an den in einer umfangreichen Sammlung vereinigten Briefen Ciceros kann man sehr schön die Übergänge vom Privatbrief zum literarischen Brief erkennen. Literarische Briefe eignen sich potentiell für Fiktionen, die eine Briefsituation als Kulisse erst entwerfen (diskutiert für Senecas Epistulae Morales). Damit sind auch »Fälschungen« – besser: Brieffiktionen – von Lehrbriefen einer philosophischen Autorität möglich, durch die eine Schultradition weitergetragen und entwickelt werden soll; die Kynikerbriefe stellen ein anschauliches Beispiel dafür dar (→ 7.).
Die Unterscheidung von literarischen und nichtliterarischen Briefen ist als Arbeitsinstrument wichtig. Die ältere Forschung konnte unter Rückgriff auf A. Deissmann (193–208) scharf zwischen Brief und Epistel trennen: »Der Brief ist ein Stück Leben, die Epistel ist ein Erzeugnis literarischer Kunst« (195). Die Schriften des Paulus seien in diesem Sinne Briefe, Jak und Hebr bildeten Beispiele der Epistel. Wenn diese strikte Zweiteilung heute aufgegeben ist, so deswegen, weil sich gerade die Paulusbriefe einfachen Klassifizierungen widersetzen (vgl. M. L. Stirewalt, Paul 26.113–116): Sie verbinden Aktuell-Persönliches mit durchaus literarischen Anteilen und (begrenzter) »Gemeinde-Öffentlichkeit« (und sind daher heute in einer Vielzahl von Abschriften erhalten). In Schriften wie Hebr und Offb sind fiktionale Briefelemente, die sich mit diskursiven bzw. narrativen Strängen verbinden, formprägend und spiegeln dabei doch einen konkreten Situationsbezug. Autorenfiktionen sind in der zweiten und dritten christlichen Generation häufiges Mittel einer lebendigen Traditionshermeneutik (Deuteropaulinen; katholische Briefe; → 7.).
Auch antike Autoren selbst haben sich mit der Theorie des Briefschreibens beschäftigt. Unter dem Namen eines Demetrios ist eine Schrift »Über den Stil« (De elocutione) überliefert, die zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. n. Chr. zu datieren ist. In einem Exkurs zum Briefstil (Eloc 223–235) vergleicht der Autor den Brief mit einer der beiden Rollen in einem Dialog, wobei der Brief aber sorgfältiger gestaltet werden muss (223f.); den Gesprächscharakter gilt es gleichwohl zu wahren, so dass der Brief nicht in eine Rede (genannt werden Festvortrag/epideiktische Rede und Gerichtsrede/dikanische Rede in 225.229) ausarten darf. Gemeint ist damit, wie der Autor wiederholt festhält, ein schlichter und unprätentiöser Stil. Als wesentlichen Theoriebaustein betont er die »Philophronesis«, die freundschaftliche Gesinnung als Basis brieflicher Kommunikation, womit zugleich die Pflege der Beziehung als grundlegendes Briefanliegen hervortritt.
Im Brief gelangten verschiedene Stilmittel und Darstellungsformen zur Anwendung. Ebenfalls einem Demetrios (als Pseudo-Demetrios bezeichnet) zugeschrieben ist ein Werk über »Briefliche Typen«, das im 3. Jh. n. Chr. in seiner Endgestalt redigiert wurde, dabei aber deutlich älteres Material (teilweise aus dem 2. Jh. v. Chr.) verarbeitete. Zu Beginn der Einleitung deutet der Autor eine Brieftheorie an, die eine größere Anzahl sprachlicher Muster kennt, aus denen bei der Abfassung eines Briefes je nach der konkreten Situation eine Auswahl erfolgt. 21 Arten von Briefen unterscheidet der Autor, von denen ich nur einige für die ntl Briefe bedeutsame nenne: Freundschaftsbrief, Empfehlungsbrief, Trostbrief, tadelnder Brief, lobender Brief, beratender (symbuleutischer) Brief, Bittbrief, Dankbrief.
Diese Briefarten verstehen sich als Ergebnis einer theoretischen Reflexion über gängige Briefpraxis; sie spiegeln v. a. die Pragmatik des Briefschreibens, also konkrete soziale Situationen und Handlungsfelder, in denen Briefe geschrieben werden. Zur formalen Klassifizierung von Briefsorten sind sie nur bedingt geeignet (zur antiken Brieftheorie H. Koskenniemi; K. Thraede; A. J. Malherbe, Ancient Epistolary Theorists; S. K. Stowers 51–57; H.-J. Klauck, Briefliteratur 148–165).
Wenigstens erwähnt sei, dass auch in der jüdischen Kultur, in der sich das frühe Christentum entwickelte, die Praxis des Briefschreibens selbstverständlich geläufig war (P. S. Alexander; I. Taatz; H.-J. Klauck, Briefliteratur 181–226).
3. Briefformular
Anhand bestimmter sprachlicher Muster ist ein Schriftstück sofort als Brief erkennbar. Der Vergleich einer Vielzahl antiker Briefe ermöglicht es, dieses grundlegende Muster oder Briefformular herauszuarbeiten. Der zitierte Brief des Apion (→ 1.) erscheint in dieser Hinsicht fast idealtypisch. Ein Schema fasst das Ergebnis zusammen:
| Briefeingang Präskript Absender (superscriptio; im Nominativ) Adressat (adscriptio; im Dativ) Gruß (salutatio; im Infinitiv: χαίρειν/»zum Gruß«) Proömium Wunsch für Gesundheit, Wohlergehen Danksagung Zusicherung von Gedenken, Fürbitte (sog. »Proskynema«-Formel) Äußerung von Freude |
| Briefkorpus Eröffnung des Briefkorpus Gedenken, Äußerung von Freude (Hinführung zum Briefthema) Formeln der Kundgabe, des Ersuchens etc. Selbst- bzw. Fremdempfehlung Mitte des Briefkorpus Information thematische Erörterung und Argumentation Anweisung, Mahnung, Appell, Bitte, Empfehlung (teilweise unter Verwendung stereotyper Wendungen) Abschluss des Briefkorpus Anwendungen, Mahnungen, Bitten Besuchs- und Reisepläne |
| Briefschluss Epilog abschließende Mahnungen manchmal Reflexion auf den Schreibakt Beziehung als Thema, z. B. Bitte um Fürbitte, Besuchswunsch Postskript Grüße: Grüße vom Verfasser an die Adressaten Grußauftrag (= Grüße vom Verfasser an andere) Grußübermittlung (= Grüße von anderen an die Adressaten) Wünsche wie »Lebe wohl« teilweise Eigenhändigkeitsvermerk Datumsangabe |
Eine Bemerkung zur Form des Präskripts: Die übliche griechische Form lautet A (Absender), dem B (Adressat), χαίρειν/»zum Gruß« (vgl. Apion-Brief → 1.). In frühjüdischen Briefen treten teilweise andere Formen auf, z. B. Von A, an B, Schalom (Friedenswunsch als Gruß); oder: A, an B, Schalom; oder: An B, zum Gruß, A. Typisch ist der Friedenswunsch. Paulus pflegt das Schema A (Paulus + Titel wie »Apostel« + Mitabsender), dem B (»der Gemeinde in N.«), Friedensgruß (»Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn J...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Impressum
- Vorwort
- A. Einführung
- B. Die vier Evangelien
- C. Die Apostelgeschichte ((Dietrich Rusam))
- D. Die Briefe
- E. Die Offenbarung des Johannes
- Anhang