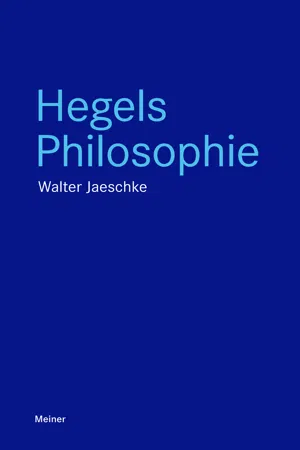
- 431 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Hegels Philosophie
Über dieses Buch
Walter Jaeschke ist einer der profiliertesten deutschen Hegel-Forscher und besitzt als Herausgeber der Akademieausgabe der »Gesammelten Werke« (GW) Hegels, langjähriger Direktor des Hegel-Archivs an der Ruhr-Universität Bochum und erfahrener Editor einen wohl einzigartigen Überblick über Hegels Schriften. In den letzten 15 Jahren hat er eine Reihe von Beiträgen zu beinahe allen zentralen Themen der Hegelschen Philosophie verfasst, die zum Teil an entlegenen Orten erschienen und nun in Auswahl in diesem Buch zusammengestellt sind.
Sensationell ist der Editionsbericht zu GW 2, mit dem der Band eröffnet wird: Mit Hilfe neuer Schrift- und Papieranalysen, die eine veränderte Datierung der Frankfurter Schriften ermöglichen, kann Jaeschke zeigen, dass das Bild, nach dem Hegel sich als junger Mann vor allem mit Theologie beschäftigt habe, eine Erfindung seiner Nachlassverwalter war, die nach seinem Tod nachgelassene Texte selektiv vernichteten, um den inzwischen als Pantheisten verketzerten Hegel als Theologen zu kanonisieren.
Die thematische Spannweite der Aufsätze und Vorträge des Bandes reicht vom Frühwerk über die Phänomenologie des Geistes (»Die Erfahrung des Bewusstseins«, »Das Selbstbewusstsein des Bewusstseins« und »Das absolute Wissen«) und die Wissenschaft der Logik bis zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts, berührt die Hegelsche Verfassungsschrift (»Machtstaat und Kulturstaat«), metaphysisches bzw. vielmehr metaphysik-kritisches Denken bei Hegel, die Begriffe Person/Persönlichkeit und Anerkennung, das Verhältnis zwischen dem Geist und den Wissenschaften sowie Hegels Anthropologie.
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Hegels – oftmals simplifizierend aufgefasster – Geschichtsphilosophie, seinem Verhältnis zur antiken griechischen Kultur, seiner Ästhetik und Religionsphilosophie sowie der Kritik an der Romantik. Das abschließende Kapitel beleuchtet die Fragwürdigkeit des Epochenbegriffs »Deutscher Idealismus«.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Hegels Philosophie von Walter Jaeschke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & History & Theory of Philosophy. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Wer denkt metaphysisch? oder: Über das
doppelte Ende der Metaphysik
Denken? Metaphysisch? „Sauve qui peut! Rette sich wer kann! – So höre ich schon einen“ Vertreter der schönen Welt der Gegenwartsphilosophie „ausruffen, der diesen“ Vortrag „dafür ausschreyt, daß hier“ von Hegel, also „von Metaphysik die Rede seyn werde. Denn Metaphysik ist das Wort, wie Abstract und beynahe auch Denken ist das Wort, vor dem, jeder, mehr oder minder, wie vor einem mit der Pest behaffteten davon laüfft.“ Und wegen dieses Verstoßes gegen die guten Sitten der philosophischen „schönen Welt“ füge ich für diejenigen, die seine Abhandlung „Wer denkt abstract?“ nicht kennen, meiner kleinen Hegel-Allusion noch den bei ihm folgenden, hoffentlich tröstlichen und beschwichtigenden (wiederum leicht modifizierten) Satz hinzu: „Es ist aber nicht so bös gemeynt, daß, was“ Metaphysik „sey, hier erklärt werden sollte.“ (GW 5.381). Ich werde nämlich die Argumentationsfigur aus Hegels Aufsatz hier nicht in dem Sinne adaptieren, daß ich das von der feinen Welt als metaphysisch Perhorreszierte als das in Wahrheit Empirische und das als empirisch Hochgeschätzte als in Wahrheit metaphysisch erweisen werde.
Die Metaphysik soll hier also nicht in ihre ehemaligen Ämter und Würden eingesetzt und auch das Ende der Metaphysik soll nicht widerrufen werden – doch soll darüber nachgedacht werden. Jedoch: Ist dies überhaupt ein Thema, über das zu reden oder gar nachzudenken sich noch lohnt? Hier scheint die Lage anders zu sein als beim „Ende der Kunst“, über das zumindest zu reden (wenn auch nicht unbedingt nachzudenken) inzwischen so sehr zum Gemeingut der feinen Welt der Ästhetiker geworden ist, daß in ihr nun beinahe über nichts anderes mehr geredet wird. Hinsichtlich des „Endes der Metaphysik“ läßt sich dies kürzer abtun. Denn wenn es eine Frage gibt, über deren Beantwortung sich die zerstrittenen Philosophen beiderlei Geschlechts unserer Tage einig sind, so ist es fraglos dieses: daß es mit der Metaphysik zu Ende sei – und daß es auch keinerlei Grund gebe, ihr Ende zu beklagen und ihr eine Träne nachzuweinen. Auch wer nichts von Metaphysik weiß, weiß doch so viel von ihr, daß es mit ihr vorbei sei, unwiderruflich und auch völlig zu Recht. Eben deshalb darf dieses Wissen sich selbstgenügsam geben: Von dem, was da vorbei und restlos vorbei ist, braucht man auch nicht mehr als eben dies zu wissen. Wer jedoch über dieses Basiswissen hinaus über etwas historische Orientierung verfügt, vermag dieses unbestreitbare Faktum auch noch geschichtlich einzuordnen: Das – gerechte! – Ende der metaphysischen Hybris sei herbeigekommen, als beim „Zusammenbruch des deutschen Idealismus“ im Vormärz die Phantasiebauten der philosophischen Systeme wie Kartenhäuser lautlos in sich zusammengefallen seien. Und der rauhe Wind der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit habe ein übriges getan und die luftigen Wahngebilde der metaphysischen Systemschmiede alsbald hinweggefegt.
Angesichts der uneingeschränkten Lufthoheit dieser Interpretation ist es nicht leicht, in den mühsamen Schritten philosophiegeschichtlicher Bodenoperationen solchen Ansichten, die von ihr abweichen, auch nur Gehör, geschweige denn Geltung zu verschaffen. Doch andererseits ist ein Faktum – auch wenn es nicht überall begrüßt wird – doch schwer zu bestreiten: daß philosophische Ansätze aus der Zeit vor dieser – als epochal betrachteten – Zäsur zwischen Klassischer deutscher Philosophie und Vormärz sich nach wie vor größter Aufmerksamkeit erfreuen – und zwar weltweit, nicht etwa nur bei denjenigen, die auf einem angeblichen deutschen Sonderweg des Denkens in die Irre gegangen sind und deren Herzen deshalb mit ebenso unbegreiflicher wie verderblicher Sehnsucht nach den metaphysischen Gefilden erfüllt sind. Für diejenigen Entwürfe hingegen, die für das vorherrschende Bewußtsein diese Zäsur entweder selbst markieren oder in die Zeit nach ihr fallen, läßt sich dies nicht in gleicher Weise behaupten. Schon dieser merkwürdige Kontrast berechtigt zum Zweifel an der eingangs skizzierten Deutung – ja er nötigt dazu, ihr begriffliches Instrumentarium und ihre historische Konstruktion zu überdenken: ihren Begriff der Metaphysik, ihre Sicht der geschichtlichen Rolle, die die Metaphysik zur fraglichen Zeit gespielt hat. Eines sei allerdings vorweg eingeräumt: Ob und wie man vom ‚Ende der Metaphysik‘ spricht, hängt natürlich vom jeweiligen Metaphysikbegriff ab. Wenn man den Metaphysikbegriff so weit faßte, wie Hegel es in den einleitenden Partien zu „Wer denkt abstract?“ parodistisch anprangert, daß letztlich das Denken überhaupt schon mit Metaphysik gleichgesetzt würde und die Frage „Wer denkt metaphysisch?“ gleichbedeutend würde mit der Frage „Wer denkt denn überhaupt noch?“, so wäre es – glücklicherweise! – derzeit noch etwas verfrüht, vom „Ende der Metaphysik“ zu sprechen. Es gibt aber auch gute Gründe, sich einem solchen Pan-Metaphysiokritizismus zu verweigern, für den alles Metaphysik und deshalb vom Bösen ist, was sich über Empirie oder Sprachanalyse erhebt, und vielmehr auf dem Unterschied eines seine Möglichkeiten ausschöpfenden und eines seine Grenzen überschreitenden Denkens zu beharren.
I. Das Ende der Metaphysik als Ereignis der Philosophiegeschichte
(1) „Auch denen, welche sich sonst noch an das Aeltere halten, ist die Metaphysik zugrunde gegangen wie der Juristenfakultät das deutsche Staatsrecht.“ „Es ist diß ein Factum, daß das Interesse theils am Inhalte, theils an der Form der vormaligen Metaphysik, theils an beyden zugleich verlohren ist.“ – Diese beiden Zitate konstatieren das Ende der Metaphysik als ein „Factum“. Zugleich bieten sie eine Diagnose für sein Eintreten: Das Interesse an der vormaligen Metaphysik habe sich verloren. Damit meine – auf begriffliche und historische Klärung und nicht auf Restitution gerichtete – Intention nicht mißverstanden werde, beeile ich mich hinzufügen: Abgesehen von etlichen ephemeren Reanimationsversuchen hat sich dieses verlorene Interesse bis heute nicht wieder eingefunden – und es ist kein Wagnis zu prognostizieren, daß es sich auch künftig nicht wieder einfinden werde.
Die eben zitierte Diagnose des Endes der Metaphysik scheint das Selbstverständnis des Vormärz prägnant zu artikulieren – der Zeit nach dem Ende des Hegelschen Systems und der „Systemphilosophie“ überhaupt, nach dem sogenannten „revolutionären Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts“.1 Doch steht dieser so plausibel erscheinenden Deutung sowohl die Chronologie als auch das Urheberrecht entgegen: Die zitierte Diagnose des Endes der Metaphysik stammt nicht etwa von Ludwig Feuerbach oder einem sonstigen Kritiker der Klassischen deutschen Philosophie und vornehmlich der Hegelschen; sie stammt von keinem anderen als von Hegel selber: aus seinem Hauptwerk, der Wissenschaft der Logik, und aus einem ostensiblen Brief aus dem Jahre 1816 – also aus den entscheidenden Jahren der Ausbildung seines Systems.2 Und seine Rede vom „Ende der Metaphysik“ ist keineswegs nur kokettierend gemeint: Hegels Selbstverständnis zu Folge setzt seine Philosophie das „Ende der Metaphysik“ als ein Ereignis der Philosophiegeschichte voraus.
Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, als Ursache für das „Ende der Metaphysik“ lediglich einen Interessenschwund zu konstatieren. Noch kurz zuvor gelten die Themen der Metaphysik ja als die höchsten Gegenstände des Denkens. Das Interesse an solchen Gegenständen verliert sich nicht wie eine Münze, und sein Dahinschwinden ist auch kein Naturereignis. Der Interessenschwund ist nicht die Ursache, sondern die Folge und die Erscheinungsform des „Endes der Metaphysik“. Und das Ende, von dem hier die Rede ist, kann prägnant gefaßt werden als das Ende derjenigen Gestalt, die die Metaphysik in der rationalistischen Schulphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts gefunden hat – oder, um das zweite Eingangszitat fortzusetzen: Was vor Kants Kritik der reinen Vernunft „Metaphysik hieß, ist, so zu sagen, mit Stumpf und Styl ausgerottet worden, und aus der Reihe der Wissenschaften verschwunden.“ – Am Rande sei vermerkt, daß all denen, die diesen Satz nicht in der historisch-kritischen, sondern in der meistzitierten Hegel-Ausgabe unserer Tage lesen, das ironische Wortspiel Hegels entgeht: Er schreibt nämlich keineswegs, wie es dort heißt, die Metaphysik sei „mit Stumpf und Stiel“ ausgerottet worden (TWA 5.13), sondern, sie sei „mit Stumpf und Styl“ ausgerottet worden – also: Sie habe ihr Ende durch eine, sit venia verbo, ‚stilvolle Ausrottung‘ gefunden.
Auch diese drastischen Wendungen gehören also nicht erst dem Vormärz an: Die Metaphysik ist nicht allein „zu Ende gegangen“, als wäre sie eines natürlichen Todes gestorben, vielmehr ist sie – stilvoll – ausgerottet worden und deshalb aus der Reihe der philosophischen Wissenschaften verschwunden. Wer vom „Ende der Metaphysik“ reden will, darf diese mit ebenso großem geschichtlichen Recht wie mit Emphase vorgetragene Diagnose nicht ignorieren – er muß vielmehr von ihr ausgehen. Ich schließe mich ihr ausdrücklich an: Als ein Ereignis der Philosophiegeschichte ist die Ausrottung der Metaphysik das Resultat nicht des Vormärz, sondern der Aufklärung – nämlich der Metaphysikkritik Kants. Dies ist eine adäquate Einschätzung ihres faktischen Resultats und ihrer Wirkungsgeschichte – auch wenn Kants Intention damit fraglos nicht vollständig erfaßt ist. Die Kritik der reinen Vernunft ist die definitive Kritik der traditionellen Metaphysik in ihrem gesamten Umfang. Unbarmherzig destruiert sie die rationale Psychologie mit ihrer Lehre von der Einfachheit und – daraus folgend – der Unsterblichkeit der Seelensubstanz, ebenso die rationale Kosmologie mit ihren antinomischen Aussagen über den Weltbegriff und schließlich die rationale Theologie wegen ihres illegitimen Übergangs vom höchsten Gedanken zur Existenz eines diesem Gedanken entsprechenden Wesens. Diese Kritik verbannt die metaphysica specialis aus dem Kreise der philosophischen Wissenschaften, und an die Stelle der metaphysica generalis, der früheren Ontologie, als einer rationalen Erkenntnis äußerer Gegenstände, setzt Kant die transzendentale Logik, als Erkenntnis nicht etwa transzendenter Gegenstände, sondern der internen Verfassung der Vernunft.
In der Retrospektive der Philosophiegeschichte stehen die beiden Jahrzehnte nach dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft – negativ gesehen – im Zeichen der Metaphysikkritik, positiv gesehen im Zeichen der Transzendentalphilosophie. Dies ist nicht als ‚statistische‘ Aussage in dem Sinne zu nehmen, daß die meisten der damaligen Philosophen sich zu ihr bekannt hätten – denn dies ist fraglos nicht der Fall; die traditionelle Schul- und die Popularphilosophie sind zahlenmäßig noch stark vertreten. Doch die Weiterentwicklung des Denkens vollzieht sich damals in dem von Kants Transzendentalphilosophie vorgegebenen Denkraum, und selbst die Rezeption von philosophischen Ansätzen vergleichbaren Gewichts – wie der Lehre Spinozas – erfolgt in Relation zur Transzendentalphilosophie, ja sie steht in ihrem Bann. Ihre Dominanz beruht auf ihrer durchschlagenden Kritik der Metaphysik als eines Systems „reeller durch das bloße Denken hervorgebrachter Erkenntnisse“. In dieser Entgegensetzung gegen die Metaphysik sieht auch Fichte das Proprium der Transzendentalphilosophie. Übereinstimmend mit Kant leugne er „die Möglichkeit der Metaphysik gänzlich“; Kant rühme sich – zu Recht! –, die Metaphysik in diesem Sinne „mit der Wurzel ausgerottet zu haben, und es wird, da noch kein verständiges und verständliches Wort vorgebracht worden, um dieselbe zu retten, dabei ohne Zweifel auf ewige Zeiten sein Bewenden haben“.3 Sowohl Fichte als auch Hegel greifen also hier – unabhängig voneinander – zu dem harten Wort „ausrotten“. Von den beiden von Descartes ausgehenden Linien – der Begründung der Metaphysik auf den ontologischen Gottesbeweis und der Fundierung der Philosophie in der Selbstgewißheit des Ich – hat damit die letztere, die subjektivitätstheoretische, den Sieg über die ontologische davongetragen.
(2) Doch wie kommt es zu diesem durchschlagenden Erfolg? Geistige Prozesse von epochalem Rang lassen sich selten an eine einzelne Person binden und auf einen Zeitpunkt fixieren. Auch wenn sie sich geradezu auf ein Jahr datieren lassen – auf das Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft –, so sind sie doch stets länger vorbereitet. Dies gilt fraglos auch für Kants Metaphysikkritik: Mehrere seiner Formulierungen lassen erkennen, daß sein vernunftkritisches Werk im gedanklichen Umkreis einer breiten vernunftkritischen Tradition steht. Das „Ende der Metaphysik“ als ein Faktum der Philosophiegeschichte der Aufklärung ist eingebettet in diesen größeren Zusammenhang der neueren Bewußtseinsgeschichte, die durch zwei epochale Entwicklungen charakterisiert ist: durch das Zerbrechen der Einheit von Vernunft und Glaube und durch das Zerbrechen der Einheit von Denken und Sein.
Ohne mich allzusehr ins Detail zu verlieren, möchte ich diese Aussage durch zwei knappe Hinweise illustrieren, um das „Ende der Metaphysik“ in den größeren Rahmen zu stellen, in dem es sich ereignet hat. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts stellt Leibniz seiner Theodizee die „Einleitende Abhandlung über die Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft“ voran – denn diese Übereinstimmung ist ein Konstituens der neuzeitlichen Metaphysik. Sie bildet gleichsam den Schlußstein, der ihr Gewölbe stabilisiert. Aber schon zu Leibniz’ Zeiten ist diese Übereinstimmung keineswegs allgemein akzeptiert. Seine Abhandlung verfolgt ja eine ausgesprochen apologetische Absicht: Sie sucht die fideistische Skepsis Pierre Bayles zu widerlegen, die im Interesse des Glaubens auf die Zerstörung der Einheit von Vernunft und Glauben zielt. Damit weist die Intention seiner Vernunftkritik – bei aller Differenz in der Methode wie im Inhalt! – eine Analogie zu derjenigen Kants auf: Bayle sucht Widersprüche in der Vernunft aufzuzeigen, um deren Geltung zu begrenzen, allerdings – anders als Kant! – auch generell zu untergraben. Und sosehr Leibniz die deutsche Philosophie des 18. Jahrhunderts geprägt hat – an dessen Ende steht der Sieg der Diagnose Bayles über Leibniz: die Annahme der Unvereinbarkeit von Glaube und Vernunft. Sie wird nirgends deutlicher als in Kants Lehre, daß die Vernunft sich in ihrem theoretischen Gebrauche in Widersprüche verstricke, die ihren Geltungsanspruch zwar nicht schlechthin aufheben, jedoch ihren Geltungsbereich begrenzen. Der höchste Gedanke, den die Vernunft denkt, ist nicht gleichzusetzen mit dem Gott, den der Glaube bekennt. Und der Versuch der Metaphysik, diesem höchsten Gedanken der Vernunft das Dasein zu unterschieben, wird als bloße Subreption gebrandmarkt.
Insoweit bildet das von Kant herbeigeführte „Ende der Metaphysik“ die philosophiegeschichtlich prägnante Entscheidung eines Streites, der bereits ein Jahrhundert lang die Bewußtseinsgeschichte durchzieht. Und mit seiner Entscheidung ist zugleich die zweite Frage – nach dem Verhältnis von Denken und Wirklichkeit – entschieden. „Einheit von Denken und Sein“: In der Bestimmung dieses Verhältnisses liegt das Fundamentalproblem der abendländischen Metaphysik – seit ihrem Beginn. Auch Hegel sieht hierin in seinen philosophiegeschichtlichen Vorlesungen gleichsam den roten Faden, der die philosophischen Entwürfe seit der Antike durchzieht und miteinander verknüpft.4 Die Behauptung der Einheit von Denken und Sein ist natürlich niemals so zu verstehen, als ob zwischen beiden nicht auch zu unterscheiden sei – dies ist trivial. Doch auf die Bestimmung des Unterschieds kommt es an. Unter dem Titel „Erste Stellung des Gedankens zur Objektivität“ skizziert Hegel in seiner Enzyklopädie die Tradition einer „unbefangenen Metaphysik“, der die Differenz zwischen Denken und Sein nicht wirklich zum Problem geworden sei.
Im Empirismus und im Kritizismus des 18. Jahrhunderts sieht er diese „Einheit von Denken und Sein“ jedoch in doppelter Weise zerbrechen: Das Wirkliche ist nicht im Gedanken selbst, sondern in der Erfahrung zu suchen; es kann vom Denken nicht einfach gesetzt oder ergriffen, sondern es muß ihm gegeben werden. Mit der Bildung des Begriffs des Unendlichen ist nicht schon die Wirklichkeit des Unendlichen als eines quasi-Gegenständlichen gegeben, und mit der Bildung des Begriffs des Unbedingten nicht schon das Unbedingte. Und das Sein ist nicht eine der im Begriff vereinigten Realitäten, sondern etwas prinzipiell anderes als das Denken: Es ist (für Kant) die „absolute Position“ des im Begriff Gedachten. Doch auch wenn Hegel hier vom „Zerbrechen“ der Einheit von Denken und Sein spricht und dieses Wort fraglos pejora...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Inhalt
- Titelei
- Vorwort
- Hegels Frankfurter Schriften. Zum jüngst erschienenen Band 2 der Gesammelten Werke Hegels
- Die Erfahrung des Bewußtseins
- Das Selbstbewußtsein des Bewußtseins
- Das absolute Wissen
- Die Prinzipien des Denkens und des Seins. Hegels System der reinen Vernunft
- Wer denkt metaphysisch? oder: Über das doppelte Ende der Metaphysik
- Der Geist und seine Wissenschaften
- Anthropologie zwischen Natur und Tat. Bemerkungen über eine gut gemeinte Mesalliance
- Person und Persönlichkeit. Anmerkungen zur Klassischen Deutschen Philosophie
- Genealogie des Rechts
- Machtstaat und Kulturstaat
- Anerkennung als Prinzip staatlicher und zwischenstaatlicher Ordnung
- Staat und Religion
- Zur Geschichtsphilosophie Hegels
- Das Fremde und die Bildung. Hegel über die Entwicklung des griechischen Bewußtseins
- Die gedoppelte Schönheit. Idee des Schönen oder Selbstbewußtsein des Geistes?
- Hegels Kritik an der Romantik
- Über die Bedingungen einer Religionsphilosophie nach der Aufklärung
- ‚Zeugnis des Geistes‘ oder: Vom Bedeutungswandel traditioneller Formeln
- Zur Genealogie des Deutschen Idealismus. Konstitutionsgeschichtliche Bemerkungen in methodologischer Absicht
- Literaturverzeichnis