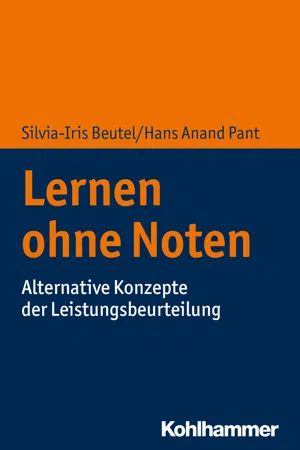![]()
1 Notengebung, Leistungsprinzip und Bildungsgerechtigkeit
Hans Anand Pant
»Noten sind halt ungerecht, aber was willste machen?!« – in diesem leicht resignativen Alltagszitat einer Sekundarschullehrerin kommt zum Ausdruck, was die Diskussion um Notengebung als der dominierenden Praxis der Leistungsbeurteilung in Deutschland immer noch auszeichnet. Es ist eine Mischung aus rationaler Einsicht in die pädagogische Untauglichkeit von Noten und gleichzeitig deren scheinbare Unverzichtbarkeit für die Institution Schule und die alltägliche Anforderung der Leistungsbeurteilung an Lehrerinnen und Lehrer.
Dieses Kapitel möchte die Annahme der prinzipiellen Ungerechtigkeit von Notensystemen unter verschiedenen Perspektiven beleuchten und zuspitzen. Dabei soll und kann die jahrzehntelange fachliche Beschäftigung aus pädagogischer, historischer, soziologischer, lernpsychologischer, bildungsrechtlicher und anderer Perspektive auch nicht ansatzweise rekapituliert werden. Ziel dieses Abschnitts ist es vielmehr, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es häufig die unhinterfragten Annahmen im alltäglichen Nachdenken über Leistungsbeurteilung sind, die Pädagoginnen und Pädagogen zwangsläufig in »Fallen« laufen lassen. Durch die Anregung zur Reflexion dieser »Fallen« wird es (hoffentlich) verständlicher, was die praktischen Schulbeispiele alternativer, integrierter Systeme der Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung, die im Verlauf des Buches zur Darstellung kommen, leisten können: Sie erobern das Leistungsprinzip zurück in einem erweiterten pädagogischen Sinne, d. h. als Vorstellung einer ko-konstruktiven Gemeinschaftsanstrengung aller am pädagogischen Prozess Beteiligten.
Im massenmedialen, aber auch im fachlichen Noten- und Leistungsdiskurs trifft man zunächst auf viel »semantisches Gestrüpp«. Da werden die Unterschiede zwischen Schlüsselkonzepten wie Lernen, Leistung, Potenzial und Fähigkeit verwischt oder – etwas konkreter – PISA-Test und Klassenarbeiten in einem Zuge als Instrumente der Leistungsbeurteilung bezeichnet. Zunächst sollen deshalb einige begriffliche »Sortierungen« und Ordnungsversuche vorgenommen werden. Diese beanspruchen keinen »Wahrheitswert«, sie möchten aber den fachwissenschaftlichen Diskurs aufgreifen und Lesenden und Schreibenden als gemeinsame Referenzpunkte im »Diskursgestrüpp« über Leistung und Noten dienen. Anschließend betrachten wir Notengebung – oder allgemeiner: Formen der Leistungsbeurteilung – unter gerechtigkeitstheoretischen Gesichtspunkten. Es wird versucht aufzuzeigen, welche widersprüchlichen Gerechtigkeitsmodelle zurzeit in der Diskussion kursieren und wie sich diese in einem zentralen Punkt der Leistungsbeurteilung widerspiegeln, der Bezugsnormorientierung.
Zum Schluss dieses Kapitels möchten wir der Illusion entgegentreten, dass man allein durch wissenschaftliche Begründungen und Untersuchungen zu einer »gerechten« Form der Leistungsbeurteilung kommen könne, und argumentieren, dass wir immer wieder bei normativen Grundfragen landen werden. Welche Formen des gesellschaftlichen Miteinanders wünschen wir uns grundsätzlich, d. h. auch und gerade jenseits der Institution Schule? Wie stellen wir uns das »Mischverhältnis« von inklusiven, kooperativen, wettbewerblichen, (höchst-)leistungsorientierten, glücksorientierten oder anderen Prinzipien des Zusammenlebens vor? Wer diese Frage dauerhaft ausblendet, so unsere Schlussfolgerung, wird – sei es als Lehrerin oder Lehrer, als Elternteil oder als Schulleitung – höchstwahrscheinlich in der »Notenfalle« stecken bleiben.
1.1 Lernen, Leistung, Leistungsfeststellung, Leistungsbeurteilung, Noten – einige begriffliche Sortiervorschläge
Betrachtet man jenseits einer routinehaften und »kurzatmigen« Alltagssicht (»Noten zeigen, wie gut Schülerinnen und Schüler etwas gelernt haben«) den Zusammenhang zwischen Lehren, Lernen, Leistung und Noten, dann erscheint er schnell ziemlich komplex. Lernen im Kontext von Unterricht und Schule wird zunächst immer als ein Lernen in Bezug auf ein Lehren, also als Lehr-Lern-Prozess verstanden. Dabei ist die Seite des Lehrens verhältnismäßig gut sichtbar, planbar und beeinflussbar und liegt (in »klassischer« Sichtweise) überwiegend in der Verantwortung der Pädagogin bzw. des Pädagogen. Dass »auf der anderen Seite«, also auf Seiten der Kinder und Jugendlichen, etwas gelernt wurde, muss hingegen erst sichtbar gemacht werden durch entsprechende Verfahren der
Feststellung oder
Erfassung von Ergebnissen des schulischen Lernvorgangs. Dazu zählen längst nicht mehr nur klassische Lernerfolgskontrollen, wie etwa von der Lehrkraft entwickelte schriftliche Klausuren und mündliche Prüfungen, sondern ein ausdifferenziertes Arsenal an unstandardisierten und standardisierten Instrumenten, wie Lerntagebücher, Lernlandkarten, Portfolios, Kompetenzraster, Lernentwicklungsgespräche, um nur Beispiele zu nennen. In Kapitel 2 (
Kap. 2) werden einige von ihnen näher beschrieben und auf ihre empirisch feststellbaren Wirkungen und Zusammenhänge mit Lernergebnissen untersucht.
Diese Instrumente werden eingesetzt, um etwas prinzipiell für Außenstehende – auch für die Lehrerin und den Lehrer – »Uneinsehbares«, nämlich das Lernen selbst, sichtbar und für den Lehr-Lern-Prozess verfügbar zu machen2. Die Lernenden selbst bräuchten, um zu lernen, diese Akte der Feststellung und Erfassung von außen nicht. Sie könnten ihr eigenes Lernen, d. h. »das Mehr« und die Entfaltung von Wissen und Können, in der tätigen oder reflexiven Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozialen Umwelt erleben und für sich selbst erfahren. Der hohe Stellenwert, den geeignete Rückmeldungen (»Feedback«) im Lernprozess haben können, ändert an dieser prinzipiellen Unabhängigkeit von innerem Lernvorgang und äußerer Sichtbarmachung nichts. In diesem Sinne bleibt Lernen stets ein latentes Konstrukt.
Der institutionelle Zugriff auf das unsichtbare Lernen erfolgt nun, wenn man so will, durch einen gesellschaftlich anerkannten, d. h. über Normen und Traditionen abgesicherten, sowohl rechtlich, administrativ als auch professionsmäßig verankerten »Kniff«. Dieser Kniff besteht ganz simpel darin, dass Lernen im schulischen Kontext als Leistung deklariert wird: Wer in der Schule (nachweislich) etwas gelernt hat, hat etwas geleistet. Aus dem unbeobachtbaren Lernprozess resultiert die ebenso konstrukthafte Lernleistung. Aus dem Versuch, mittels Verfahren und Instrumenten Lernprozesse sichtbar und fassbar zu machen, wird auf diese Weise Leistungsfeststellung bzw. Leistungserfassung. Für diesen Etikettierungsvorgang ist es zunächst unerheblich, was der Gegenstand des Lernens ist oder welches die Lernziele sind. Diese können ebenso fachlicher wie fachübergreifender Art, auf soziales Lernen oder auf das Lernen-Lernen, also Lernstrategien, oder das Kennen und Anerkennen sozial erwünschter Haltungen und Einstellungen gerichtet sein – alles, was demzufolge im schulischen Kontext als lernbar angesehen wird, bzw. für das Lernziele formuliert werden können, ist grundsätzlich als Leistung definierbar.
1.2 »Was ist schulische Leistung?«
Obwohl also der Leistungsbegriff in der schulischen Praxis und in der Erziehungswissenschaft ganz offenbar von zentraler Bedeutung zu sein scheint, gerät man schnell ins Stocken, wenn man jenseits der Behauptung, es handele sich um eine bloße Etikettierung (»Kniff«), dingfest machen soll, was schulische Leistung »im Kern« bedeutet. Es mangelt dabei keinesfalls an Definitionsversuchen in der bildungstheoretischen und erziehungswissenschaftlichen Fachliteratur. Für Klafki (1985) ist Leistung z. B. bestimmt als »Ergebnis und Vollzug einer zielgerichteten Tätigkeit, die mit Anstrengung und ggf. mit Selbstüberwindung verbunden ist und für die Gütemaßstäbe anerkannt werden, die also beurteilt wird« (S. 174; Hervorhebung im Orig.).
Der Schulpädagoge und ausgebildete Lehrer Christian Nerowski hat eine ganze Reihe solcher Bestimmungsversuche aus Pädagogik, Psychologie und empirischer Bildungsforschung auf gemeinsame Elemente untersucht. Er hat dabei eine überschaubare Anzahl von Kriterien identifiziert, die wiederholt genannt werden (Nerowski, 2018a). Demnach ist schulische Leistung u. a. verbunden mit der Vorstellung von »Aktivität«, »Tätigkeit« und »Anstrengung« der Schülerinnen und Schüler, sie ist »zielgerichtet« und damit »absichtsvoll«, an schulischen »Anforderungen« ausgerichtet und »ergebnisorientiert«. Schulische Leistungen müssen prinzipiell durch geeignete Aufgaben, didaktische Methoden und Sozialformen des Unterrichtens initiierbar und steuerbar sein. Leistung muss, um als solche bezeichnet zu werden, feststellbar, an »Gütemaßstäben« orientiert und einer Bewertung zugänglich sein. Die der Leistung zugrundeliegenden Handlungen müssen grundsätzlich in der Gesellschaft als »wertvoll« angesehen werden. Als sehr verdichtetes Definitionsbeispiel soll hier der Ansatz von Ricken (2018) genannt sein (als weiteres, eher schulnahes Beispiel siehe den folgenden Kasten »Pädagogischer Leistungsbegriff« nach Bohl, 2003):
Verkürzt lässt sich die (Produktions-)Logik der »Leistung« vielleicht so beschreiben: »Leistung« setzt – erstens – Gelegenheiten (und das Arrangement von Gelegenheiten z. B. durch Aufgabenstellung) voraus, etwas zeigen zu können, manifestiert sich – zweitens – immer in einer (herzustellenden und zu zeigenden bzw. identifizierbaren) Form und Materialität, die dann – drittens – einzelnen Akteuren verantwortlich bzw. urheberisch als deren Produkt oder Ergebnis zugeschrieben werden kann; als identifizierbares Produkt ist sie – viertens – in sich selbst inhaltlich graduierbar und muss – fünftens – sozial vergleichbar gemacht werden (können), um schließlich – sechstens – durch Beurteilung bzw. Benotung allererst zu einer (schulischen) »Leistung« zu werden (Ricken, 2018, S. 52).
Pädagogischer Leistungsbegriff bei Bohl (2003, S. 215)
Neue Formen der Leistungsbewertung korrespondieren mit einem pädagogisch motivierten Leistungsverständnis (…). Ein derartiges Leistungsverständnis entzieht sich einem traditionell engen, kognitiv orientierten, produktbezogenen, individuellen Leistungsbegriff. Wesentliche normative Merkmale dieses Leistungsverständnisses sind (…):
• Leistung setzt eine vertrauensvolle Beziehungsstruktur unter allen Beteiligten voraus, ansonsten werden Lernprozesse von anderen Themen und Problemen überlagert.
• Leistung benötigt institutionelle und systemische Unterstützung, um optimale Förderung zu gewährleisten und individuelle Problemfelder professionell begleiten zu können.
• Lernen und Leisten ist immer und zwangsläufig ein individueller Prozess und benötigt daher ein differenziertes und vielfältiges Anregungspotenzial.
• Leistung vollzieht sich in kooperativen und solidarischen Arrangements, wodurch uneingeschränkter Selbstverwirklichung begegnet wird.
• Leistung ist vielfältig und kann sich in Prozess-, Produkt-, Präsentationsleistungen, in Reproduktions-, Reorganisations-, Transfer- und Problemlösungsleistungen und in kreativen, sozialen, kognitiven, produktiven, handlungsorientierten Leistungen zeigen.
• Leistung ist niemals wertfrei und bedarf daher einer regelmäßigen Verständigung und Reflexion. »Leistung ist ein Konstrukt« (…) und daher niemals per se, sondern nur durch Vereinbarungen definiert.
In seiner Begriffsanalyse kommt Nerowski (2018a) zu dem überraschend übersichtlichen Ergebnis, dass es nur zwei notwendiger Bestimmun...