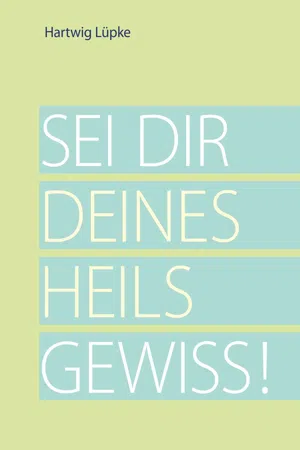![]()
Predigt 1: Gott blamiert sich nicht
Heilsgewissheit ist ein großes Thema der Theologie, vor allem aber ein geistliches Gut, eine geistliche Notwendigkeit für jeden von uns. Heilsgewissheit zu haben oder nicht, hat für unseren Glauben, für unser Verhältnis zu Jesus, grundlegende Bedeutung. Heilsgewissheit ist kein Luxusgut, auch nicht nur eine bewegende Erfahrung, sondern elementares „Ereignis“ (Ralf Luther).
Zu Beginn unserer Betrachtung schaue ich eine Szene im Leben Abrahams an und entdecke bei Paulus, dass ihm gerade diese Szene wichtig ist, um lebendigen Glauben zu erklären. Er zeigt uns einen Gott, dessen Ohren offen sind, dessen Herz ganz offen ist. Seine Liebe ist bewährt und seine Zusagen wanken nicht. Darauf können wir uns absolut verlassen – im Leben und im Sterben.1 Es gibt keinen Augenblick, in dem er nicht ein hörender, uns hörender, liebender, fürsorgender, schenkender und gnädiger Gott ist. Das sage ich mit einer Zuversicht, die alles Wanken hinter sich lässt. Ist das etwa zu verwegen? Stimmen wir beglückt zu – oder lassen wir Zweifel in uns hochkommen, weil unsere Erfahrungen sehr gemischt sind? Aber gleich zu Beginn: Gott blamiert sich nicht. Auf sein Wort, auf seine Zusagen ist Verlass.
In dieser Predigt beschäftige ich mich mit 1. Mose 15,1–6 und Römer 4,17–25:2 „Nach diesen Geschichten begab sich‘s, dass zu Abram das Wort des HERRN kam in einer Erscheinung: Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber: Herr HERR, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliëser von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben; und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der HERR sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“(1. Mose 15,1–6).
„Wie geschrieben steht (1. Mose 17,5): ‚Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker‘ – vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist (1. Mose 15,5): ‚So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.‘ Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sara. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste: Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch ‚zur Gerechtigkeit gerechnet‘ (1. Mose 15,6). Nicht nur um seinetwillen steht aber geschrieben: ‚Es wurde ihm zugerechnet‘, sondern auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der unsern Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt“ (Römer 4,17–25).
Der Reformator Johannes Calvin hat einmal gesagt, Abraham müsste es manchmal so vorgekommen sein, als ob ihn Gott zum Besten halte. Immerhin hatte der Herr ihm mehrfach die größten Versprechungen gemacht. Aber wie sah die Wirklichkeit aus? Sollte er nicht der Stammvater eines großen Volkes werden? Sollte er nicht eine große Anzahl von Nachkommen haben, kaum zu zählen? Und sollte das Land, in dem er sein Zelt mal hier und mal da aufschlug, nicht einmal ihm und seinen Nachkommen gehören und zur bleibenden Heimat werden? Doch Sara, seine Frau, blieb kinderlos, und er selbst zog nur als Fremder durch das Land.
Wie ging Abraham mit dieser Diskrepanz von Verheißung und Erfahrung um? Kehrte er Gott den Rücken zu? Verlor er seinen Glauben? Aus dem gesamten Abrahambericht ist zu entnehmen, dass das keinesfalls geschah. Allerdings schien er glaubensmüde zu werden. Es wollte ihm nicht mehr gelingen, die Hoffnung festzuhalten, die Hoffnung, die Gott in seinem Herzen geweckt hatte. Abraham wusste die Hoffnung noch, aber er hatte sie nicht mehr.
Und wie reagierte Gott? „Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn zu Abram in einer Vision: Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dein Schild, und dein Lohn wird sehr groß sein“ (1. Mose 15,1 | Lutherübersetzung 2009).
Gott wusste ganz offensichtlich, dass Abram jetzt keinen Tadel brauchte; ihm musste nicht der Kopf zurechtgerückt werden. Abram brauchte Stärkung und Zuspruch, und beides schenkte ihm Gott.
Der Herr brach in Abrahams3 Denk- und Erfahrungssystem ein und wollte die bleierne Decke von Zweifel und Enttäuschung von ihm nehmen. Er rief Abraham mit Namen: Ich meine dich! Ich rede zu dir! Ich habe dich nicht vergessen oder aus den Augen verloren. Meine Gnade gilt noch und meine Treue ist unwandelbar. „Ich bin dein Schild“,4 das heißt doch: Du kannst geborgen sein. „Dein Lohn wird sehr groß sein“ bedeutet: Großes und Herrliches darfst du noch von mir erwarten. Zweifle nur nicht und sei gewiss: Die Verheißung, die ich dir schon mehrfach gab, gilt, sie steht in Kraft, sie wird sich größer und herrlicher erfüllen, als du es fassen kannst.
Doch mit Abrahams Glauben stand es nicht zum Besten. Wo war der „Glaubensheld“ geblieben? Müde ist er geworden, kraftlos, angefochten. Ich erweitere die Sätze, die Abraham Gott in seiner Glaubensnot und in seinem Glaubenszweifel vor die Füße warf, einmal so: Herr, was willst du mir jetzt schon noch geben. Ich bleibe ja doch ohne Kinder (1. Mose 15,2 –3).
Spüren wir dieses tiefe Klagen und Zweifeln, sein Gefühl, verlassen zu sein? Was empfinden gläubige Menschen manchmal, wenn Dinge ganz anders laufen, als sie es sich gedacht oder vielleicht auch erbeten haben? Bleibt in solchen Fällen die Gewissheit auf der Strecke, dass das Wort Gottes mit seinen Verheißungen auch sie meint?
Abraham jedenfalls war in einem „Umsonst“-Glauben gefangen. Die „Umsonst“-Erfahrung ließ ihn nicht los. Sein menschliches Denksystem hielt ihn eng, klein, „ungläubig“, ohne Hoffnung. Umsonst hatte er auf Nachwuchs gewartet. Umsonst gewartet, umsonst gehofft, umsonst vertraut, umsonst geglaubt. Das Umsonst hatte ihn derart ausgehöhlt, allerdings nicht, weil er schwache Nerven hatte, sondern weil Gottes Verheißungen nicht mit seinen Erfahrungen in Einklang zu bringen waren. „Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht“ (Ghs 564,3) – stimmte das noch? In dieser Situation jedenfalls hätte Abraham dieses Lied kaum singen können.
Hören und empfinden wir die ganze Tragik, die in dieser Geschichte steckt? Immerhin hatte Abraham mit der Erwartung des Erben auch die Verheißungen Gottes aus seinem Leben gestrichen. „Was willst du mir jetzt schon noch geben?“
Mir ist wichtig zu überlegen: Wer in seinem menschlichen System gefangen ist,5 denkt und „glaubt“ womöglich, was er wahrscheinlich nie zugeben würde: Was wir nicht können, kann auch Gott nicht; was wir uns nicht vorstellen können, setzt auch Gott Grenzen. Abraham und Sara waren zu alt geworden, um noch Kinder zu bekommen. Über diese „Hürde“, dennoch an der Verheißung Gottes festzuhalten, konnte Abraham nicht springen. Für ihn galt: Ich kann nicht mehr und Gott kann jetzt auch nicht mehr.
Ist dieses Denken im Fall Abrahams nicht völlig vernünftig? Für uns heute weitergedacht: Wenn wir „unfruchtbar“ sind, wie soll Gott dann Frucht wirken? Wenn wir unwürdig sind, kann uns doch Gott erst recht nicht für „würdig“ erachten. Wenn unser Leben mit all seiner Not, mit all seinen Verwerfungen, mit seinem Versagen und Kleinglauben deutlich zeigt, dass an „Heilsgewissheit“ zu glauben eine Anmaßung wäre, dann kann es sie auch nicht geben.
Wo ist der Systembrecher, der herausführt aus der Gefangenschaft eigener Beurteilung und Leistung? Wo ist der Systembrecher, der herausführt aus dem fatalen „geht nicht, kann nicht“? Müssen wir uns wirklich selbst sagen und beweisen, dass Christus uns das Heil geschenkt hat? Nein, niemals. Niemals können wir uns selbst „einreden“, wir wären gerettet und geliebt von Gott. Für diese Gewissheit brauchen wir immer und nur die Offenbarung der Liebe Gottes und sein zusprechendes, unumstößliches Wort.
Wie verfährt Gott mit Abraham? Wie führt er ihn aus seinem Denk- und Erfahrungsdilemma heraus? Wie „knackt“ er sein angefochtenes und wundes Herz, das womöglich hart zu werden droht?
In 1. Mose 15,5 lesen wir: „Und er ließ ihn hinausgehen und sagte: ‚Sieh zum Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen?‘; und sagte zu ihm: ‚So soll deine Nachkommenschaft sein.‘ “
Schau zum Himmel. Das ist die Lösung. Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? Ist das, was du siehst, nicht auch „unglaublich“?
Jesaja greift den Gedanken vom Aufblick zu der unfassbar weiten und funktionierenden Sternenwelt auf und fügt dann hinzu: „Wer hat sie alle geschaffen und führt ihr Heer gezählt [vollzählig] heraus? Er ruft sie alle mit Namen; sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass auch nicht einer fehlt“ (Jesaja 40,26).
Modern-naturwissenschaftlich ist das natürlich nicht gedacht und gesprochen. Aber ist uns nicht heute noch die Größe, Weite und Vielfalt göttlicher Schöpfung ein einziges Wunderwerk und Zeichen göttlicher Macht? Unsere heutige Generation müsste eigentlich noch viel mehr ins Staunen kommen, weiß sie doch ein ganzes Stück mehr als Abraham über die unermesslichen Dimensionen erforschter und unerforschter Welten. „Sein Vermögen und seine starke Kraft“ ist nicht zu fassen. Wer sie kleinredet, macht sich selbst unglaubwürdig. Was ist der Mensch und seine Welt im Vergleich zu der empfundenen Unendlichkeit des Kosmos und damit der Größe Gottes und seiner Möglichkeiten!?
Und Abraham? Lässt er sich beeindrucken? Hat ihn Gott in seiner „wunden Welt“, in seinem „Mikrokosmos“, in seiner Unfähigkeit, göttlich-groß und göttlichliebevoll zu denken, erreicht?
Die Antwort, die der Bibeltext bietet, ist kurz, zugleich aber klar: „Er glaubte dem Herrn“ (1. Mose 15,6).
Er hatte zum Himmel emporgeschaut und war verstummt. Staunendes Schweigen war seine Antwort, nicht stures oder verbissenes. Er hatte verstanden, dass es nicht klug ist, von den Möglichkeiten Gottes, der das gewaltige Heer der Sterne nicht nur erschaffen hat, sondern auch lenkt, gering zu denken. Es ist nie klug, von den Möglichkeiten Gottes gering zu denken. Und es ist erst recht nicht klug, von der Liebe und Güte Gottes gering zu denken. Seine Kraft in Verbindung mit seiner Liebe macht verständlich, was Jesus so ausdrückte: „Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich“ (Lukas 18,27).
Abraham glaubte dem Herrn. Das hebräische Wort für „glauben“ verwenden wir heute noch, wenn wir „Amen“ sagen. Es bedeutet so viel wie „das steht fest, so soll es sein“. In unserem Zusammenhang können wir es mit „festmachen“ übersetzen: Er machte sich fest in dem Herrn. Er verankerte seinen Glauben, sein Denken und Leben in Gott. In ihm fand er Halt. Aber mehr noch. Er sagte Ja zu dem, was Gott sagt und tut. Er achtete Gott treu in dem, was er verspricht. Er nahm seine Zusage absolut ernst. Er fragte nicht mehr, wie das alles zugehen soll, wo doch nach menschlichem Ermessen keine Hoffnung mehr bestand. Er rechnete mit Gottes Wundermacht, die kein „unmöglich“ kennt.
Vielleicht hilft uns diese Art zu glauben auch heute noch, wenn Fragen, Unsicherheiten oder Anfechtungen auftauchen. Paulus jedenfalls hat sehr ausführlich auf unsere Abrahamgeschichte zurückgegriffen,6 wenn er damit auch andere Ziele verfolgte. Mich bewegt, was der Apostel in Römer 4,21 feststellt. Er sagt, dass Abraham von dem, was Gott verheißen hat, völlig überzeugt war. Und dann fügt er die Gewissheit hinzu: „das kann er [Gott] auch tun“.
Wenn wir 1. Mose 15 und Römer 4 miteinander verbinden und auf eine Kurzformel bringen, dann könnten wir formulieren: Schaue zum Himmel (nicht in die Wolken, aber zum Herrn), ER kann.
Als Abraham nichts mehr zu bringen hatte (Paulus erwähnt in Römer 4,19 ausdrücklich seinen erstorbenen Leib), da handelte Gott! „Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du“ (Ghs 444,4) – so singen wir. Glauben wir auch so? Oder erwischen wir uns doch immer wieder bei dem: Wenn ich nicht gehorsam bin, kann mich Gott nicht lieben und erst recht nicht retten; wenn ich immer wieder sündige, zeigt das doch, dass ich Zweifel bezüglich meiner Rettung haben muss. So wie ich bin, passe ich doch gar nicht ins Reich Gottes.
Aber wollen nicht auch wir vertrauensvoll annehmen, was Gott uns in und mit Jesus schon längst bereitet hat? Wollen nicht auch wir das „Evangelium der fünf Buchstaben“ (Getan) glauben und nicht immer wieder in das falsche Evangelium der drei Buchstaben (Tun) zurückfallen? Getan – sagt Jesus. Alles bereitet. Du musst nichts mehr bringen; nimm nur glaubend an, was ich für dich erworben habe. Auch und gerade das Heil. Was denn sonst! Denn mehr lieben kann uns Gott gar nicht, als er es schon immer getan hat. Und wer denn sonst bringt das Heil, wenn nicht der Heiland.7 „Tun“ war gestern, als wir uns noch auf uns und unsere Frömmigkeit und unseren Geh...