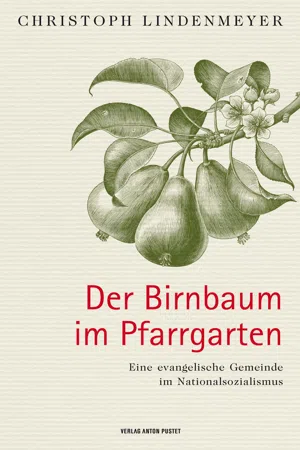![]()
1 | Kälte. Innen. Außen.
Über den Birnbaum gibt es eigentlich nichts zu berichten.
Er steht im Pfarrgarten am Dom-Pedro-Platz 5. Die herbstlichen Böen und der Feuersog der Luftangriffe auf München-Neuhausen fegten wahrscheinlich die vertrockneten, angesengten Blätter bis zur Braganzastraße und gegenüber an den Zaun in der Dom-Pedro-Straße. Den Winter, den Frühling, den Sommer und den einsetzenden Herbst hat er sicher gut überstanden. Die Erntedank-Festumzüge und die Aufmärsche der Nationalsozialisten.
Über diesen Birnbaum wäre also nichts zu sagen, außer dass es ihn in diesem Jahr 1945 immer noch gibt und dass ihn vielleicht jene Menschen besonders mögen, die unter seinen Ästen verweilten. Die evangelische Christuskirche ist eine Ruine, schon seit einem Jahr. Ausgebrannt: das Kirchenschiff mit dem Altar, die Orgel, die Empore. Der Dachstuhl zerstört. Die Haube des Kirchturms. Von innen ist die Sicht zum Himmel ungestört. Zwei Glocken des Kirchturms waren längst auf Befehl des NS-Beauftragten für den Vierjahresplan, Generalfeldmarschall und Reichswirtschaftsminister Hermann Göring, beschlagnahmt und abtransportiert worden: Und zwar durch die „Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Erfassung von Nichteisenmetallen“ vom 15. März 1940, vom Evang.-Luth. Landeskirchenrat, die im vertraulichen Schreiben an die Pfarrämter und exponierten Vikariate der Evang.-Luth. Kirche in Bayern mit Nachdruck noch einmal bekannt gemacht worden war. Die Kosten dafür übernahm die Reichsstelle für Metalle. An den Glockenklöppeln bestand offensichtlich kein Interesse. Sie blieben zurück. Bis Dezember 1942 lag dem Pfarramt der Christuskirche keine Bescheinigung über die Beschlagnahme der „Metallspende“ vor, wie sie von den Behörden zugesagt worden war. Erst 1943 hatte die Reichsstelle für Metalle und in deren Auftrag die örtliche Kreishandwerkerschaft eine Empfangsbestätigung vorgelegt. Sie war immer wieder vergeblich angemahnt worden.
In der apokalyptischen Stadtlandschaft der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“, dem jetzt völlig zerstörten München, steht also dieser Birnbaum im Jahr 1945, über den im Archiv des Pfarramts der Christuskirche keine Beschreibung vorliegt. Niemand hat ein Gedicht über den Baum geschrieben. Niemand einen Liedtext verfasst. Warum auch? Der Birnbaum ist vorhanden, hat vielleicht im Herbst Birnen abgeworfen. Es gibt unzählige Birnenarten, auch die Pastorenbirne, aber wir wissen nicht, ob am Baum Geißhirten- oder Williamsbirnen wuchsen, Sommer- oder Herbstbirnen oder auch Winterbirnen. So lange der Birnbaum im Pfarrgarten steht, spielt er keine Rolle. Vielleicht auch trägt er gar keine Birnen mehr. Vielleicht ist sein Astwerk längst morsch. Es gibt jetzt – weiß Gott! – ganz andere Probleme. Da interessiert sich doch niemand für einen Baum im Pfarrgarten.
Aber heute, am 26. November 1945, entdeckt Pfarrer Kutter, seit 1929 zunächst 3. Pfarrer in der Gemeinde, dass dieser Baum gefällt worden ist. Ein unglaublicher Vorgang, und jetzt wird er zum Streitobjekt zwischen dem 1. Pfarrer der evang.-luth. Christuskirchengemeinde, München-Neuhausen, Kirchenrat Ernst Kutter und dem gerade in die Stephanusgemeinde in Nymphenburg berufenen, bisherigen Seelsorger des 2. Pfarrsprengels, Kurt Frör. Darüber müsste nicht unbedingt berichtet werden. Wen geht dieser Streit vor Jahrzehnten schon etwas an?
Aber so ganz privat ist die Sache nicht. Denn der Streit um den Birnbaum zeichnet das Psychogramm von Persönlichkeiten, die ganz andere Sorgen haben, und er beschreibt die Not der Zeit. Die Nerven liegen blank. Die soziale und seelsorgerliche Lage in der Gemeinde kommt einem Notstand gleich. Der Schock über die Kapitulation des einstigen Großdeutschen Reichs ist bei vielen Menschen stärker als die Freude an der Befreiung, es ist kalt, es gibt zu wenig Heizmaterial, und die meisten Menschen hungern, auch in dieser Gemeinde. Die Namensliste der im Krieg und bei den Luftangriffen ums Leben gekommenen Gemeindeglieder wächst und wächst, andere sind noch immer vermisst. Niemand weiß, ob sie noch am Leben sind. Die Angst vor Denunziation und Verfolgung wandelt sich, sie bleibt, aber jetzt hat sie andere Motive. Die Arbeit in der Gemeinde ist kaum noch zu schaffen, die finanziellen Mittel sind knapp. Der Dauereinsatz gilt für die Pfarrer, die Mitglieder des Kirchenvorstands, die Diakone oder deren Vertreter, die Gemeindeschwestern und die vielen Helferinnen und Helfer in der Nähstube, im Besuchsdienst, in der Frauen- und Männerarbeit, in der Jugendarbeit der Pfarrgemeinde. Pfarrer Kutter organisiert und schreibt und organisiert und schreibt: an seine Gemeindeglieder in Kriegsgefangenschaft, so wie er ihnen immer zuverlässig Briefe und Literatur an die Front geschickt hatte, er schreibt an die US-Besatzungsbehörden, an die Familien von Gefallenen, an städtische Ämter, an seine vorgesetzten landeskirchlichen Institutionen, an Freunde, Mitarbeitende und Kollegen, an Handwerksbetriebe und Organisationen. Das Dritte Reich existiert nicht mehr, nur in vielen Köpfen wuchert es weiter, und die Bürokratie dieser frühen Jahre sorgt dafür, dass die Schreibmaschinen im Pfarramt fast ununterbrochen im Einsatz sind. Es ist – weiß Gott! – genug zu tun. Und trotzdem schreibt Pfarrer Kutter seinem Kollegen Kurt Frör einen Brief. Er ist empört. Er ist zornig. Denn es geht um diesen Birnbaum im Pfarrgarten, der nicht zum Privatbesitz zählt. Pfarrer 1 schreibt an Pfarrer 2:
Ich sah erst heute, dass im alten Pfarrgarten ein grosser Birnbaum gefällt wurde und dass er von Dir für Deinen persönlichen Gebrauch aufgearbeitet wird.
Ich halte das nicht für recht. Du bist weder nach der Abberufung noch unmittelbar vor der Abberufung berechtigt, den Baum zu fällen und das Holz für Deine eigenen Zwecke mitzunehmen. Du hast den Baum nicht gepflanzt. Du könntest sagen: „Aber ich habe während meiner Amtszeit andere Bäume gepflanzt und nehme nun diesen Baum für die gepflanzten Bäume mit.“ Aber die während Deiner Amtszeit gepflanzten Bäume wurden auf Kosten der Kirchenstiftungskasse gepflanzt. Sie sind daher ebenso Eigentum der Pfarrpfründe wie der gefällte Baum. Ich will keine Staatsaktion aus der Sache machen, aber ich möchte es Dir doch sagen, dass ich Dein Handeln als nicht recht empfinde.
Zur Erinnerung: Pfarrer Kurt Frör, 2. Pfarrstelle der Christuskirchengemeinde, hatte keine Entscheidungsgewalt mehr in der Gemeinde der Christuskirche. Schon gar nicht über Arbeiten im alten Pfarrgarten. Doch Frör wehrt sich gegen solche Vorwürfe.
In Deinem „brüderlichen Schreiben“ scheinst Du mir doch sehr mit zweierlei Mass zu messen. Bekanntlich hast Du Holz vom Dachstuhl des Gemeindehauses, das Eigentum der Kirchenstiftung ist, an die Familien des Gemeindehauses verteilt, ohne dass sie dafür etwas bezahlt haben. Ich will nicht davon reden, dass Du mich dabei übergangen hast, obwohl Du seinerzeit das Abfallholz aus dem 2. Pfarrhaus auch an alle verteilt hast. Umso mehr aber hättest Du Anlass gehabt, dann mir den alten morschen Baum zu überlassen, der wie jenes Holz Eigentum der Kirchenstiftung ist. Nachdem die Sache aber einmal zur Sprache gekommen ist, will ich nicht als einer erscheinen, der sich zu guter Letzt an dem Eigentum der Kirchenstiftung unrechtmässig bereichert. Ich habe mir von der Gärtnerei Danner eine Aufstellung geben lassen über die Preise, die im Durchschnitt für die seinerzeit von mir auf Rechnung der Kirchenstiftung neu gepflanzten Obstbäume gelten. Der Preis eines Baumes erreicht im Höchstfall 5 Mark. Die Aufstellung liegt bei. Ich werde daher der Kirchenstiftung den Betrag von 5.- Mk. überweisen für einen der damals gesetzten Obstbäume, damit ich den Ersatz für den gefällten Baum aus der eigenen Tasche bezahlt habe.
So schreiben sich die Kollegen „mit amtsbrüderlichem Gruß“ ihren Ärger vom Leib. Am 30. November 1945 antwortet Ernst Kutter:
Zu Deinem persönlichen Schreiben teile ich Folgendes mit. Zunächst lehne ich es ab, dass der Baum, welchen Du hast fällen lassen zu einer Zeit, da Du kein Recht mehr an dem Garten hattest, mit 5 Mark bezahlt werden soll. Ich nehme das Geld nicht an. Was hier geschehen ist und wie es nun beglichen werden soll ist echte Frörsche Unverfrorenheit.
Zu den anderen Darlegungen teile ich Folgendes mit.
Das Brandholz vom Dachstuhl des Gemeindehauses ist mit Zustimmung aller Hausbewohner nach Befragung des Kirchenbauamtmannes an die Hausbewohner des Gemeindehauses verteilt worden. Ein Teil wurde ausgenommen und für gemeindliche Zwecke reserviert. Die Bewohner des Gemeindehauses hatten ein Anrecht auf dieses Holz, da die Zentralheizung, die nicht genügend durchgeführt werden konnte und nun ganz ruht, trotzdem monatlich bisher mit der Miete weiterbezahlt wurde. Ich habe seinerzeit ausdrücklich die Frage besprochen, ob der 2. Pfarrer auch Anteil an der Verteilung dieses Holzes bekommen soll. Sie wurde verneint. Das Abfallholz des 2. Pfarrhauses wurde zum allergrössten Teile vom 2. Pfarrer selbst genommen. Das lässt sich noch feststellen von dem Holz, welches der 2. Pfarrer reserviert hat in dem neuen dem Konfirmandensaale liegenden Zimmer. Das seinerzeit gerecht verteilte Abfallholz stammte zum allergrössten Teile von der zerstörten Kirche. Ich stelle fest: Am besten bei der Holzverteilung ist jedenfalls der 2. Pfarrer weggekommen, der selbst dafür sorgte.
Nun noch ein nicht brüderliches, sondern ein menschliches Wort zu der ganzen Angelegenheit. Die Handlungsweise, dass ich nach Antritt meiner neuen Pfarrstelle einen grossen Baum fällen lasse in mir nicht mehr zustehendem Grundstück und den Holzwert dieses Baumes dann mit dem Werte eines ganz kleinen Baumes begleichen will und das alles erst auf einen freundlichen Wink hin, erinnert mich stark an nicht arische Handlungsweise. Mir kommt es hier nicht auf das Holz an, auch nicht auf die Begleichung des Holzwertes, sondern darauf, dass hier eine Handlungsweise vorliegt, welche ich nicht stillschweigend übergehen durfte. Ich versuchte sie in brüderlicher Weise darzulegen. Du hast in die Sache einen anderen Ton hineingetragen.
Es hätte für mich einen Reiz, diesen Ton aufzugreifen und auf vergangene Zeiten zurückzugreifen und sie einmal auf Tapferkeit und auf Feigheit zu prüfen, auf Ehrlichkeit und das Gegenteil. Aber ich höre immer wieder einen anderen Ton: „Lass Dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse durch Gutes.“ Darum will ich weiter ringen, aber es könnte doch einmal notwendig werden zu reden, anstatt zu schweigen. Das aber darf ich wohl einmal sagen. Ich habe in schweren Augenblicken Deines Lebens unter Hintansetzung meiner Person zu Dir gestanden. Hätte ich damals nicht gewagt, Du wärest verloren.
Pfarrer Ernst Kutter und Pfarrer Kurt Frör: Sie standen in klarem Gegensatz zur „Weltanschauung“ des Nationalsozialismus, der eine später, der andere von Anfang an. Der Ältere, Ernst Kutter, brauchte Zeit, um für sich die Nazi-Ideologie und ihren Führerkult zu entmythologisieren, aber es gab niemanden in der Gemeinde, der ihm eine Nähe zum NS-Regime nachgesagt hätte – im Gegenteil: Kutter, mehrfach von Hausdurchsuchungen durch die Gestapo betroffen, musste sich gegen Denunzianten wehren, die ihm vorwarfen, in seiner Arbeit als Pfarrer aktiven Widerstand zu leisten. Der Jüngere, Kurt Frör, war seit Beginn in der Pfarrbruderschaft, in der Bekenntnisgemeinschaft, der späteren Bekennenden Kirche aktiv und stand in einer schroffen Ablehnung des „Deutschen Christentums“, wie es von den Nationalsozialisten theologisch und organisatorisch gewaltsam etabliert worden war. Der jüngere Pfarrer, mehrfach in Haft, wirkt in seinen Briefen aufbrausend. Ungeduldig. In jedem Fall: leidenschaftlich und zornig. Dabei hatte ihn Kutter immer wieder, wie er schreibt, vor Schlimmerem bewahrt.
Wie der Streit um den Birnbaum im Pfarrgarten endete? Die Korrespondenz im Archiv der 1. Pfarrstelle in der Christuskirchengemeinde ist nicht vollständig. Nur eines ist sicher: Der Birnbaum wurde verheizt. So oder so. Der Zorn verrauchte auf beiden Seiten nicht so schnell, zumal es noch ein anderes Problem gab. Darüber soll später berichtet werden.
![]()
2 | Abschied. Einer. Zwei. Viele.
Mit deutschem Gruß!
Heil Hitler!
1936 sind die Grußformeln in Briefen an das Stadtpfarramt der Christuskirche längst eindeutig. Ferdinand S. aus der Schluderstraße ersucht das Pfarramt am 10. Juni 1936, „mir Austrittsschein aus der evangelisch-lutheranischen Kirche zuzusenden“. Der Mann gehört der SA an. Man weiß, dass er sich – wie der Gemeindediakon Georg Mayer notiert – dem „Rosenberg’schen Geist vollständig verschrieben“ hat. Der SA-Mann begründet seinen Brief mit der Formel Austritt erfolgt aus gegebener Veranlassung, bevor er unter seinem „deutschen Gruß“ unterzeichnet und den frankierten Freiumschlag erwähnt. Ordnung muss sein. Ordnung nach Art der aufrichtigen Deutschen.
Ende September 1936 trifft neben den inzwischen üblichen, zahlreichen Kirchenaustritts-Schreiben ein ausführlicher Brief eines Gemeindeglieds aus der Olgastraße im Pfarramt Christuskirche ein. Ernst Kutter liest, was Fritz L-S. ihm schreibt:
Unter nachfolgender Begründung sage ich mich von der ev.-luth. Glaubensgemeinschaft los und erkläre meinen Austritt aus der Evangelischen Kirche. Ich ersuche um Bestätigung meiner Austrittserklärung.
In dem vom Führer geschaffenen neuen Deutschland haben sieben große Begriffe wieder eine hohe, heilige Bedeutung erhalten und stehen im Mittelpunkt des geistigen Interesses jedes deutschen Menschen.
Es sind dies die Begriffe: Geschichte, Heimat, Blut, Familie, Rasse, Volk, Staat.
Seit der Christianisierung Deutschlands und noch heute versündigen sich die christlichen Kirchen täglich an den hehrsten Begriffen deutschen Wesens:
Die Geschichte wird gefälscht, die Heimat verraten, das Blut geschändet, die Familie missachtet, die Rasse verleugnet, das Volk belogen, der Staat betrogen.
Einerlei ob Protestantismus oder Katholizismus, beide Kirchen tragen eine große Schuld an dem Unglück des deutschen Volkes: Der Katholizismus, weil er deutsche Art und Tat bewusst und offen bekämpft und der Protestantismus, weil er seit Doktor Martin Luthers Tod zu protestieren aufgehört hat.
Für einen deutschen Menschen, der nicht nur mit dem Kopfe, sondern auch mit dem Herzen denkt und glaubt, ist es unerträglich, einer äußerlichen Religionsgemeinschaft anzugehören und sich zu ihr zu bekennen, die seine idealsten Empfindungen verhöhnt und beschmutzt, oder solchem Frevel tatenlos zur Seite steht.
Ich glaube nicht an einen Gott, der Künder und Rufer seines Wortes duldet, die die Juden, die Söhne des Teufels an seinen reinen Altar führen wollen.
Ich kann nicht an ein Wort glauben, das die Lehre der Gnade und Demut zum obersten Grundsatz hat und das Geschichtsbuch des jüdischen Volkes die „Heilige Schrift“ nennt.
Ja, ich kann mich nicht mehr zu einer Kirche bekennen, die von der Kanzel des Gotteshauses aus geg...