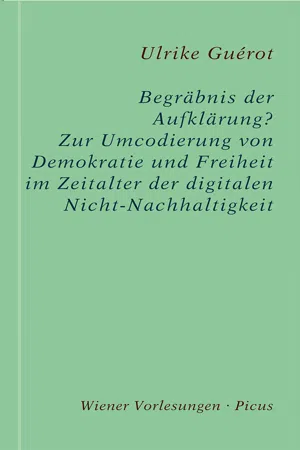
eBook - ePub
Begräbnis der Aufklärung?
Zur Umcodierung von Demokratie und Freiheit im Zeitalter der digitalen Nicht-Nachhaltigkeit
- 76 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Begräbnis der Aufklärung?
Zur Umcodierung von Demokratie und Freiheit im Zeitalter der digitalen Nicht-Nachhaltigkeit
Über dieses Buch
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot erkennt die veränderten globalen anthropologischen Umstände – Klimakatastrophe und Digitalisierung – und konstatiert ein Spannungsfeld zwischen Aufklärung und (Klima-)Apokalypse. Die (individuelle) Freiheit, die die Menschen in Anbetracht der notwendigen Regulierungen glauben fordern zu müssen, ist überholt. Es braucht, so Guérot, eine anspruchsvolle Art von Freiheit, eine, die ein Ziel hat, nämlich ein würdevolles Leben für die gesamte Menschheit, selbst wenn dies mit Einschränkungen für den Einzelnen verbunden ist.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Begräbnis der Aufklärung? von Ulrike Guérot im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politica e relazioni internazionali & Ideologie politiche. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Begräbnis der Aufklärung?
Zur Umcodierung von Demokratie und Freiheit im Zeitalter der digitalen Nicht-Nachhaltigkeit
Einleitung
»Wir können, so befürchte ich, allenfalls darauf hoffen, dass die Freiheit in einem politischen Sinne nicht wieder für Gott weiß wie viele Jahrhunderte von dieser Erde verschwindet.«
HANNAH ARENDT
Aufklärung! Welche schönere, anspruchsvollere Ideologie hätte die Menschheit je hervorgebracht als jenes kollektive Streben nach Vernunft, das Heraustreten des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit, das Ablegen des Ballasts kirchlicher Dogmen, die Durchbrechung engstirnigen Denkens durch den Ruf der Freiheit und den Zugang zu Wissen sowie schließlich jenes – zumindest in Europa – parallele Versprechen auf Demokratie und Sozialismus: »Alle Menschen sind geboren frei und gleich in ihren Rechten«, so heißt der erste Satz der Erklärung der Menschenrechte von 1789, die auf den revolutionären Schlachtruf Liberté, Égalité, Fraternité folgte, der indes mit der Guillotine endete. Noch heute, unter Bedingungen der »globalen Moderne« (Cornelia Koppetsch), mutet dieser Satz – obgleich knisternd aktuell – fast wie eine beschwipste Laune an.
Seit nunmehr knapp 230 Jahren gehören in Europa Texte über die Aufklärung zu den Juwelen ideengeschichtlicher Literatur, angefangen mit Kants erstem Aufschlag Was ist Aufklärung? von 1784, über den emanzipatorischen Rousseau und den skeptischen Hegel bis hin zu Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung, geschrieben aus einer Position der absoluten Fassungslosigkeit heraus, dass eben jene Aufklärung das zivilisatorische Versprechen, mit dem sie angetreten war, ausgerechnet im beginnenden 20. Jahrhundert verraten hat. »Ich bin ganz sicher, dass diese ganze totalitäre Katastrophe nicht eingetreten wäre, wenn die Leute noch an Gott oder vielmehr an die Hölle geglaubt hätten, das heißt, wenn es noch letzte Prinzipien gegeben hätte. Es gab aber keine. (…) Man konnte niemanden anrufen«, sollte Hannah Arendt später darüber schreiben.1 Dass die große politische Denkerin und Idealistin hier letzte metaphysische Prinzipien postuliert, muss an dieser Stelle irritieren. Da ist Hannah Arendt für eine Sekunde weder liberal noch aufklärerisch. Es würde ja darauf ankommen, innerweltliche Sicherheiten zu fordern, die nach dem Verlust des großen Glaubens eine politische Glaubwürdigkeit schaffen, die auf Verständigung, Vertrauen und praktischer Kooperation beruht. Die frühmoderne Aufklärung hatte den mittelalterlichen Kosmos vom christlich-scholastischen Kopf auf neuzeitliche Füße gestellt. Doch jeden Glaubens beraubt, hatte stattdessen eine absolute, ankerlose Unvernunft in ein menschliches Verderben von bis dato ungekanntem (und ungeahntem) Ausmaß geführt.
Ein Vierteljahrhundert nach Adorno schließlich, gegen Ende der siebziger Jahre, verfasste Michel Foucault seinen Text Was ist Aufklärung? und verweist in seiner Interpretation das Kant’sche aude sapere, jenes Recht, ja, die Pflicht, seinen Verstand zu gebrauchen, überraschenderweise in das Reich des Gehorsams, nicht in das der Freiheit, genauer: Foucault verweist auf den Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Gebrauch der Vernunft. Aufklärung ist daher nicht bloß der Prozess, in dem die Individuen ihre persönliche Meinungsfreiheit garantiert sehen. Aufklärung gibt es dort, wo sich der universale, der individuell-freie und der öffentliche Gebrauch der Vernunft überlagern. Und dies ist letztlich nur der Fall, wenn mündige Bürger freiwillig in die Pflicht des Dienstes am Gemeinwohl einwilligen, zumindest aber in die Begrenzung ihrer Freiheit durch die volonté générale. Das Einzigartige an Kants Text ist laut Foucault der Bezug auf das damalige, das Kant’sche »Heute«, jenen Wendepunkt in der Geschichte, der den Horizont der Moderne eröffnete und ab dem die Aufklärung nicht zum Zustand, sondern zur menschlichen Aufgabe wurde.
1997 hat Helmut Reinalter an dieser Stelle im Rahmen der Wiener Vorlesungen die Frage gestellt, ob die Aufklärung noch ein tragfähiges Prinzip ist.2 Wahrscheinlich war es der letzte Moment, in dem diese Frage noch so – aus heutiger Perspektive naiv – vorgetragen werden konnte. Denn was kommen wird, liegt inzwischen offen auf dem Tisch. Das libertär-liberale Konzept von Freiheit als Ungebundenheit und Selbstbestimmung ist am Ende. Und das (globale) Gemeinwohl ist eine Chimäre. Die neue narzisstische Kränkung, die sich aus dieser Erkenntnis ergibt, wird nicht leicht zu verdauen sein. Der Mensch als Herr der Schöpfung hat versagt.
Konnte Foucault in Kants damaligem »Heute« von 1784 – ab jetzt Aufklärung! – den Umriss einer Haltung der Moderne erkennen, so ist diese Moderne, die aus Untertanen Bürger machte und perspektivisch eine freie Zukunft für alle verkündete, endgültig vorbei. Ebenso wie inzwischen auch die Postmoderne, die die unerschöpfliche Gegenwart des Einzelnen anpries. Inzwischen leben wir, wie es die katalanische Philosophin Marina Garcés in ihrem Aufruf zu einer neuen radikalen Aufklärung formuliert, in der »posthumen Kondition«. Unter den apokalyptischen Bedingungen des Klimawandels, die der Weltklimareport 2019 auf stolzen 1200 Seiten auflistet, (über)lebt die globale Bevölkerung auf einmal – jeder gegen jeden – in einer offenbar endlichen Zeit. Und zum anderen in einer immer smarteren Welt, die die Infantilisierung ihrer Bewohner immer weiter vorantreibt.
Das heutige »Heute« ist anti-aufklärerisch, insofern es nur nach technologischen Lösungen verlangt und überhaupt keinen aufklärerischen, eben der Vernunft inhärenten Anspruch formuliert, uns als Personen oder als Gesellschaft besser zu machen. Zumindest war das der idealistische Anspruch, angefangen mit Kants mündigem Bürger (Gewissen statt Gott) über Rousseaus Émile bis hin zu Pestalozzis aufgeklärter (oder idealistischer?) Pädagogik. Lange Jahrzehnte war der bessere Mensch ein post-revolutionäres, gesellschaftliches Großexperiment, das allerdings im erst erträumten,3 dann im real existierenden Sozialismus auf die schiefe Bahn geriet und konsequenterweise von der konkurrierenden Idee, dem ganz und gar nicht idealistischen Kapitalismus, schließlich beherzt beiseitegeschoben wurde.
Eine normativ positive Besetzung von Verzicht – gar Verzicht zugunsten des Gemeinwohls –, einst eine Primärtugend, oder sogar Verbote scheinen seither unmöglich. Das Verbot scheitert tagesaktuell im politischen Prozess schon an der Plastiktüte. Der moderne Verbraucher pflege vor allem im Bereich von Textilien und Medienutensilien den »Spontankauf«, da müsse die Plastiktüte schon mal drin sein, ließ der Präsident eines Wirtschaftsverbands an dem Tag im Radio verlauten, an dem das deutsche Umweltministerium sich an einem Verbot der Plastiktüte versuchte. Der Mensch in der »posthumen Kondition« ist im beginnenden dritten Jahrtausend nicht fähig, auf eine Plastiktüte zu verzichten, und soll dazu auch nicht gezwungen werden müssen, denn es könnte ihn überfordern. Vernünftig ist das nicht. Idealistisch auch nicht.
Die stupende normative Behäbigkeit des real existierenden Kapitalismus, irgendeinen Gesellschaftsentwurf außerhalb sich selbst auch nur für möglich zu halten, die fast schon systemische Unterdrückung der politischen Diskussion über Alternativen sowie die subtilen, tiefenpsychologischen und kommunikativen Methoden seines institutionalisierten Selbsterhalts, zumal unter digitaler kybernetischer Steuerung, erinnern darum an jenen Slavoj Žižek zugeschriebenen Satz: »Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.« Hatte die Aufklärung aus Untertanen Bürger gemacht, so gibt es in der »posthumen Kondition« keine Bürger mehr, nur noch Konsumenten oder Zuschauer, die mit distanzierter Haltung auf die globalen Ereignisse schauen, als wären sie selber nicht davon betroffen oder könnten sich jederzeit auf einen Planeten B retten, weswegen sie ihr eigenes Tun auch zunehmend in die virtuelle Welt verlagern. Es ist, als würde man die Klimakatastrophe – wie inzwischen fast alles – nur noch durch die Linse eines iPhones wahrnehmen, das an einem Selfie-Stab befestigt ist: Hauptsache, man ist dabei gewesen und hat das dokumentiert.
Gegenwärtig verhandelt die Zeitgenossenschaft die Frage, ob sich die monströse, unendlich formbare Entität des Kapitalismus, die fähig ist, alles zu absorbieren, auch die Fridays-for-Future-Bewegung einverleibt, indem vor allem das historische Subjekt der Greta Thunberg zunehmend aufgrund ihrer vermeintlichen Emotionalität verspottet wird, als gehörte es zur bürgerlichen Pflicht, der klimatologischen Apokalypse mit Gelassenheit zu begegnen. Auffällig ist lediglich, dass der Vorwurf der weiblichen Hysterie, dem sich die (vernünftige) Forderung nach Frauenwahlrecht vor rund hundert Jahren noch ausgesetzt sah, von den meist männlichen Kritikern Greta Thunbergs bisher ausgeblieben ist. Indes wird ihr, die sie auf wissenschaftliche Zahlen und Studien rekurriert, öffentlich Irrsinn vorgeworfen, und das in einer Zeit, in der seit Langem kein Bereich der Politik mehr ohne eine »evidenzbasierte« Studie als Entscheidungsgrundlage auskommt, da souveräne politische Entscheidungen längst pathologisiert worden sind. Problematisch wird es heute also in der Politik, wenn die »Evidenzen« nicht passen beziehungsweise mit dem eigenen Wollen nicht kongruent sind. Das Trotzdem ist das eigentlich politische Element.
Diese institutionell flankierte, politische Unvernunft ist zum zentralen Element der postdemokratischen Wende beziehungsweise zum Kern der simulativen Demokratie4 geworden. Wo die Demokratie nicht in der Lage scheint, langfristigen Nutzen für alle (das Gemeinwohl) gegen kurzfristige Kosten (den Verzicht oder gar das Verbot von Plastiktüten, geschweige denn von SUVs, Fleisch oder Flugreisen) zu verhandeln, und schon gar nicht in globalem Maßstab, gibt es nur noch die eine Zeit, ein Jetzt ohne Zukunft, in der die vielen möglichst alles wollen und niemand auf Privilegien verzichten möchte. Die Demokratie in fortgeschrittenen Konsumgesellschaften ist nicht mehr dazu da, dies zu ändern, sondern diesen Zustand zu verschleiern. Sie verändert darum derzeit ihre Form wie ein Chamäleon seine Farbe, und je mehr eine verschreckte Zivilgesellschaft den demokratischen Prozess einfordert, desto mehr erliegt sie wohl selbst einer postfaktischen Täuschung mit Blick auf ihren eigenen Sehnsuchtsort, die Demokratie.
Im Zuge dieses anti-aufklärerischen Krieges ist inzwischen die radikalere Frage der »posthumen Kondition«, die sich derzeit in der Literatur, der Kunst oder auch dem politischen Aktionismus (Extinction Rebellion) ihren Weg bahnt, jene, wie lange wir an der Demokratie als Mechanismus zur Regulierung von Gesellschaft festhalten wollen. Anders formuliert, die Frage, ob es gar vernünftig sein könnte, das Projekt der Aufklärung als Projekt der Vernunft mit anderen als demokratischen Mitteln der Mehrheitsfindung fortzusetzen und welche das sein könnten? Doch ist auch diese Frage letztlich schon obsolet, noch bevor sie gestellt wird, da es spätestens seit Mitte des letzten Jahrhunderts absolut unvernünftig ist, die Aufklärung noch als einen absoluten Zweck zu postulieren; und seit der zweiten Hälfte ebenjenes Jahrhunderts ist es ebenso unvernünftig, noch davon auszugehen, dass es so etwas wie eine Gesellschaft gibt: »There is no such thing as society«, rief Margret Thatcher schon Mitte der achtziger Jahre.
Dennoch: Der wahre Geist des Gesellschaftsvertrags von Rousseau, eines der schönsten, stärksten und luzidesten Bücher im Vorfeld der Französischen Revolution (1762), besteht nicht in dem Gedanken, dass eine Sache gerecht ist, weil das Volk sie will, sondern darin, dass der Wille des Volkes unter gewissen Bedingungen eher der Gerechtigkeit entsprechen dürfte als jeder andere (individuelle) Wille. »Das Kriterium des Guten ist die Wahrheit, die Gerechtigkeit, an zweiter Stelle der Gemeinnutzen«,5 schrieb die junge französische Philosophin Simone Weil in einer kleinen Schrift 1943, in der sie die generelle Abschaffung der politischen Parteien forderte, da diese immer nur durch die eigene Meinung gefilterte Perspektiven einnehmen und deswegen im politischen Prozess nie wirklich für das Gute und Wahre einstehen können. Die Wahrheits- und Gerechtigkeitsfindung im Rousseau’schen Sinne des Gesellschaftsvertrags braucht aber einen gesellschaftlichen Mechanismus. »Wenn die Demokratie ein solcher Mechanismus ist, dann ist sie gut. Sonst nicht«6, schreibt Weil in verblüffender Einfachheit, ohne sich, wie die politische Theorie heute, Gedanken darüber zu machen, dass man sich mit einer solchen Feststellung mit denjenigen, notabene den Populisten, gemeinmacht, die sich die Abschaffung der (liberalen) Demokratie zum Ziel gesetzt haben. »Die Demokratie, die Macht der größeren Zahl, sind keine Güter. Sie sind Mittel zum Guten, die zu Recht oder zu Unrecht für wirksam gehalten werden«7, heißt es bei Weil, die indes definitiv keine ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Impressum
- Über den Autor
- Titel
- Inhalt
- Einleitung
- Schlussfolgerungen
- Literatur zum Weiterlesen