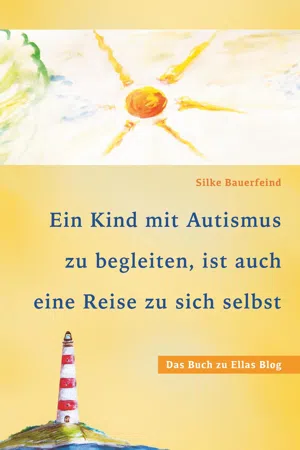![]() II - Eine Reise zu sich selbst
II - Eine Reise zu sich selbst![]()
Manchmal und meistens
Manchmal fließen sie haltlos
Gefühle der Fremdbestimmung, des Alleinseins,
der Aussichtslosigkeit auf Veränderung.
Manchmal kullern sie hinab
Sorgen, Zweifel und das Empfinden von Ohnmacht.
Manchmal tränt es lautlos
in schlaflose Nächte hinein.
Manchmal löst eine Frage die nächste ab
und schnürt mir die Kehle zu.
Manchmal sehe ich mich um
und finde niemanden, der mich versteht.
Manchmal renne ich den ganzen Tag
und habe dennoch das Gefühl still zu stehen.
Manchmal erkläre ich etwas zum zweiten und dritten Mal
und sehe trotzdem in fragende Gesichter.
Manchmal entschuldige ich mich für Dinge
nur um irgendetwas zu sagen und dann zu gehen.
Manchmal ziehe ich mich zurück
um diesem Wahnsinn um uns herum zu entfliehen.
Meistens bin ich unendlich dankbar dafür
dass du mir so viel zeigst und
dass ich dich begleiten und tragen darf,
mein Kind.
Nachdem es im ersten Teil darum ging, sich mit dem Autismus-Spektrum auseinanderzusetzen, werden nun die Gefühle, Gedanken, Pläne, Sorgen und Wünsche von Eltern Raum bekommen. Da es hierbei nicht nur um meine eigenen Gedanken gehen, sondern ein möglichst vielfältiges Stimmungsbild eingefangen werden soll, werde ich vor allem die Auswertung der Fragebögen, die ich bereits in den einleitenden Worten zu diesem Buch erwähnt hatte, einbeziehen. Die Antworten sind als Zitate gekennzeichnet und vollständig anonymisiert. Alle Fragebögen wurden inzwischen vernichtet beziehungsweise gelöscht.
Hast du dich verändert, seit du ein autistisches Kind hast?
Diese Frage hatte ich mir zunächst selbst gestellt und veröffentlichte folgenden Blogbeitrag:
Spontan denke ich dann: „Es hat sich unglaublich viel verändert“, aber wenn ich es erzählen möchte, weiß ich nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Manches fällt mir auf Anhieb nicht ein, weil es so normal und alltäglich geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, an die ich mich wohl nie gewöhnen werde, weil es mein Körper schon gar nicht zulässt, zum Beispiel über 16 Jahre hinweg nicht ausreichend Schlaf zu bekommen. Trotzdem habe ich versucht, ein paar Dinge aufzuschreiben, die sich verändert haben und die ich lernen durfte.
Bevor Niklas geboren wurde, hatte ich noch nahezu uneingeschränktes Vertrauen in das, was Ärzte sagten. Inzwischen wäge ich sehr genau ab, wem ich glaube, was er sagt, und wem nicht, und mit wem es lohnt, sich auf eine konstruktive Diskussion einzulassen, und mit wem nicht. Der Begriff „mündiger Patient“ hat für mich seitdem ein wirkliches Innenleben erhalten, denn ohne Eigeninitiative und Eigenengagement, was das Einholen von Informationen zu Krankheiten und Therapien angeht, funktioniert es nicht.
Glücklich kann man sich schätzen, wenn man an Ärzte und Therapeuten gerät, mit denen ein respektvoller Austausch möglich ist, ohne dass die jeweiligen Kompetenzen untergraben werden.
Ich hätte niemals gedacht, dass man mit einem Kind über mehrere Stunden hinweg über ein und dasselbe Thema sprechen kann. Manchmal gebärden wir den ganzen Nachmittag darüber, dass der Schulbus eine andere Farbe hatte oder ein Hase im Garten sitzt oder darüber, dass Wimpern weicher sind als Kopfhaare oder darüber, dass vor zwei Stunden eine Sirene ertönte und ein Krankenwagen unterwegs ist, um Menschen zu helfen, oder oder oder. Wenn man diese Themen ständig wiederholt, löst das bei mir Assoziationsketten aus, die ich inzwischen kreativ nutzen kann.
Manchmal – nicht immer.
Ich war schon immer ein strukturierter, gut organisierter Mensch. Diese Eigenschaft kann ich nach wie vor gut gebrauchen, wenn es um Korrespondenz beziehungsweise Auseinandersetzungen mit Krankenkasse, Ämtern, Schule, Therapeuten usw. geht. Was allerdings das Zusammensein mit Niklas betrifft, musste ich lernen, meine Vorstellungen von einem gelungenen Ausflug oder einem sinnvoll verbrachten Nachmittag vollständig hinten anzustellen. Wenn er zuhause ist, spielt meine Meinung darüber, wie und wo wir gemeinsame Zeit verbringen, überhaupt keine Rolle.
Er zeigt mir das, was er sieht: Schatten an der Wand, Kratzer im Boden, Fusseln unter dem Schrank, stinkende Socken (eine Lieblingsbeschäftigung) und macht mich auf Geräusche aufmerksam, die ich ohne seine Hinweise nicht wahrgenommen hätte. Er nimmt mich an der Hand und zeigt mir einen Teil unserer gemeinsamen Welt, den ich alleine nicht sehe und der bereichernd, aber ebenso verstörend sein kann. Je mehr er mir zeigt, desto besser verstehe ich ihn.
Inzwischen hat er gelernt zu akzeptieren, dass ich zum Beispiel ans Telefon gehe, wenn es klingelt oder ich zwischendurch dem Postboten die Tür öffne. Das war eine Zeit lang nicht möglich, aber in dem Maße wie ich mich auf seine Struktur einließ, in dem Maße kam er auch mir entgegen. Es ist ein Geben und Nehmen – ein aufeinander Zugehen.
Früher hätte ich sicher vorschnell geurteilt, dass es sich um ein bockiges, freches Kind handelt, sobald Gegenstände fliegen, Dinge kaputt gehen oder herumgeschrien wird. Heute frage ich mich immer, was der Auslöser dafür ist.
Meistens liegen diese Ausbrüche in äußeren Reizen wie Geräuschen, Gerüchen, Berührungen oder unvorhersehbaren Ereignissen begründet. Natürlich gibt es Situationen, in denen sich Niklas wie jeder andere Teenager einfach beleidigt und frech aufführt. Es lohnt sich, in schwierigen Situationen genau hinzusehen, denn zu viel Rücksichtnahme bei Verhalten, das nicht durch den Autismus bedingt ist, ist für die jeweilige Situation möglicherweise erstmal entschärfend, löst aber das Problem für die Zukunft nicht. Genauso wichtig ist es herauszufinden, welche Auslöser für Verhalten in der Wahrnehmung oder in nichteingehaltenen versprochenen Strukturen und damit im Autismus zu finden sind. Denn mit diesem Verständnis (im Sinne von Verstehen) ist es besser möglich, in Zukunft entsprechend zu reagieren.
Das auseinander zu halten – Wahrnehmung und Autismus oder Pubertät beziehungsweise normales „Frechsein“ und Provozieren – ist nicht immer einfach und stellt meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen dar (übrigens auch für Geschwisterkinder, doch das ist ein extra Thema).
Ich habe gelernt, dass es für Niklas sehr wichtig ist, sich an etwas festhalten zu können (rw). Mit Festhalten meine ich kleine Rituale oder Stereotypien, die ihm Sicherheit geben. Er dreht und kurbelt gerne Schnüre und Kabel. Das beruhigt ihn und es „beamt in nicht weg“, macht ihn nicht unansprechbar, sondern im Gegenteil: es befähigt ihn, ruhig zu werden, zuzuhören und zu filtern, was wichtig für ihn ist. Auch ein gelegentliches Prusten mit den Lippen beruhigt ihn und ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass es ihm gut geht. Wenn ich ihm das wegnähme und versuchte, ihm das abzutrainieren, wie das in bestimmten Therapien als Ziel verfolgt wird, nähme ich ihm ein Stück Lebensqualität und Sicherheit, die er dringend braucht und die ihn in keiner Weise einschränkt.
An Tagen, an denen alles zusammenzubrechen droht, ich nur noch das Negative sehe und mir denke „so geht es nicht weiter“, versuche ich mir zu vergegenwärtigen, wieviel Schlaf ich in den letzten Nächten hatte. Wenn es sehr wenig war, sehe ich die Dinge insgesamt in einem düsteren Licht, die Nerven liegen blank, die Belastungsgrenze ist erreicht. Das geht sicher jedem so.
Ich mache mir dann klar, dass das ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist, um sich über Interventionsmaßnahmen mit möglicherweise weitreichenden Folgen Gedanken zu machen. Meistens nehme ich mir einen Zettel und schreibe auf, was mir gerade durch den Kopf geht. Diesen Zettel nehme ich ein paar Stunden oder Tage und Wochen später nochmal zur Hand und überlege, welche meiner spontanen Gedanken und Ideen gut und realisierbar sind. Manchmal kann ich das Blatt Papier direkt in den Mülleimer werfen, aber manchmal entwickeln sich aus den vormals spontanen Gedanken gute Ideen.
Es hört niemals auf – es gibt immer wieder neue Themen, neue Sorgen, neue Termine, neue Herausforderungen, neue Krisen und es bleibt uns nichts anderes übrig, als sie anzunehmen, wie sie kommen. Dabei kann man sich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Manches muss auch mal warten bis ein anderes Problem gelöst ist. Was ich damit sagen will?
Ich musste lernen, meinen Perfektionismus zu zügeln. Es ist nicht möglich, immer alles sofort und gleichzeitig und zur Zufriedenheit aller zu lösen. Wenn etwas liegenbleibt, bleibt es eben liegen und dann kann es sein, dass andere unzufrieden sind. Damit musste ich erst lernen umzugehen.
Am Schwierigsten dabei ist für mich allerdings immer noch, meinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Immer wieder merke ich, dass ich mir selbst hohe Ziele stecke und an mich hohe Erwartungen stelle, die manchmal einfach nicht zu erfüllen sind.
Sei gelassener, gnädiger, geduldiger mit dir. Das sage ich mir oft selbst.
Damit sind wir bei einem ähnlichen Thema: als Mutter eines autistischen oder behinderten Kindes hat man niemals das Gefühl, alles richtig zu machen. Ich informiere mich, recherchiere, führe Gespräche, schaue genau hin, hinterfrage, korrigiere, versuche Neues und so weiter, aber niemals habe ich das Gefühl, genug zu tun. Immer bleibt dieser Zweifel, ob es reicht.
Das zermürbt. Früher war ich nicht so – ich entschied etwas und dann wurde es gemacht und es war gut. Manchmal wünsche ich mir ein Stückchen von dieser Überzeugung zurück.
Ohne Niklas hätte ich vieles nicht gelernt, nicht kennengelernt, vielen beeindruckenden Menschen wäre ich nicht begegnet und ich hätte einige Entscheidungen in meinem Leben nicht getroffen, womit mir vieles vorenthalten geblieben wäre. Ich hätte aber auch viel Schlimmes nicht erleben müssen, viele Tränen nicht geweint, manch‘ Einschränkung nicht hinnehmen müssen, müsste gewisse Zukunftsängste nicht aushalten.
Aber das Wichtigste: ich hätte ihn nicht – dieses wunderbare Kind, das mich an meine Grenzen bringt und mir zeigt, was Liebe aushalten und bewirken kann. Er und seine Schwester sind das Wertvollste in meinem Leben, keinen von beiden und auch meinen Mann möchte ich jemals missen müssen.
Also – was hat es denn nun verändert?
Ganz schön viel.
Damit sind wir beim Titel dieses Buches:
„Ein autistisches Kind auf seinem Weg zu begleiten, ist auch eine Reise zu sich selbst.“
Elternbefragung
Nun interessierte mich aber brennend, was andere Eltern darauf antworten. Und daher fragte ich sie: „Hast du dich verändert, seit du ein autistisches Kind hast?“
Eine Mutter schreibt, sie habe „zig Ratgeber in Sachen Erziehung gelesen, war voll vorbereitet, hatte tausend Vorstellungen und Pläne und konnte nach der Geburt alles in die Tonne werfen, musste mich auf mich selber verlassen und fühlte mich von da an verlassen.“
Bei manchen ist es direkt von Geburt des Kindes an so, bei anderen stellt sich diese Erkenntnis nach und nach ein. Aus den vielen Antworten, die mich erreichten, lese ich aber eines immer wieder heraus: alles ist anders – darauf ist man nicht vorbereitet – und erstmal fühlt man sich ganz allein.
Aus diesem Gefühl des Alleinseins und gleichzeitig Verantwortung tragen müssen ergeben sich je nach Typ und Lebensumständen unterschiedliche Entwicklungen. Manche werden sofort aktiv und stürzen sich in die neue Aufgabe, andere fühlen sich zunächst wie gelähmt und wieder andere wollen es einfach nicht wahr haben.
„Ich bin zum Oberlöwen mutiert, zum Gehirn meines Kindes, die Umstände lassen es nicht zu, eine leise geduldsame Mama zu sein“, schreibt eine Mutter.
Aktionismus gibt das Gefühl, ein Stück Kontrolle zurück zu erhalten. Das ständige sich kümmern müssen führt unter anderem dazu, dass Enttäuschungen nicht ausbleiben. Man verlässt sich auf Menschen, die Auskunft geben, helfen, zurückrufen, vermitteln oder unterstützen wollten, aber am Ende ist man doch häufig auf sich allein, bestenfalls auf seine Familie und seinen Partner, angewiesen. Dazu kommt der ständige Kampf mit Ämtern und Krankenkassen und Diskussionen mit Ärzten, Therapeuten und Pädagogen.
Diese immer wiederkehrenden A...