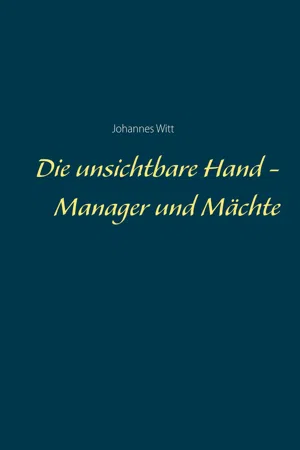![]()
Fusion mit NYSE Euronext 2011
Ich war am 9. Februar 2011 am späten Nachmittag gerade unterwegs zu einer Veranstaltung der Commerzbank mit dem Titel „Bank der Zukunft“ in der Innenstadt von Frankfurt und wollte mich im Anschluss mit dem von mir seit Jahren geschätzten Makler und Urgestein des Finanzplatzes, Rainer Roubal, im Lokal „Zum Bitburger“ treffen.
Rainer Roubal
Bis 2003 war Roubal für die Makler im AR der Deutschen Börse, wo er neben mir saß. Er war früher Kursmakler an der Frankfurter Wertpapierbörse, einer Lizenz zum Gelddrucken, wie es in Frankfurter Kreisen hieß. Als diese von der Hessischen Börsenaufsicht abgeschafft wurden, gründete er zusammen mit Kollegen die Wertpapierhandelsbank ICF, bei der er zunächst Vorstandsvorsitzender war und nun im Aufsichtsrat vertreten ist.
Wir trafen uns nach seinem Abgang im AR der Deutschen Börse weiterhin in unregelmäßigen Abständen, meistens im „Bitburger“ mit noch ein paar Bekannten von ihm. Und es waren immer fröhliche Abende.
Ich saß gerade im Saal und lauschte einer Präsentation, als das Handy klingelte. Ein Pressevertreter teilte mir mit, dass es eine Eilmeldung gab: Fusionsverhandlungen zwischen Deutscher Börse und NYSE Euronext. Was ich dazu sagen wollte. Ich war wie elektrisiert und versuchte, da ich ja nicht mehr im Büro war, über Kollegen weitere Informationen einzuholen, was mir aber nicht gelang. Stattdessen gab es weitere Anrufe, an eine fortgesetzte Teilnahme an der Veranstaltung war nun nicht mehr zu denken.
Ich machte mich deshalb gleich auf zum „Bitburger“, ein auch von Maklern gern frequentiertes Lokal in der Nähe des Opernplatzes, um Roubal und Kollegen zu treffen. Er war bereits über die neueste Nachricht informiert und las mir über sein Blackberry die eingehenden Nachrichten vor. Irgendwann wandten wir uns von der Flut der Meldungen ab und anderen Themen zu, es wurde wie immer ein feuchtfröhlicher Abend, gewürzt mit vielen „Hermännsche“, einem köstlichen Quittenschnaps.
Am Nebentisch saß, wie sich im Laufe des Abends herausstellte, ein Redakteur des Hessischen Rundfunks, der mit seinem Vater speiste und dem ich vorgestellt wurde, was sich noch als nützlich herausstellen sollte.
Am nächsten Morgen ging ich erst gar nicht an meinen normalen Arbeitsplatz im Büro, sondern begab mich direkt in eines der Betriebsratsbüros. Die zahlreichen, bereits am Vorabend aufgelaufenen Telefonanfragen wollten beantwortet werden. Meine Stellungnahme zu dem Vorhaben war unmissverständlich. Der Tenor war, dass die Deutsche Börse damit unter amerikanische Kontrolle und Vorherrschaft geraten würde und vom Finanzplatz Frankfurt nicht mehr viel übrig bliebe.
Die von mir abgegebenen Statements, die inhaltlich variierten, aber im Kern eindeutig waren, wurden umgehend in der Öffentlichkeit kommuniziert und fanden in entsprechenden Zitaten von mir ihren Niederschlag. Das führte zu intensiven Nachfragen anderer Medien. Das wiederum bot mir Gelegenheit, in leicht abgewandelter Form das Zitierte zu wiederholen und vor allem zu ergänzen, was die Spirale erneut in Gang setzte. Daher kam ich den ganzen Tag nicht dazu, das Büro zu verlassen. Für die Presse war das wieder ein großes Thema. Der erste footprint von seiten des Betriebsrats jedenfalls war gesetzt.
Die FAZ gab in ihrer Ausgabe vom 10.2.2011 Äußerungen Prominenter aus Frankfurt zu dem Paukenschlag wider. Die Oberbürgermeisterin Petra Roth zeigte sich nach einem Gespräch mit Francioni optimistisch. Er habe ihr dargelegt, dass der Finanzplatz durch die Fusion gestärkt werde. Auch Börsenratsmitglied Friedrich von Metzler blies in das gleiche Horn: „Die Fusion schafft die größte Börse der Welt und ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen im zunehmend härteren Wettbewerb“.
Die Börsenzeitung vom 12.2.2011 fragte in einem Kommentar bereits vorsichtiger nach Garantien, die es für die diversen Aktivitäten der Deutschen Börse geben würde. Sie hielt die vom CEO der NYSE Euronext, Niederauer, und Francioni verfolgte Absicht, die AR-Mitglieder in der Sitzung am darauffolgenden Dienstag vor vollendete Tatsachen zu stellen, für bedenklich. Sie warnte vor Missmanagement durch Europaunerfahrene Manager amerikanischer Muttergesellschaften.
Der Spiegel wies in seiner Ausgabe vom 14.2.2011 darauf hin, dass sich 2008 schon einmal eine Hochzeit angebahnt hatte unter dem Codenamen Rudolf. Die aktuellen Fusionspläne hätten nun zwar einen anderen Namen - „Gamma“ - ansonsten aber wirkten sie nach Meinung des Spiegel, als hätte man das Papier aus dem Jahr 2008 einfach wieder aus der Schublade geholt.
In einem Artikel der Frankfurter Neue Presse vom 14.2.2011 wurden einige meiner Kommentare wiedergegeben. Ein gern von mir gern benutztes Bild war: „Es bringt ja nichts, zwei Fußkranke zusammenzutun, um zu versuchen, daraus einen Gehenden zu machen“. Das war eines der von vielen Medien aufgegriffenen Statements, das auch keine Empfindlichkeiten bei Behinderten tangierte und damit Anlass zur Kritik geboten hätte.
Ich sprach davon, dass es anschließend nur Verlierer geben würde: „Die Musik spielt dann in New York“. Ich verwies auch unter Hinweis auf vorangegangene Fusionsversuche, dass es sich im Nachhinein jedes Mal gezeigt habe, dass es gut gewesen sei, dass es nicht zu den entsprechenden Vorhaben gekommen war. Weiter: „Die Deutsche Börse sollte nicht ihre Schlagkraft und Reaktionsfähigkeit der nächsten Jahre in dieser Fusion aufbrauchen. Das ist verlorene Zeit, die wir eigentlich am Markt brauchen, und kostet obendrein noch viel Geld.“
Wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Fusionsabsichten fand am 15.2.2011 eine turnusmäßige AR-Sitzung statt, in der den Mitgliedern zum ersten Mal offiziell das Vorhaben vorgestellt wurde. Der Präsentation lag eine rund tausendseitige Ausarbeitung eines Memorandum of Understanding zugrunde - sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Offensichtlich, dass dieses Konvolut nicht über Nacht erstellt werden konnte, sondern einer wochenlangen Vorbereitungszeit bedurfte. Das durchzuarbeiten war den Mitgliedern des Aufsichtsrats in der zur Verfügung stehenden Zeit schlicht unmöglich.
Unter den zahlreichen Beratern, die präsentierten, befand sich auch von der Deutschen Bank Stephan Leithner, der zum 1.7.2018 in den Vorstand der Deutschen Börse berufen werden sollte. Trotz der erdrückenden Materialfülle beschloss der Aufsichtsrat mehrheitlich, den vom Vorstand eingeschlagenen Weg der angestrebten Fusion gutzuheißen und weiter zu betreiben. So wurde das dann auch im Anschluss verlautbart.
Wie sich später durch darauf bezugnehmende Gerichtsverfahren herausstellen sollte, waren einige Anteilseignervertreter des AR über den AR-Vorsitzenden einige Wochen zuvor bereits über die Fusionspläne eingeweiht worden, u.a. anlässlich des Neujahrsempfangs am 24.1.2011.
Die Bildzeitung gab meine Meinung am 17.2.2011 wieder: „Dieser Zusammenschluss geht zulasten der Mitarbeiter. Vor allem die 1000 Kollegen der IT sind gefährdet. Das beschworene Gleichgewicht zwischen den beiden Unternehmen wird nicht lange Bestand haben.“
Der hessische Ministerpräsident Bouffier gab währenddessen seine Meinung kund, dass der Zeitpunkt für die Fusion günstig gewählt sei, weil die Deutsche Börse gut dastehe. Man habe es hier mit einer Partnerschaft zu tun.
Hessens Wirtschaftsminister Posch versprach wenigstens in der Welt vom 17.2.2011, sich „jenseits der rein aufsichtsrechtlichen Prüfung für die Interessen des Finanzplatzes Frankfurt einzusetzen“.
Nach der grundsätzlichen Einigung der beiden Unternehmen auf eine Fusion mehrten sich bereits die skeptischen Stimmen. Die Bafin tat kund, sie warte erst einmal die Angebotsunterlagen ab. Die EU-Wettbewerbshüter warteten ebenfalls auf nähere Informationen und beschieden: „Die Hochzeit kann nicht erfolgen, bevor sie unseren Segen bekommen hat“. (Handelsblatt vom 17.2.2011).
Während die Chefs beider Börsen, Francioni und Niederauer, gebetsmühlenartig versicherten, es handle sich um eine Fusion gleichwertiger Partner, teilte ich meine Ansicht der Frankfurter Neuen Presse in ihrer Ausgabe vom 17.2.2011 deutlich mit: „Am Ende wird einer das Übergewicht haben – und die Befürchtung ist, dass das doch New York sein wird.“ Als Begründung lieferte ich mit, dass Niederauer als Vorstandschef das operative Geschäft steuere und die Aktionärsstruktur jetzt schon mehrheitlich angloamerikanisch geprägt sei.
Die deutschen Aktiengesellschaften fürchteten infolge der Fusion eine Ausdehnung des Einflussbereichs der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC. Gerade, wenn das bisherige Handelssystem Xetra durch eine Handelsplattform der Amerikaner ersetzt werden sollte. Im Handelsblatt vom 22.2.2011 wurde darüber berichtet, dass „die US-Gerichte und Behörden eine außerordentlich extensive Haltung für die Anwendung amerikanischen Rechts entwickelt haben.“
Sorge bereitete auch, dass die Machtverhältnisse im Verwaltungsrat des neuen Konstrukts nur bis 2016 festgezurrt waren. Danach sollte das Gremium von insgesamt 17 auf 12 Mitglieder verkleinert werden. Die zunächst dem größeren Gewicht der Deutschen Börse geschuldete Mehrheit der Sitze von 10 zu sieben würde dann einer Parität von sechs zu sechs weichen.
Auf die Frage, wer die Topposition einnehmen sollte, zitierte mich die FTD (22.2.2011): „Witt will lieber noch nicht darüber nachdenken, welcher Chef in Zukunft zum Zug kommt. Ein Erfahrungswert, wie er sagt. Im Jahr 2000, als die Deutsche Börse mit der LSE fusionieren wollte, waren bereits Schilder für den neuen CEO angebracht. Der hatte uns schon die Hand geschüttelt, der rote Teppich war ausgerollt, sagte Witt. Und am Ende wurde dann doch alles wieder abgeblasen.“
Die FTD widmete dem Thema schließlich am 28.2.2011 einen ausführlichen Report unter der Überschrift: „Die Entmachtung der Deutschen Börse.“ Darin wurde ein pessimistisches Szenario für die Zukunft der Deutschen Börse gezeichnet, mit Abschaffung des Handelssystems Xetra und einem Vorstandsvorsitzenden, der in New York sitzen würde.
Der Reportage ging ein ausführliches Treffen der Redakteurin in den Räumen des Betriebsrats der Deutschen Börse in Eschborn voraus. In einem Gespräch mit mir wurde auch auf mein Äußeres eingegangen: „Er ist grau geworden bei der Deutschen Börse, seit 20 Jahren ist er im Unternehmen.“
In Bezug auf das 425-jährige Jubiläum, das letztes Jahr gefeiert wurde, sagte ich: „Unsere Börse hat eine lange Historie, und nun sieht es so aus, als würde sie binnen kurzer Zeit kaputt gemacht. Es kann sein, dass unsere Kinder nicht mehr wissen werden, dass es hier in Frankfurt mal eine bedeutende Börse gegeben hat.“
Und weiter, als die Amtszeit von Seifert beleuchtet wurde: „Es gab schon in diesen Zeiten viele Umwälzungen, aber man konnte eine Strategie dahinter entdecken. Es ging um Bündelung, darum, den Finanzplatz zu stärken.“ Nach der Ablösung Seiferts durch Francioni ging nach meinen Worten jedoch der rote Faden in den Strategien verloren. Es gäbe vom Management auf die Herausforderungen des Marktes nur zwei Antworten: Eisern sparen und prestigeträchtig zukaufen.
Der für die Hessische Börsenaufsicht zuständige Wirtschaftsminister Posch machte nochmals unmissverständlich deutlich, dass man sich die Details des Fusionsvertrages genau ansehen werde. „Unser Ziel ist es, dass der Börsenhandel in Frankfurt durch eine mögliche Fusion nicht geschwächt wird, sondern sogar gestärkt daraus hervorgeht“, sagte Posch gemäß FTD vom 3.3.2011.
Die Börsenzeitung begrüßte in einem Kommentar, dass sich Posch nicht unter Zeitdruck setzen lassen will und erinnerte daran, mit welcher Eile der ehemalige CEO der französischen Börse Euronext die Übernahme des Pariser Börsenbetreibers durch die NYSE in 2006 durchgepeitscht hatte. Alle zuständigen Gremien winkten den Deal danach durch, ohne sich der für den Finanzplatz Paris schwerwiegenden Konsequenz - nämlich des darauf folgenden Absturzes in die Bedeutungslosigkeit - bewusst zu sein.
Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger lehnte währenddessen die geplante Fusion ab. Laut Frankfurter Neue Presse vom 4.3.2011 befürchtete die Schutzgemeinschaft, dass die Deutsche Börse auf mittlere Sicht von den Amerikanern dominiert würde. Die Gefahr sei groß, dass es den Deutschen ergehe wie dem französischen Konkurrenten Euronext, die sich Ende 2006 auf eine Fusion unter Gleichen mit der NYSE einließen und später zur bloßen Filiale der Amerikaner verkommen sei.
Und Frankfurt würde die Kernkompetenz an die Amerikaner abtreten: Die Entwicklungshoheit über die elektronischen Handelssysteme. Deutsche Aktien würden nicht mehr über die heimische Xetra-Plattform, sondern über das US-Pendant laufen.
Im Manager-Magazin (4/2011) wurde ein Weggefährte zitiert, der sich Gedanken über die möglichen persönlichen Beweggründe von Francioni machte: „Viele in Frankfurt werfen Francioni den Ausverkauf des Finanzplatzes vor. Nicht zuletzt verfolge er mit dem Deal persönliche Vorteile, heißt es. Im Grunde versüßt er sich seinen Ritt in den Sonnenuntergang, die Aufgaben des Chairmans sind überschaubar, und das Gehalt ist nicht zu verachten.“
Tatsächlich sollte Francioni Chairman des Boards werden, mit Büroleiter und einem Stab von ca 20 Mitarbeitern, wie aus den Unterlagen hervorging. Das operative Geschäft in der Ebene würde dagegen dem CEO, Niederauer, obliegen.
Die Börsenzeitung erinnerte in einem Beitrag vom 5.3.2011 an viele zuvor gescheiterte Anläufe der Deutschen Börse: „Die paneuropäische Blue-Chip-Plattform mit London 1998, iX-Fusionsprojekt im Jahr 2000, Übernahmeversuch der London Stock Exchange 2005 oder Zusammengehen mit Euronext 2006 – alles Vorhaben, über deren Scheitern man heute noch froh sein muss, weil sie zu einer Schwächung des Finanzplatzes Frankfurt geführt hätten“. Und fragte berechtigterweise zum Schluss: „Warum ist es diesmal anders?“
Die Süddeutsche Zeitung ging die Problematik von einer anderen Warte an. Sie erinnerte in ihrem Beitrag vom 23.3.2011 daran, wie viele deutsche Konzerne bereits in den USA scheiterten und ihre Hoffnungen begraben mussten. „Der American Dream ist für viele Unternehmer jedoch zum Albtraum geworden. Erst die Euphorie, dann die Ernüchterung, schließlich das Ende.“ Daimler, Deutsche Post, Adidas, Siemens - sie alle hatten Milliardenverluste zu verkraften.
Nach dem mittlerweile erfolgreichen Votum der New Yorker Aktionäre und der Zustimmung der Aktionäre der Deutschen Börse zum Umtausch ihrer Aktien im Sommer 2011 gab es die Befürchtung, dass in Frankfurt nur noch eine „kleine“ Aktiengesellschaft mit reduzierten Aufsichtsrats- und Vorstandsgremien und vor allem weniger Befugnissen verbleiben würde.
Die nachfolgenden Wochen und Monate waren geprägt durch Recherchen und dem Suchen nach Verbündeten, um das gepl...