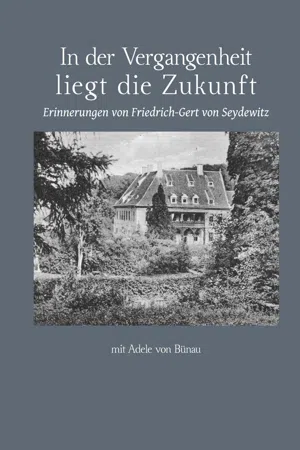![]()
Gabriele (1940-2006)
zusammengetragen,erinnert und erzählt von Astrid v. Massow
Ihre Großeltern
Gabrieles Großvater väterlicherseits, Joachim v. Massow (1872-1915†), Königlich Preußischer Hauptmann und Kompaniechef, war in erster Ehe mit Bernhardine v. Brandenstein verheiratet, die 1910 verstarb und den dreijährigen Sohn Jürgen hinterließ. 1911 heiratete Joachim die erst neunzehnjährige Auguste v. Graevenitz (1892-1961 ), eine Cousine seiner ersten Frau. Zwei Kinder wurden geboren: Gabrieles Vater Hans-Joachim (1912-1944†) und Ingeborg (1914-2010). Der Großvater fiel 1915 und hinterließ drei Kinder, ein Schicksal, das sich ähnlich bei Gabrieles Vater wiederholen sollte.
Gabrieles Großvater mütterlicherseits, Curt v. Burgsdorff (1886-1962), promovierter Verwaltungsjurist, heiratete 1914 Hertha, geb. v. Erdmannsdorff (1 889-1956). Zwei Kinder wurden geboren: Henning (1915-1998) und Ilse (1917-2006), Gabrieles Mutter.
Ihre Eltern
Gabrieles Mutter Ilse, geboren in Dresden, besuchte aufgrund der Versetzungen ihres Vaters Schulen in Bad Elster/Vogtland, in Dresden-Neustadt sowie in Löbau/Oberlausitz. 1932 kam sie ins Freiadlige Magdalenenstift in Altenburg/Thüringen, das schon ihre Mutter sowie viele sächsische Verwandte besucht hatten. Am Ende ihrer Schulzeit haben sie sich auf der Tür-Innenseite ihres Schrankes verewigt, was noch in den 1980er Jahren zu entdecken war.
Ilse beendete 1934 die Schulzeit mit der Mittleren Reife, besuchte 1935/36 die Haushaltsschule und Kurse in der Dresdner Handelsschule. Dort lernte sie das Schreibmaschineschreiben und die Stenographie, bevor sie den halbjährigen Reichsarbeitsdienst im Erzgebirge zu absolvieren hatte.
Gabrieles Vater Hans-Joachim, geboren in Berlin, begann nach Abitur, Arbeitsdienst und vorbereitenden Wehrsport-Lehrgängen 1934 seine Offizierslaufbahn in Allenstein/Ostpreußen. 1935 kam er auf die Kriegsschule in Dresden, wo er Gabrieles Mutter auf einem Tanzfest kennenlernte. Unter dem Vorwand, Ilse würde eine Freundin besuchen (ihre zukünftige Schwägerin), fuhren beide 1936 zu den Olympischen Spielen in Berlin. Nach dem Umzug der Burgsdorffs nach Leipzig 1937 heirateten Hans-Joachim und Ilse am 19. Oktober 1938 in der Nikolaikirche.
Zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung war Hans-Joachim in Rastenburg/Ostpreußen stationiert. Dort wohnte das junge Paar nur kurze Zeit, bevor Hans-Joachim im März 1939, nun zum Oberleutnant befördert, zum Infanterie-Lehrregiment, das spätere Regiment „Großdeutschland“, nach Döberitz bei Berlin versetzt wurde. Das Ehepaar bezog dort eine Wohnung.
![]()
Gabrieles
Am 1 . September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Zur Vorbereitung des Frankreich-Feldzugs wurde Hans-Joachim nach Montabaur versetzt. Wegen der zu befürchtenden unruhigen Zeiten schickte er seine junge Frau zu ihren Eltern nach Prag. Die Döberitzer Wohnung wurde untervermietet.
Curt v. Burgsdorff war im April 1939 Verwaltungsjurist Unterstaatssekretär im Reichsprotektorat von Böhmen und Mähren geworden. Gabriele Hertha Auguste v. Massow ist am 3. August 1940 in Prag geboren. Die Familie wohnte auf dem Hradschin, dem Prager Burgberg. Wenn Gabriele als kleines Mädchen vor die Tür trat, nahmen die Wachsoldaten Haltung an und salutierten.
Im Herbst 1940 wurde Hans-Joachim im Frankreich-Feldzug leicht verwundet. Er kam ins Klosterlazarett Mallersdorf, nicht weit von Gabrieles letztem Wohnort Unterlaichling entfernt. 1941 erlitt ihr Vater seine zweite Verwundung. Nach einem Lazarett-Aufenthalt wurde er als Taktiklehrer an die Infanterieschule Döberitz versetzt. Die inzwischen dreiköpfige Familie kehrte in die Döberitzer Wohnung zurück.
Zwei Wochen, bevor am 10. Mai 1943 Hans-Henning im nahen Potsdam geboren wurde, musste der Vater wieder an die Front: Sein Regiment wurde nun an der Ostfront eingesetzt. Wenig später bestimmte Goebbels, dass Frauen und Kinder ohne männlichen Schutz Berlin und Umgebung zu verlassen hätten. Ilse kehrte deshalb zurück zu ihren Eltern nach Prag.
Gabriele mit Hans-Henning (links) und 1 943 in Prag (rechts).
die Geschwister in Schwaiganger im Oktober 1 946.
Großvater Curt v. Burgsdorff hatte inzwischen, 55-jährig, seine Freigabe zur Wehrmacht durchgesetzt, da er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, unter seinem neuen Chef Reinhard Heydrich zu arbeiten. Dieser war, nach der Beurlaubung Konstantin Freiherr v. Neuraths als Reichsprotektor, zum stellvertretenden Reichsprotektor ernannt worden, wohl um die zunehmende tschechische Widerstandsbewegung zu unterdrücken. 1942 war Curt v.B. an der Ostfront, 1943 an der Front in Italien. Im Dezember 1943 wurde er zum Gouverneur des Distrikts Krakau im Generalgouvernement ernannt, nachdem er sich Reichsführer Himmler gegenüber zunächst persönlich geweigert habe, aus der Wehrmacht auszuscheiden, wie er selbst berichtete. Er fürchtete, in die Polen- und Judenpolitik verstrickt zu werden, gegen die er grundsätzliche Einwände hatte.
Im April und Mai des Jahres 1944 kam Hans-Joachim v. Massow noch einmal nach Berlin, um dort an einem Stabslehrgang teilzunehmen. Anschließend trat er seine vermeintlich sicherste Stelle als Divisionsadjutant im Osten an. Am 23. Juli 1944 fiel er. Posthum wurde er zum Oberstleutnant befördert, vermutlich, nachdem sein Vorgesetzter erfahren hatte, dass die Witwe ein drittes Kind erwartete. Sogar das Grabkreuz wurde ausgetauscht. Seine Tochter Astrid kam am 31. Dezember 1944 in Prag zur Welt. Gabriele konnte sich als einziges der drei Kinder wohl noch an „Väterchen“ erinnern.
Anfang November 1944 standen die Russen bereits 80 km vor Prag. Ilse v. Massow, die ihr drittes Kind erwartete, bemühte sich beim Adjutanten ihres gefallenen Mannes in Döberitz darum, dass ihre dortige Wohnung, die für ungarische Flüchtlinge requiriert worden war, wieder geräumt würde, damit sie mit ihren Kindern und einer Säuglingsschwester dort einziehen könne. Doch dieser Wunsch wurde abgelehnt, und sie musste weiter in Prag ausharren und abwarten, was geschah. Ihre Mutter Hertha v.B. wurde ihr in dieser Zeit und in den Folgejahren zur wichtigsten Stütze.
Im März 1945 bekamen alle reichdeutschen Familien, die keinen männlichen Schutz in Prag hatten, einen Ausweisungsbefehl. Die Frauen zögerten, denn Astrid war noch keine drei Monate alt. Als jedoch mit dem Entzug der Lebensmittelkarten gedroht wurde, entschlossen sie sich, die Stadt zu verlassen – kaum mehr als drei Wochen vor dem „Prager Aufstand“: „Die Reise“, wie Gabriele es damals sah, „begann am 10. April 1945 hinten auf einem Lkw, der Stoffballen nach Rosenheim bringen sollte. Wir – meine Großmutter Hertha v. Burgsdorff, meine Mutter Ilse v. Massow und wir drei Kinder – tuckerten drei Tage und zwei Nächte durchs Land und wuschen uns am Straßenrand im Bach. Dank des Holzgasantriebes war es warm auf der überdachten Ladefläche, und klettern und rutschen konnte man auf den Stoffballen auch. An der tschechisch-niederbayrischen Grenze durfte ich die Pässe herausreichen. Als der junge Grenzer jedoch mit einem – für bayerische Verhältnisse zackigen – ,Heil Hitler! ‘ an den Wagen trat, erhielt er von mir fast Fünfjährigen eine Abfuhr: ,Mit Heil Hitler grüßt man nicht! ‘, wies ich ihn zurecht, denn so hatte ich es schließlich gelernt.“
Schwaiganger
Die Familie kam zunächst bei einem Dachdecker-Ehepaar am Chiemsee unter. Nach weiteren zwei Wochen und Vermittlung des Großvaters konnte sie in zwei Zimmer im Umfeld des Bayrischen Staatsgestüts Schwaiganger bei Murnau ziehen. Im größeren Zimmer wurde gewohnt, gespielt und auf einem Zweiplattenherd gekocht – auch die Wäsche, die anschließend über dem Kohleofen getrocknet wurde. Hier schliefen die Großmutter und vermutlich auch Astrid als Baby, während die Mutter mit den beiden Großen im zweiten Zimmer, einem fensterlosen Raum, schlief, der so feucht war, dass im Winter das Eis an der Wand glitzerte. Aber es gab einen Balkon, gerade groß genug für den Kinderwagen oder eine Zinkwanne, in der zwei Kinder sitzend planschen konnten.
Die Folge war, dass Astrid so gut wie nie im Dorf ausgefahren wurde, was bei manchen den Verdacht erweckte, sie wäre wohl nicht „vorzeigbar“. Ein Verdacht, der dadurch noch verstärkt wurde, dass Astrid als wenige Monate altes Kleinkind wegen Unterernährung ins Krankenhaus kam, wo sie eine Bluttransfusion ihrer Großmutter benötigte.
Ilse v. Massow mit ihren Kindern Hans-Henning, Astrid und Gabriele, mit ihren Eltern und ihrem Bruder Henning im Sommer 1 949.
„Die Zeit in Schwaiganger war anfangs nicht einfach für uns“, erzählte Gabriele weiter: „Dort kannte man Adel nur in Verbindung mit dem bayrischen Königshaus. Evangelische waren restlos unbekannt, und dann auch noch ,preußische‘ Flüchtlinge – das war suspekt, und das bekam die Familie auch zu spüren.“ Das Verhältnis zu den Einheimischen besserte sich aber bald dank des bescheidenen Auftretens der Familie und der Einsatzbereitschaft von Mutter Ilse. Mit einfachsten Arbeiten begann sie, die Familie zu ernähren. Sie putzte in der Kantine für unverheiratete Land- und Waldarbeiter, nähte und füllte Wachstuchtierchen zum Verkauf und strickte Männer-Pullover mit Rollkragen für 9 Mark das Stück. Das muss ihr die Freude an dieser Handarbeit verleidet haben: Nie wieder sah man sie später stricken.
Ilse schälte auch täglich einen Zentner Kartoffeln, wusch sie, kochte sie und drehte sie für den Bäcker durch, der sie zu Brot verbuk. Als Waldarbeiterin pflanzte sie Bäume an und betreute einen Pflanzgarten. Als junge Frau war Ilse eigentlich dazu erzogen worden, scheu den Blick zu senken, wenn ein Mann sie ansah. Jetzt aber zog sie mit den strammen bayrischen Waldarbeitern los, um neue Schonungen anzulegen. Manchmal erlaubte sich einer der Männer einen Spaß und versteckte sich hinter einem Baum, um dort wie eine Wildsau zu brüllen, um Ilse einen Schreck einzujagen. Im Übrigen hatten die Männer sicher Respekt vor der hart arbeitenden jungen Witwe. Großmutter Hertha, „Omti“, kümmerte sich derweil um die Kinder und sammelte auch mit ihnen Brennholz im Wald. Für Fallholz war das erlaubt, wobei Omti gelegentlich auch mit dem Beil nachhalf. Dieses war im Kinderwagen gut versteckt.
In Schwaiganger hatte die Familie nicht viel zu essen. Aber da Ilse im Gasthof immer tüchtig mit anpackte, war sie bald sehr beliebt, deshalb durfte sie sich öfter mal einen dicken Kanten Brot einstecken für die Kinder. Die liefen auch in die Gärtnerei und riefen keck: „Herr Obermaier, schenkst uns a gelbe Ruam?“ Wenn sie Glück hatten, durften sie sich dann eine Möhre ziehen. Sie durften auch Beeren pflückten, aber eigentlich nur für den direkten Verzehr. Ins Töpfchen unter der Schürze pflückten sie für zu Hause, was dem Gärtner sicher nicht entgangen ist.
Gabriele wurde 1946 in Ohlstadt eingeschult. Drei Kilometer ging sie bei Wind und Wetter zu Fuß zur Schule. Deshalb und da die Wohnverhältnisse in Schwaiganger sehr beengt waren, wurden die Mädchen zwischenzeitlich ausquartiert: Gabriele wohnte eine Zeit lang bei Familie Wolf, einem entfernten Vetter ihres Vaters, in Bethel, Astrid bei Tante Inge Burkhart, der Schwester ihres Vaters, und ihrer Großmutter („Omuttchen“) in Hannover.
Nach der Währungsreform 1948 arbeitete Mutter Ilse auch eine Zeit lang als ungelernte Arbeiterin in einer Buchbinderei auf Schloss Rieden, hinter Murnau am Staffelsee. 50 Pfennige verdiente sie dort in der Stunde, 18 km Fußmarsch hin und zurück, zumeist barfuß, nahm sie dafür in Kauf. Das einzige Paar Schuhe zog sie erst kurz vor dem Ziel an.
Tutzing
1949 kehrte Großvater Curt ( „Opa“) aus polnischer Gefangenschaft zurück. Die Gefangenschaft sowie die überaus schwierigen Jahre seit 1933 hätte Curt v.B. wohl kaum ertragen können ohne die Kraft, die ihm sein tiefer christlicher Glauben verlieh. In Tutzing wurde er als Verwaltungsleiter der Ev. Akademie eingesetzt, die 1947 vom damaligen Landesbischof Hans Meiser gegründet worden war. Er war auch im Tutzinger Kirchenvorstand und wurde bald wieder sehr aktiv in der Sächsischen Genossenschaft des Johanniter-Ordens. Die Großeltern lasen jeden Morgen die Herrnhuter Losungen und gingen regelmäßig in den Gottesdienst.
In der Akademie gab es auch eine Dienstwohnung für den Verwaltungsleiter. Die Großeltern waren nun in der Lage, die Kinder bei sich aufzunehmen. So waren die Geschwister wieder vereint, die Schulwege waren kurz, und rund um das Schloss, das die Akademie beherbergte, ließ sich herrlich spielen. Da aber auch in Tutzing der Platz nicht für alle ausreichte, behielt Mutter Ilse ihren Wohnsitz noch in Schwaiganger. Sie arbeitete weiter auf Schloss Rieden und half gelegentlich im Büro der Tutzinger Akademie aus. Für neun Monate konnte sie als Vertreterin der erkrankten Hausschwester arbeiten und war so ihren Kindern näher.
Neben dem Verwaltungsleiter hatten auch zwei Pfarrersfamilien Dienstwohnungen in der Akademie. Mit deren Kindern spielten Gabriele und ihre kleinen Geschwister im Wirtschaftshof, im Schlosspark und am See. Am Samstagabend wurden sie mit einem Stück Seife an den See geschickt zur großen Körperpflege. Zwei Diakonissen arbeiteten im Haus. Die eine betreute die Küche, die andere die übrigen hauswirtschaftlichen Bereiche. Bei der Küchen-Schwester lohnte sich ein Besuch: Häufig hatte sie bei Tagungsbetrieb für die Kinder einen Pudding übrig oder ein kleines Stückchen Kuchen. Da die Zeiten weiterhin mager waren, hatten solche Freuden umso größere Bedeutung.
1951 kam Gabriele in Tutzing aufs Gymnasium. Da sie jedoch von Geburt an ein Hüft-Leiden hatte, wurde eines Tages eine Operation nötig. Gabriele verpasste dadurch viel Schulunterricht, weshalb man ihr anschließend die Möglichkeit gab, auf Frauenchiemsee für ein Jahr ein Internat zu besuchen. Für sie war das eine wundervolle Zeit. Schnell war sie wieder recht gut zu Fuß und fühlte sich gesund. Die unterschiedliche Beinlänge machte dennoch lebenslang einen Ausgleich beim Schuhwerk nötig. Gabriele lernte im Internat Französisch, was ihr später oft zugutekam. In den 50er Jahren verbrachte sie erstmalig ihre Sommerferien in Besançon in Frankreich. Ihr Großvater kannte dort eine Familie, bei der sie bleiben konnte. Ein Aufenthalt bei einer Genfer Familie folgte. Für sie müssen das unglaublich schöne Erlebnisse gewesen sein. Sie baute ihr Schul-Französisch aus und konnte bald recht flüssig sprechen. Französisch war dann für Gabriele das ganze Leben lang eine große Hilfe. Im Tutzinger Gymnasium war sie im Französischen immer die Beste.
Starnberg
Nach der Pensionierung von Gabrieles Großvater zogen die Massows und die Burgsdorffs 1952 in ein neugebautes Mietshaus in Starnberg, Kaiser-Wilhelm-Str. 1 – die ersten eigenen Wohnungen seit 1945. Der Bahnhof war nah, was besonders für Gabriele und später auch für Astrid vorteilhaft war, da sie täglich zwölf Minuten nach Tutzing zur Schule fuhren. Die Großeltern hatten die Wohnung im ersten Aufgang, zweite Etage rechts und die Massows im zweiten Aufgang, zweite Etage links. Die Wand zwischen den Drei-Zimmer-Wohnungen wurde durchbrochen, sodass man vom jeweiligen „dritten Zimmer“ aus in die andere Wohnung gehen konnte. Im Wohnzimmer stand ein Kachelofen mit einer regulierbaren Gitteröffnung zum Kinderzimmer, während das „dritte Zimmer“ nur durch die offene Tür zum Flur hin Wärme abbekam. Hier bekam Gabriele ihr eigenes kleines Reich, das vom Durchgang zur großelterlichen Wohnung durch die beiden „Regenschränke“ (s.u.) mit einem Vorhang dazwischen abgeteilt war. Mutter Ilse schlief im Wohnzimmer. Das Kinderzimmer teilten sich Hans-Henning und Astrid. Hier wurde auch gegessen und gespielt. Das „dritte Zimmer“ der Großeltern diente als Gästezimmer. Besonders häufig wurde es von Ilses Bruder Henning genutzt, der in München arbeitete.
In diesem Mietshaus lebten 18 andere Kinder in jedem Alter, mit denen die Massows wunderbar spielen konnten. Aus dem Gerümpel, das von den Bauarbeiten draußen überall herumlag, bauten die Kinder unter...