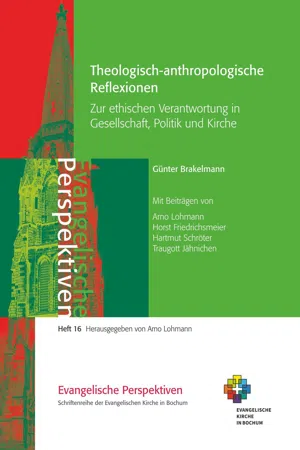![]()
Übersicht
Reflexionen I. und Reflexionen II.
- Theologisch-anthropologische und ethische Reflexionen zur Politik und Geschichte
- Wenn der Zivilist Krieger wird
- Die Macht der Lüge
- Der bezeugte Gott und die selbst gemachten Götzen der Menschen
- Ein kaum ausrottbarer Irrtum
- Utopien und die Realitäten in der Geschichte
- Das Denken im Komparativ gegen irreale politische Ziele
- Ein Friedensgebet
- Historisch-politische Reflexionen
- Reaktion und Fortschritt im 19. Jahrhundert
- Die „Revolution“ von 1918 und das Dritte Reich
- Der zweite Weltkrieg und die Kapitulation
- Der Aufbau eines demokratischen Rechts- und Sozialstaates
- Die Widersprüche in den gegenwärtigen Lebensauffassungen
- Die Priorität des Militärischen in der Außenpolitik
- Die Schwäche der UNO
- Die Leistung der Überwindung des „Kalten Krieges“ und die deutsche Einigung
- Der neue Aufrüstungsschub
- Das Problem des Waffenexportes
- Der Kampf gegen den Terrorismus
- Die Lage im Nahen Osten
- Die permanente Diffamierung Russlands und seines Präsidenten
- Die Erfolge des Zueinanders von Sicherheitspolitik und Friedenspolitik
- Die Notwendigkeit differenzierter Wahrnahme des Gegners und die Notwendigkeit des Dialoges mit ihm
- Entfaltung einer Politik aus Vernunft und Humanität
- Die Rolle von Utopien angesichts der „alten Welt“
![]()
Günter Brakelmann
I. Theologisch-anthropologische und ethische Reflexionen zur Politik und Geschichte
1. Wenn der Zivilist Krieger wird
Kurt Marti sagt: „Alle bildlichen Darstellungen Gottes, die ich kenne, stimmen erstaunlicherweise in einem Punkt überein: immer ist Gott Zivilist, nie trägt er Uniform.“
Man könnte hinzusetzen: genau so ist es mit Bildern von Jesus. Dieser Urzivilist ist von uniformierten und dekorierten römischen Soldaten mit Zustimmung der jüdischen oberen Religionsorgane und auf das Verlangen jüdischen Volkes gekreuzigt worden.
Das Geschäft der uniformierten Soldaten war in der Weltgeschichte immer das gleiche: sie bereiteten sich auf Kasernenhöfen und auf See- und Landmanövern auf den Ernstfall vor: das Töten derer, die von der politischen Führung als die Feinde erklärt worden waren. Sie fragten in der Regel nicht nach den genaueren politischen und moralischen Gründen für den Einsatzbefehl, sondern befolgten blind die Befehle von oben. Befehlsverweigerung ist die seltene Ausnahme. Da die Soldaten den Status einer den Obrigkeiten untergeordneten Berufsgruppe hatten, waren sie durch einen Eid verpflichtet, den obersten Befehlshabern Folge zu leisten. Eine eigene Gewissensprüfung war ausgeschaltet. Sie gehorchten – ohne Widerrede. Sie finden sich – auch wenn sie die blutigen Realitäten des Krieges kannten – ohne inneren Widerstand mit dem unterschiedslosen Töten von Menschen, mit dem Zerstören der zivilisatorischen und kulturellen Infrastrukturen, mit dem Plündern und Ausrauben fremden Gutes, mit dem Foltern von Gefangenen und mit dem Vergewaltigen von Frauen ohne Gewissensbisse ab. Gegen diese bisher in jedem Krieg losgelassene Soldateska gibt es kaum ein Aufhalten. Der sich selbst radikalisierende Krieg gehört zum Wesen des Krieges. Und etlichen Offizieren und Soldaten macht es schließlich sogar Spaß, Menschen zu töten und Dörfer und Städte zu zerstören. Die immer vorhandenen dunklen Seiten der conditio humana können sich vor allem in Kriegszeiten ungehemmt entfalten. Der Jagdflieger jubelt, wenn er ein feindliches Flugzeug abgeschossen hat und es auf der Erde mit seinem feindlichen Flieger zerschellen sieht. Der Bomberpilot freut sich, wenn seine Bomben die Ziele getroffen haben. Dass da Menschen zerrissen und Häuser zerstört werden, daran denkt er kaum. Er vollzieht auftragsgemäß sein Kriegshandwerk.
Und sog. Einsatzkommandos hatten keine Hemmungen, Dörfer und Bauernhäuser anzustecken und ihre Bewohner zu liquidieren. Sie vollzogen eine Notwendigkeit im Ausrottungskrieg.
Wenn der Zivilist in Uniform gesteckt wird, zeigt der sonst Vernunftbegabte und moralisch Sensible seine anderen Möglichkeiten. Als Krieger wird er der andere Mensch, der Antimensch. Er vernichtet sich selbst als homo sapiens. Die pathetischen Beschwörungen des Dienstes an Volk, Vaterland und Staat geben ihm auch als praktizierendem Untermenschen ein gutes Gewissen. Die Pervertierung ist perfekt.
2. Die Macht der Lüge
Sie ist die Großmacht zwischen den Menschen, die das Privileg haben, eine Sprache zu besitzen, mit der sie ihr Selbstverständnis, ihre Gefühle, Wünsche und Ziele ausdrücken können. Aber was sie am besten mit ihrer Sprachfähigkeit in bestimmten Lagen inszenieren, ist das Lügen. Sowohl ihre pathetischen Selbstinterpretationen wie die diffamierenden Urteile über Menschen, die anders sind als sie, sind Lügengebäude, die sie als Schutzwälle um sich legen. Sich selbst immer als die besseren Menschen zu interpretieren, ist die normale Alltagslüge. Die Pfeile ihrer Lügen treffen ohne Unterschied den oder die, die vor ihrem biologischen Tod das moralische, unbarmherzige Todesverdikt treffen soll. Andere zum Abschuss reif zu machen, andere zum Inbegriff des Untermenschentums zu stilisieren, um sie mit eigenem guten Gewissen aus der Geschichte liquidieren zu können, – das ist die Methode der Weltmacht Lüge. Die politische Weltgeschichte als Machtgeschichte hat mit ihren gezielten Lügen die realen Katastrophen vorbereitet.
Einfach und eingängig sind die Charakterisierungen:
- Die Demokraten sind …
- Die Liberalen sind …
- Die Sozialisten sind …
- Die Kommunisten sind …
- Die Kapitalisten sind …
- Die Juden sind …
- Die Rassen sind …
- Die Reichen sind …
- Die Klassen sind …
- Die Völker sind …
- Die Regierungen sind …
Die einfachen Urteile und die mit der Geste von Wahrheit verkündigten Urteile machen Regierungen, Parteien und einzelne Menschen bereit, den unausweichlichen „heiligen Krieg“ vorzubereiten und ihn schließlich als Vernichtungskrieg zu führen. Die zuvor verbreiteten Halbwahrheiten und Lügen können den Krieg als einen „gerechten Krieg“ proklamieren. Im Namen der eigenen moralischen und kulturellen Überlegenheit kann man den Vernichtungsapparat gezielt in Gang setzen. Der überwiegenden Gefolgschaft der eigenen Nation darf man sich gewiss sein, wenn man gekonnt lügt. – Zur Illustration: was haben vor den und in den zwei Weltkriegen die nationalen Presseorgane, die politologischen, die philosophischen und theologischen Broschüren und Bücher in ihren Analysen der feindlichen Nationen an Halbrichtigem, an Unsinnigem und Gelogenem behauptet! –
Die Lügen haben bisher in allen Kriegen zur Kriegsbereitschaft der Nationen ihren Beitrag geleistet. Ein Kranz von perfekten Lügen hat die weltgeschichtlichen Katastrophen vorbereitet und hat die Kriege in ihrem Vollzug zu totalen Kriegen mit dem Ziel der Vernichtung der Feinde gemacht. Politisch-moralische und intellektuelle Verantwortung scheinen keine Chancen gegen die Lügengeflechte gehabt zu haben.
3. Der bezeugte Gott und die selbst gemachten Götzen der Menschen
Nach Sprache und Inhalt gehört die Erklärung des 1. Gebotes „Du sollst nicht andere Götter haben“ zu den aufregendsten Auslegungen Martin Luthers. Er geht aus von dem Satz: „Woran Du Dein Herz hängst und verlässt Dich darauf, das ist eigentlich Dein Gott.“ Zwei Beispiele greift er anfangs heraus. Dem einen ist der Mammon sein Gott, das sich kumulierende Geld und der sich vergrößernde Besitz: „Das ist der verbreitetste Abgott auf Erden …. Das ist eine Eigenart der menschlichen Natur; die ihr anhaftet bis in die Gruben …“
Der andere Gott ist das Vertrauen „auf große Gelehrsamkeit, Klugheit, Macht, Einfluss, Beziehungen und öffentliches Ansehen.“ Man hängt sein Herz an Geld und an Herrschaftspositionen in der politischen und kulturellen Gesellschaftsordnung. Schnell ist zu erkennen, „wie die Welt allenthalben falschen Gottesdienst und Abgötterei betreibt. Denn es ist bislang kein Volk so verkommen gewesen, dass es nicht irgendeine Form von Gottesdienst aufgerichtet und gehalten hätte. Da hat jedermann das zum besonderen Gott erhoben, wovon es für sich Gutes, Hilfe und Trost erwartet hat.“
Man macht Gott zu einem, zu seinem eigenen Götzen. In ihn trägt man ein, was man selbst will und erwartet.
Und in der Tat: Die Weltgeschichte vor und nach Luther ist die große reale Illustration dieser Wahrheiten über den Menschen mit seiner Selbstliebe und mit seiner Selbstverherrlichung. Seit das Geld als Tauschmittel erfunden ist, gibt es die Gier nach ihm, um zu Besitz zu kommen. Die Bereitschaft zur Vermehrung von Geld und Besitz ist tendenziell unendlich. Dieser natürliche Trieb frisst die Seele und die Moral auf. Er macht den Menschen zu einem Akteur, für den alles auf der Welt und alle Menschen zu Instrumenten seiner Reichtumsvermehrung gemacht werden. Geldherrschaft begründet Herrschaft über Menschen, sie führt zur Ausbeutung und zur Rechtlosigkeit der Dienstklassen. Die Konkurrenz unter den Mammonisten bringt eine Akkumulation des Kapitals in wenigen Händen und macht die Vielen abhängig und arm. Der Frühkapitalismus zur Zeit Luthers zerschlug die traditionelle Bedarfswirtschaft, er machte die Geldwirtschaft zum Kern des ökonomischen und sozialen Lebens. Sie ließ die Reichen immer reicher werden, sie machte den Land besitzenden Adel und die städtischen Produzenten zu ihren abhängigen Kunden. Das aufkommende Banksystem mit seiner Zinspraxis regierte und dirigierte schließlich das gesamte private und öffentliche Leben. Verbunden mit diesem epochalen Wechsel des Wirtschaftssystems war die Abnahme traditioneller Religiosität, für die Gott der Herr über die gesamte Schöpfung und über die Gewissen der an ihn glaubenden Menschen war. Die neuen weltlichen Herren folgten den Eigengesetzlichkeiten der ökonomischen Gesetze, die sich durch göttlichen Schöpfungs- und Ordnungswillen nicht stören ließen. Wer die Zinsen für das geliehene Geld nicht aufbringen konnte, verlor Hab und Gut und damit seine Existenz. Die Geldgeber wurden durch die Pleite etlicher die großen Immobilienbesitzer.
Der Vorrang der Geldbesitzer setzte sich auch um in die Praxis, dass sie die traditionellen Fürsten und übrigen Herren durch die Finanzierung ihrer Lebenslagen und ihrer ökonomischen Ziele in ihre Abhängigkeit brachten. Dadurch gewannen sie Einfluss auf deren praktische Politik. Die Fugger und andere „Handels- und Geldhäuser“ regierten das Reich und seine Fürstentümer entscheidend mit. Und so ist es Jahrhunderte lang geblieben. Die reale neuzeitliche Geschichte ist nicht ohne den Einfluss der geldlichen Interessen der das Kapital besitzenden Bankhäuser zu schreiben. Der so schlicht anmutende Satz: „Geld regiert die Welt“ dürfte diesen Tatbestand richtig wiedergeben.
Der Realist Luther wusste genau, dass bei der praktischen Gestaltung der ökonomischen Entwicklung zum frühkapitalistischen System der christlich verstandene Gott oder gar die Gewissens- und Verantwortungsethik der Botschaft Jesu kaum eine Chance hatten, den Geist in diesem System mitzubestimmen. Die immanente Sachlogik eines auf Geld und seine Vermehrung basierenden Gesellschaftssystems ließ kaum eine Durchbrechung der ehernen Entwicklungsgesetze des Ökonomischen durch andere personal- und sozialethische Entscheidungen zu, es sei denn zum Preis ökonomischer Verluste. Und auch die Fürsten und die anderen politisch Verantwortlichen standen unter den Zwängen des ökonomischen Vorrangs, dem sie sich um des Erhalts ihrer politischen Herrschaft willen beugen mussten.
Luther kannte genau die menschenverachtende und die mitmenschliche Verantwortung tötende Praxis der kalten ökonomischen Herren. Wie kein anderer hat er in seinen Schriften das frühkapitalistische System und seine Träger durchschaut und kritisiert. Entscheidend war für ihn, dass er dieses System mit der Instrumentalisierung und Degradierung des Menschen zum homo oeconomicus verantwortlich machte für das Absterben des in der Bibel bezeugten Gottes. Die Praktiker des Systems fragten nicht mehr nach dem Willen Gottes, der in seinen 10 Geboten die menschenfreundliche Ordnung anbot und schon gar nicht fragten sie nach dem Geist der Menschenliebe des Bergpredigers, sondern praktizierten die rationale, interessengeleitete Logik ihres selbst entwickelten Systems, das mit seinen immanenten Gesetzmäßigkeiten die Entscheidungen bestimmte. Luther hat die Entwicklung dieser Säkularisierung eines entscheidenden Sektors seiner Lebenswelt klar gesehen. Er sah die Tendenz, dass der weltliche Akteur nicht mehr sein Vertrauen auf den in der Schrift bezeugten Gott setzte, sondern sich als selbstbewussten Exekutor seiner weltlichen Interessen verstand. Er machte sich selbst zum Weltgestalter, er bedurfte nicht mehr einer Einrede von außen. Sie konnte nur sein Geschäft stören. Er übernahm die alte Ordnungsfunktion Gottes und machte sich selbst zum Gestalter der Welt, wie er sie haben wollte. Er lieferte sich damit seelisch-geistig an sich selbst aus und baute eine ihm genehme Welt mit den von ihm gesetzten Spielregeln auf. Der Mensch ohne Gott und der Mensch gegen Gott stehen am Ende des Prozesses der Selbstermächtigung und Selbstbestimmung. Genau das aber bedeutet für Luther der Tod seiner Menschlichkeit und seiner Mitmenschlichkeit. Dieser Tod tritt mit eherner Konsequenz dann ein, wenn der Mensch sich gewissensmäßig und in seinem realen Leben löst von den Bindungen an die Gebote Gottes und sich in seinem Geist nicht mehr von der neutestamentlichen Verkündigung leiten lässt.
In der Tat: zwei große Linien machen das Dilemma der Jahrhunderte nach Luther aus. Zunächst verzichtete man nicht auf den Namen Gott. Man verstand ihn als den großen Weltenlenker und den großen Weltenrichter, der von seinem Himmelsthron aus seinen Weltwillen auf der Erde durchsetzen ließ. Politische Herrscher verstanden sich als die von ihm berufenen Exekutoren seines Willens, wenn sie Kriege begannen und Länder eroberten. Es gab keine Kriege, die man nicht im Namen Gottes führte. „Mit Gott für König und Vaterland“ war die fromme Parole. Und die offiziellen Proklamationen, Predigten und Gebete der Kirchen waren die religiösen Bestätigungen des politischen Herrscherwillens. Sie beteten für den Sieg der eigenen Waffen über die am Kriege schuldigen Feinde. Die Friedensbotschaft Jesu hatte ihr Moratorium. Sie spielte keine entscheidende Rolle für öffentliche christlich-patriotische Reden der Kirche. Übrig blieb eine „Theologie“ ohne „Christologie“.
Schließlich kam es im 20. Jahrhundert zur Entwicklung von Ideologien, die der traditionellen Religionswelt den bewussten Abschied gaben: der Bolschewismus und der Nationalsozialismus. Sie argumentierten von einem konsequenten Klassenstandpunkt oder von einer rassenbiologischen Grundposition her. Für sie wurde der Krieg ein geschichtsnotwendiges Mittel, um ihre Ziele, die kommunistische oder die arische Weltherrschaft zu errichten. Sie wollten den endgültigen Sieg einer Welt ohne den Gott der Orthodoxen und ohne den Gott der abendländischen Tradition. Die realgeschichtliche Konsequenz: das Töten und Abschlachten von Millionen von Menschen und das Zerstören von traditioneller Zivilisation und Kultur, um auf ihren Trümmern die neue Welt mit neuen Menschen und neuen gesellschaftlichen Strukturen zu schaffen.
Luther hat vierhundert Jahre zuvor diese Welt ohne den biblischen Gott heraufziehen gesehen. Er ahnte und wusste, dass eine Welt mit Menschen, die sich in ihren Gewissen nicht mehr gebunden wissen an die Gebote des Schöpfergottes und...