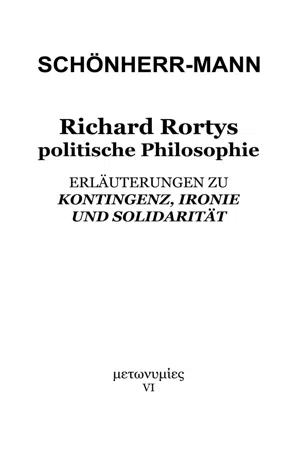
eBook - ePub
Richard Rortys politische Philosophie
Erläuterungen zu 'Kontingenz, Ironie und Solidarität'
- 200 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Richard Rortys politische Philosophie
Erläuterungen zu 'Kontingenz, Ironie und Solidarität'
Über dieses Buch
Der folgende Text führt in Richard Rortys politikphilosophisches Hauptwerk Kontingenz, Ironie und Solidarität aus dem Jahr 1989 ein und kommentiert es Kapitel für Kapitel. Dabei geht es sowohl um die Zusammenhänge, die Rorty selber herstellt, als auch um jene, die sich in der politischen Philosophie anbieten. Rorty situiert seine liberale Utopie zwischen Habermas und Foucault. Doch er nimmt die politische Wende der postmodernen Philosophie noch nicht wahr, so dass er Perspektiven der Solidarität eher am Universalismus und am Kommunitarismus orientiert, von denen ihn jedoch sein Kontingenzbewusstsein trennt.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Richard Rortys politische Philosophie von Hans-Martin Schönherr-Mann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy History & Theory. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
ÜBER DEN ERSTEN TEIL
DIE KONTINGENZ VON
GESELLSCHAFTEN ALS ABSCHIED VON HISTORISCHEN
NOTWENDIGKEITEN
Auch vor diesem Hintergrund avanciert Kontingenz, Solidarität und Utopie zu Rortys politikphilosophischem Hauptwerk, nicht zuletzt auch deshalb weil er darin systematisch unterschiedliche politisch relevante Thematiken entfaltet.
So hebt das Buch im ersten von drei Teilen mit dem Problem der Kontingenz an und behandelt in ebenfalls drei Kapiteln die Sprache, das Selbst und das Gemeinwesen, also Probleme der theoretischen wie der praktischen Philosophie bzw. damit theoretische Grundlagen der praktischen Philosophie. Das entspricht durchaus dem Aufbau der klassischen wie der modernen politischen Philosophie, wenn man dem Staat eine bestimmte Anthropologie oder Wissenschaftslehre zu Grunde legt, die sowohl bei Aristoteles als auch bei Hobbes gleichfalls eine sprachliche Dimension besitzt. Bei Rorty zieht sie freilich nicht notwendige, sondern zufällige Konsequenzen nach sich. Denn die Sprache ist weder göttlich gegeben, noch hat sie eine logische, rationale oder kommunikative Struktur, die dem Selbst Halt verleihen würde oder das Gemeinwesen in eine notwendige Tradition oder einen historischen Fortschritt einreihen.
Der zweite Teil, der ebenfalls wie auch der dritte wieder in sich dreigeteilt ist (lässt die Trinität grüßen?), trennt Politik von der Philosophie ab, die Rorty in den Bereich privater Lebensführung verschiebt und damit natürlich viel weiter als Rawls geht. Dabei setzt er sich vor allem mit der postmodernen Philosophie auseinander, die ja gerade seit den frühen achtziger Jahren Furore machte und von Linken, Marxisten, Vertretern der analytischen Philosophie wie auch von liberalen Fortschrittsfreunden vehement bekämpft wurde, weil sie deren Konzepte von Wahrheit, Fortschritt und ethischem Universalismus offenbar so wohlbegründet in Frage stellte, dass diese sich von dieser Erschütterung bis heute nicht mehr erholten. Umso aggressiver müssen sie sich noch heute gegen die Postmoderne zur Wehr setzen. Dem folgt Rorty nicht und darf daher als einer der ersten angesehen werden, der aus dem Lager der Gegner stammend der Postmoderne doch eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Zwar kommt er den Gegnern der Postmoderne entgegen, indem er die postmoderne Philosophie, die 1989 noch kaum als politische Philosophie wahrgenommen wurde, in den Bereich der Ästhetik und Kulturphilosophie abschiebt, um ihr damit einen unpolitischen Charakter zu attestieren. Adorno hätte widersprochen, aber diesem schenkt Rorty nur wenig Beachtung.
Zwar kann die postmoderne Philosophie durchaus dazu herhalten, die private Lebensführung zu ironisieren, doch sie formuliert zu viele skeptische und somit verunsichernde Ansprüche, die für Rorty politisch gefährlich werden können und vor denen man sich daher jedenfalls politisch hüten sollte. Skepsis gegenüber der liberalen politischen Ordnung könnte deren engagierte Verteidigung schwächen: Das ist die Ferne zwischen Pragmatismus und Postmoderne, was auf einem groben Missverständnis Rortys beruht. Wenn aber die postmoderne politische Philosophie aus ihren Einsichten – der Relativismus eignet beiden, ob sie es gerne hören oder nicht, ist er schlichte Realität – pragmatische politische Konsequenzen zieht, sind sich beide wieder sehr nah.
Im Privatleben dagegen hilft nach Rorty der einzelnen die philosophische Skepsis wie die Einsicht in die Kontingenz, eine gewisse Distanz gegenüber Essentialismen zu wahren, um das Leben eher ironisch als tragisch zu verstehen. Gerade fromme Menschen lehnen jede Leichtigkeit des Seins und einen spielerischen Umgang mit dem Leben ab. Wie schreibt doch Gabriel Marcel am 8. März 1929: „Nur auf Grund einer Illusion, durch Anschluss an eine pragmatische Wissenschaft, welche sich die Wirklichkeit durch ihre Bestrebungen zurechtmacht, glaubt man, ins rein Theaterhafte zu entkommen. (. . .) Das Wort entfremden gibt genau das wieder, was ich sagen will. ‚Ich bin nicht im Theater„, - diese Worte werde ich mir jeden Tag wiederholen.“33 Marcels Worte, die gegen Sartre gerichtet sind, treffen selbstredend auch Rorty, der schließlich die westlich kapitalistische Lebensart deshalb schätzt, weil sie eine gewisse Leichtigkeit des Seins ermöglicht, die nicht nur Milan Kundera als unerträgliche disqualifiziert. Ein weitreichendes Schuldbewusstsein, ob als christliche Sünde oder als ökologischer Raubbau erscheint nicht unbedingt als Rortys Sache.
Ähnlich dramatisch ernst nimmt Rorty höchstens die Politik, wiewohl sie ob ihrer Kontingenz keine notwendigen Entwicklungen erlebt. Denn sie hat zwar ihren ernsten, moralischen Kern, nämlich die Vermeidung von Grausamkeit als oberstes Postulat, das Rorty bei Judith Shklar lernt. Doch dieses Prinzip wird in der Politik kaum und in den Religionen noch erheblich weniger geachtet. So schreibt Shklar 1984: „Grausamkeit mehr als jedes andere Übel zu hassen, bedeutet eine radikale Ablehnung sowohl religiöser als auch politischer Konventionen. (. . .) Grausamkeit an erste Stelle zu setzen, ist dabei nicht allein durch Zweifel an der Religion motiviert, sondern hat ihren Grund in der Erkenntnis, dass sich die Gepflogenheiten der Gläubigen in ihrer Brutalität nicht von denen der Ungläubigen unterscheiden (. . .). Grausamkeit an erste Stelle zu setzen, bedeutet daher nicht nur mit der Religion, sondern auch mit der geläufigen Politik in Widerspruch zu stehen.“34 Denn Grausamkeit ist fast nirgendwo völlig geächtet, es sei denn als individueller Akt, wie die Politik der Abschreckung demonstriert, sei sie militärischer oder juristischer Art. Was bedeutet zudem die Rede vom Kollateralschaden anderes, als Grausamkeit militärisch in Kauf zu nehmen. Selbst liberale demokratische Staaten, die mit militärischem Engagements sparsam umgehen, können sie nicht vermeiden. Auch der administrative, besonders der polizeiliche Umgang mit den Zeitgenossinnen gerät leicht auf derartige Abwege.
Zudem hat Politik ein Ziel, nämlich die Solidarität, die Rorty mit den Linken verbindet, die er jedoch anders als Marx entwickelt. Mit beiden Begriffen – „Grausamkeit und Solidarität“ – überschreibt Rorty den dritten Teil von Kontingenz, Ironie und Solidarität, der sich damit als Höhepunkt seiner politischen Philosophie präsentiert und als Antwort auf Rawls‘ A Theory of Justice, als Anschluss an dessen Political Liberalism und als Abgrenzung gegenüber den Libertarians und den Kommunitarians.
33 Gabriel Marcel, Sein und Haben (1935), 2. Aufl. Paderborn 1968, 22
34 Judith Shklar, Ganz normale Laster (1984), Berlin 2014, 16, 17
ZUM ERSTEN KAPITEL
SPRACHEN DER KONTINGENZ
Das erste Kapitel erscheint als theoretische bzw. sprachphilosophische Grundlage der weiteren Argumentation des Buches, wie man es häufig in der politischen Philosophie vorfindet. Doch der Titel „Die Kontingenz der Sprache“, der auf den ersten Blick eine solche Aussicht nahelegt, lässt beim zweiten schon eine gewisse Ambivalenz erahnen: Kann nämlich Kontingenz überhaupt als eine Grundlage taugen? Für Etatisten nicht.
Und genau darum geht es Rorty, der sich mit gegensätzlichen Philosophien konfrontiert sieht. Auf der einen Seite Dewey, Rawls und Habermas, die die Bürgerin in die Gesellschaft integriert sehen und ihr Argumente anbieten, diese Sachlage zu akzeptieren und die sich daraufhin engagiert in die Gesellschaft einbringen soll. Auf der anderen Seite stehen Nietzsche, Foucault und Derrida, denen es in Rortys Verständnis darum geht, dass das Individuum sein eigenes Leben selber gestaltet, ohne dabei auf die Gesellschaft Rücksicht nehmen zu müssen. Das ist zumindest insoweit zutreffend, wie die postmoderne politische Philosophie als Genealogie der Emanzipationsbewegungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts gelesen werden kann, die in die Zivilgesellschaft münden, aber dadurch gegen Rorty doch einen politischen Charakter gewinnen. Obendrein trifft der Solipsismus-Vorwurf die postmoderne Philosophie nicht. Ihr ethischer Ideengeber ist Emmanuel Lévinas, der das Individuum durch den Anderen in die Verantwortung gerufen sieht. An Lévinas schließt Derrida an. Foucault schreibt die antike Logik weiter, nach der das Individuum sich selbst regieren muss, um mit anderen zusammenleben zu können. Lyotard folgt der Sprachphilosophie Wittgensteins, der Privatsprachen nicht als Sprache anerkennt.
Gemäß der philosophischen Tradition handelt es sich bei Postmoderne und analytischer Philosophie um miteinander unvereinbare Positionen, so dass demjenigen, der sich damit konfrontiert sieht, nichts anderes bleibt, als sich der einen oder der anderen Philosophie anzuschließen. Doch genau das lehnt Rorty ab, aber nicht weil er beide Positionen für falsch hielte, sondern weil er beide als durchaus richtig anerkennt.
Wie kann man sich widersprechende theoretische Auffassungen gleichzeitig für richtig halten? Damit distanziert sich Rorty natürlich von den jeweiligen Philosophen, die ihre eigene Theorie für richtig und die konkurrierende für falsch halten und zwar in dem Sinn, dass ihre eigene Theorie dem vorliegenden Sachverhalt entspricht, die andere nicht. Habermas geht davon aus, dass Sprache originär eine kommunikative Struktur besitzt, die Vernunft und Logik beherbergt. Im Sinn von Nietzsche drückt sich dagegen in der Sprache der Wille zur Macht aus und im Sinn von Foucault hat der Diskurs keine generell integrierende, sondern immer auch eine desintegrierende Funktion. Rawls wiederum begründet universelle sittliche Prinzipien, die sich mit Derrida, wenn man genau hinsieht, in der Buchstäblichkeit der Schrift auflösen, indem sie nämlich, je genauer man hinschaut, immer weiter in Aporien geraten, denen man nicht entkommt. Dadurch verunsichert sich jegliches Verständnis, was nach Rorty in der Politik nicht angeht, während man im privaten Leben solche Spiele spielen darf. Sokrates führt in Widersprüche, Platon löst sie auf.
Trotzdem in gewisser Hinsicht parallel zu Derrida lässt Rorty die traditionelle philosophische Auffassung auf, dass Theorien mit der Welt oder der Wirklichkeit übereinstimmen müssen, also wahr oder falsch sind. Nicht, dass es die Welt nur im Kopf der Zeitgenossinnen gäbe oder dass sie durch deren Sprache, deren Bewusstsein oder Geist überhaupt erst erzeugt würde. Für Rorty bleibt die Welt als äußerliche durchaus bestehen, und zwar derart unabhängig von der Erkenntnis, dass diese in der Welt ihre eigene Wahrheit nicht rückzuversichern vermag. Denn alle Theorien, ob philosophische, sozial- oder naturwissenschaftliche, spiegeln nicht diese äußere Welt, erfassen mit ihren Sätzen nicht bestimmte vorliegende Sachverhalte, mit denen sie übereinstimmen müssten.
Wenn nach Nietzsche Gott tot ist, was für Rorty heißt, „dass wir keinen höheren Zwecken dienen“ (KIS 47), ähnlich wie es Vattimo sieht, dann gibt es auch keine Garantie mehr dafür, dass Sprache und äußere Welt in irgendeiner Weise miteinander übereinstimmen, dass die Sprache die Welt so erfasst, wie sie wirklich ist. Die Voraussetzung dazu wäre nämlich, „dass die Welt sich selbst, aus eigenem Antrieb, in satzförmige Stücke namens ‚Tatsachen„ aufteilt.“ (KIS 24) Daher hat Wahrheit in dieser äußeren Welt kein Kriterium, sondern Wahrheit ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den Sätzen, die sie behaupten, bzw. aus den jeweiligen Sprachen heraus, in denen diese Sätze eine Rolle spielen.
Folglich kann keine Sprache von sich behaupten, sie würde die Welt adäquat ausdrücken, denn dafür fehlt ihr wiederum ein Kriterium, was für die christliche Scholastik Gott gewährleistete, der den Menschen eine solche Sprache und eine solche Vernunft gegeben hatte, die die von ihm geschaffene Welt richtig erfasst. So wurde ein Kriterium überflüssig.
Wenn man heute in den Wissenschaften mit einem solchen Argument nicht mehr operieren kann, dann folgt indes daraus nicht, dass die Sprache sich als Endprodukt einer langen historischen Entwicklung begreifen lässt, die jetzt an einem Punkt angelangt sei, wo sie die äußere Welt endlich richtig erfasst. Irgendwie hat das jede Generation gedacht. So bemerkt Rorty, „dass Newtons Vokabular uns zwar Vorhersagen über die Welt leichter macht als das des Aristoteles, dass das aber nicht bedeutet, dass die Welt Newtonisch spricht.“ (KIS 25). Rorty folgt somit weder der weit verbreiteten Korrespondenztheorie. Bertrand Russell schreibt 1912, „dass die Wahrheit oder Falschheit einer Meinung immer von etwas abhängt, das außerhalb der Meinung selber liegt. Wenn ich glaube, dass Karl I. auf dem Schafott starb, dann ist das nicht deshalb wahr, weil mein Glaube irgendeine Eigenschaft an sich hätte, die man entdecken könnte, wenn man ihn vornimmt und genau untersucht. Mein Glaube ist deshalb wahr, weil dieses historische Ereignis vor zweieinhalb Jahrhunderten stattgefunden hat.“35
Genauso wenig folgt Rorty der Abbildtheorie, wie sie beispielsweise von Wittgenstein im Tractatus logico-philosophicus vertreten wird, für den ein Satz einen Sachverhalt in ähnlicher Weise spiegelt wie ein Bild dieses Sachverhalts. Denn erstens: „Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. Den Gegenständen entsprechen im Bilde die Elemente des Bildes. Die Elemente des Bildes vertreten im Bild die Gegenstände.“36 Und zweitens unterstellt Wittgenstein: „Was jedes Bild, welcher Form auch immer, mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie überhaupt – richtig oder falsch – abbilden zu können, ist die logische Form, das ist, die Form der Wirklichkeit.“37
Habermas dagegen vertritt die Auffassung: „Was wir für wahr halten, muss sich mit überzeugenden Gründen nicht nur in einem anderen Kontext, sondern in allen möglichen Kontexten, also jederzeit gegen jedermann verteidigen lassen. Davon lässt sich die Diskurstheorie der Wahrheit inspirieren: Eine Aussage ist wahr, wenn sie unter den anspruchsvollen Bedingungen eines rationalen Diskurses allen Entkräftigungsversuchen standhält.“38
Nach Rorty handelt es sich bei den verschiedenen Theorien um verschiedene Vokabulare, die es den Zeitgenossen erlauben, mit der Welt im jeweiligen Sinn erfolgreich umzugehen bzw. bestimmte Zwecke zu verfolgen. Die Welt schreibt den Zeitgenossen also nicht vor...
Inhaltsverzeichnis
- Über das Buch
- Über den Autor
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung Liberalismus und Populismus
- Kontingenz und politische Philosophie
- Auf dem ironischen Weg in die kontigente Solidarität
- Über den ersten Teil
- Über den zweiten Teil
- Über den dritten Teil
- Überblicke
- Literaturverzeichnis
- Personenregister
- Impressum