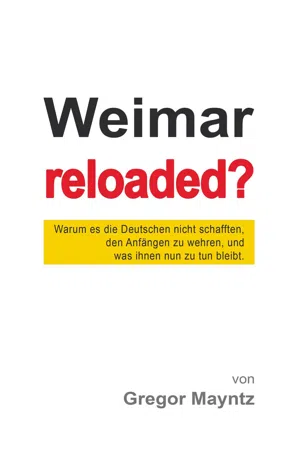![]()
1 • War Weimar nur schwach, ist Berlin nur stark?
Der Tweet findet binnen weniger Stunden weltweite Beachtung. Er kommt von @RaimundPretzel aus einer Berliner Schule. Der Junge hat mit seinem iPhone seine Schuhe auf auffällig rotem Grund fotografiert und dazu geschrieben: „Es geht nicht raus. Fünf Mal schrubben, aber das Blut bleibt. Scheiß #KrieginBerlin“. Das gepostete Bild zeigt die Umrisse einer Blutlache, aufgenommen im Klassenzimmer des jungen Raimund, genau unter seiner Bank. Der Unterricht hat zwar wieder begonnen. Aber an diesem Frühlingstag in der deutschen Hauptstadt sind die Spuren der schweren Kämpfe immer noch überall zu sehen. Regierungstreue Truppen quartierten sich in Raimunds Schule ein, weil die Aufständischen sich in der benachbarten Grundschule verschanzt hatten. Auch paramilitärische Truppen hatten sich an den Kämpfen beteiligt, die tagelang dauerten. Überall in der Stadt war geschossen worden. Die Krankenhäuser waren überfordert.
Selfie aus dem Bürgerkrieg
Das Netz ist voll von Bildern enthemmter Brutalität. Überall ziehen bewaffnete Gruppen durch die Republik, und immer wieder fragen sich die verängstigten Menschen, wer da gerade aus welchem Grund auf wen schießt. Ein Kommentar unter Raimunds Tweet besteht aus einem Bild und der Frage „Sollen wir tauschen?“ und den Worten „Scheiß #KrieginEssen“. Es zeigt eine Gruppe von Schülern, die ein Selfie vor dem Eingang ihrer Schule gemacht haben. Dahinter kümmern sich Sanitäter um Dutzende von Schwerstverwundeten. Vielen scheinen sie nicht mehr helfen zu können.
Die Zustände in diesem März in Deutschland sind unbeschreiblich. Revolutionäre Zellen und Antifagruppen haben zusammen mit Gewerkschaftlern und vielen einfachen Arbeitern Bundeswehrkasernen überfallen und riesige Mengen von Waffen und Munition erbeutet. Die gewaltbereiten Extremisten haben sich zu einer 50.000 Mann starken Truppe zusammengefunden und als „Rote Armee“ die Herrschaft in vielen Städten des Ruhrgebietes übernommen. Die Staatsgewalt hat die Kontrolle über das Land verloren. Dabei schien ein Putsch ultrarechter Militärs gerade noch einmal glimpflich abgelaufen zu sein. Von langer Hand vorbereitet und von einflussreichen Millionären systematisch unterstützt, indem sie ganze Söldnertruppen zum Schein beschäftigen, hatte am 13. März eine meuternde Militäreinheit das Regierungsviertel in Berlin besetzt und einen Direktor des Landschaftsverbandes zum neuen Bundeskanzler ausgerufen. Die komplette Bundesregierung hatte sich gerade eben noch mit ihren Limousinen nach Dresden in Sicherheit bringen können und war von dort mit Hubschraubern und Transportflugzeugen der Flugbereitschaft nach Stuttgart geflogen worden. Die ersten Parteien im Bundestag solidarisierten sich mit den Putschisten und rechneten sich Chancen aus, über ein diktatorisches Regime ihre Ziele durchsetzen zu können. Doch die Bürokratie stand zur Demokratie und verweigerte den Putschisten die Gefolgschaft. Auch ein von der gestürzten Regierung ausgerufener Generalstreik hatte dazu beigetragen. Als der gesamte Transport von Menschen und Waren, Teile der Stromversorgung, Fernsehen, Radio und Internet zum Erliegen gekommen waren, hatten die Putschisten von der äußersten Rechten aufgegeben. Doch damit gaben sich die Linksextremisten nicht zufrieden. Sie bezeichneten den Putsch als Beweis dafür, dass nur eine revolutionäre Niederringung des Kapitalismus den Faschismus endgültig besiegen könne. Nun halten die Gefechte schon viele Tage an. Von Dortmund aus machen von Freiwilligen unterstützte Bundeswehreinheiten in blutigen Kämpfen jedoch Fortschritte. Inzwischen werden bereits über 200 gefallenen Soldaten und mehr als tausend getötete Kommunisten gemeldet. Und es werden täglich mehr.
Diese Schilderung klingt ziemlich abgedreht. Von welchem März soll da die Rede sein? Etwa vom März 2016, als ein Teil der Regierungsparteien selbst von einer „Herrschaft des Unrechts“ sprach? Aber da blieb es – jenseits der Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte – weitgehend ruhig in der Republik. Oder ist es eine fiktive Beschreibung aus dem Jahr 2021? Nein, den Schüler, der auf die Blutlache unter seinem Pult schaut, gab es wirklich: Raimund Pretzel hieß er, und er schilderte unter seinem späteren Namen Sebastian Haffner, was er 1920 als Zwölfjähriger in Berlin erlebte, einschließlich Blutlache.37 Und auch die anderen Bestandteile der Schilderung folgen im Wesentlichen den Ereignissen von 1920, leicht transformiert in die aktuelle Zeit mit ihren gewandelten Instrumenten der Kommunikation und Fortbewegung. Nach dieser Einleitung haben wir vielleicht einen besseren Zugang zu der Frage, was in diesem Land los wäre, wenn rechtsextremistische Militärs die Macht übernähmen, die Regierung aus Berlin flüchtete, Zehntausende von Revolutionären das am dichtesten besiedelte Industriegebiet Deutschlands besetzten und der Bürgerkrieg täglich eine dreistellige Zahl von Todesopfern fordern würde. Bliebe in dieser liberalen Demokratie noch ein Stein auf dem anderen? Würde das System nicht scheitern, zumindest kurz vor dem Verlust aller Funktionen stehen?
Doch genau unter solchen Rahmenbedingungen begannen die Akteure den Aufbau der Demokratie in der Weimarer Republik. Sie trat im Grunde, wie der Historiker Hans Mommsen zusammenfasst, „in einer Phase des latenten Kriegszustands ins Leben“.38 Symptomatisch erscheint die anfängliche Relativierung ihrer Chancen schon am 9. November 1918 durch die doppelte Ausrufung der Republik: der sozialistischen durch Karl Liebknecht vom Berliner Stadtschloss und der demokratischen durch Philipp Scheidemann vom Reichstag aus. Das ganze Reich war voller Arbeiter- und Soldatenräte. Würde die parlamentarische Demokratie unter diesen Bedingungen überhaupt einen Fuß auf die Erde bekommen? Die blutigen Unruhen zogen sich bis März 1920 hin. Nach heutigen Verhältnissen eine unerträglich lange Zeit der ständigen Drohung, gleich wieder zu scheitern. Wenn wir die Weimarer Republik auf diese Weise einmal nicht vom Ende, sondern vom Anfang her denken, stellt sich sicherlich Hochachtung vor den Männern und Frauen ein, die dieses Chaos wieder in ein prosperierendes und beinahe friedliches Gemeinwesen verwandelten. Gut drei Jahre nach diesen aus heutiger Sicht geradezu apokalyptischen Gewaltausbrüchen hatten Staat, Gesellschaft und Wirtschaft so viel Aufbauarbeit geleistet, dass die viel gerühmten „Goldenen Zwanziger“ Verlauf nehmen konnten. Berlin und Deutschland wurden zum Synonym für Wirtschaftskraft, Erfindergeist und kulturelle Blüte. Weimar, das hätte auch zum Musterbeispiel für das Gelingen einer Demokratie selbst unter widrigsten Bedingungen werden können. Und zwar genau mit dieser Verfassung und ihren im richtigen Augenblick als Stabilisator genutzten Notverordnungen, mit genau diesen Strukturen in Verwaltung und Militär und nicht zuletzt mit dieser Gesellschaft, die in ihrer Mehrheit ohne Erfahrungen mit einer parlamentarischen Demokratie auf diese neue Staatsform setzte.
Goldene Zeiten aus dunkelsten Startbedingungen
In der Schilderung zu Beginn des Kapitels sind weitere Rahmenbedingungen noch gar nicht erwähnt, die die Hypothek für „Weimar“ geradezu dramatisch vergrößerten. Mental betraf dies die verbindliche Festlegung der Alliierten auf eine alleinige Verantwortung der Deutschen am Ausbruch des Weltkrieges. In dieser Verkürzung stand dies nicht erst im Widerspruch zu den Erkenntnissen späterer historischer Forschung; seinerzeit widersprach das besonders den noch frischen Erinnerungen der Erlebnisgeneration. Dies sorgte wiederholt für breiteste Empörung und innere Ablehnung aller damit zusammenhängenden internationalen Verträge. Die erniedrigenden Auflagen des Versailler Vertrages potenzierten diese Wirkung. Wirtschaftlich erschwerte das zunächst völlig ungeklärte Ausmaß von Demontagen und Reparationen die Arbeitsfähigkeit und Verlässlichkeit des politischen Systems. Gerade in einer zwar „verspäteten“39, aber umso überzeugteren Nation bildete die Abtrennung von Teilen des Reiches, die für die Versorgung der Menschen immens wichtig waren, und die über Jahre gehende militärische Besetzung und Übernahme des Kommandos durch Alliierte im Ruhrgebiet als industriellem Herz des Staates eine schwerwiegende Belastung und behinderte die Identifikation mit dem neuen System. Hinzu kam eine weitere Herausforderung für die unverhoffte, sozusagen um die historische Ecke gebogene parlamentarische Demokratie: Es galt, ein Millionenheer von heimkehrenden, teilweise körperlich schwer versehrten oder seelisch schwer traumatisierten Soldaten in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren. Der Historiker Wolfram Pyta verweist darauf, dass das Kaiserreich die Kriegsniederlage zu verantworten, aber die Republik die enormen Folgen zu bewältigen gehabt habe, und folgert daraus: „Unter dieser Last wäre auch manch etabliertes Staatswesen zerbrochen.“40 Und doch schaffte es die Weimarer Republik, aus diesen düstersten Rahmenbedingungen heraus Vertrauen zu gewinnen und eine große Schicht von „Vernunftrepublikanern“ in der bürgerlichen Mitte für sich zu vereinnahmen. Jedenfalls beschrieb der Historiker Friedrich Meinecke mit dieser Formulierung die Abwendung von der Monarchie und die gelungene Zuwendung zur Weimarer Demokratie bereits zweieinhalb Jahre nach den oben geschilderten Märzkämpfen.41
Schließlich sei ein weiterer Vergleich angeführt: Wie wäre die Entwicklung der Bundesrepublik verlaufen, wenn Konrad Adenauer als prägende Persönlichkeit bereits nach wenigen Jahren, also etwa mit 79 Jahren, gestorben wäre, und er wichtige Weichenstellungen nicht mehr hätte vornehmen können? Weimar musste auf seinen richtunggebenden Gründervater Friedrich Ebert bereits im Jahr 1925 schmerzlich verzichten; er wurde nur 54 Jahre alt. Und was wäre in Bonn und im Rest der Bundesrepublik geschehen, wenn 1950 der frühere Finanzminister und 1951 der Außenminister ermordet worden wären? In Weimar traf dies 1921 Matthias Erzberger und 1922 Walther Rathenau. Beide waren wichtige Stützen und Repräsentanten der jungen Republik.
Die über Jahrzehnte geübte Selbstgewissheit, wonach der Bundesrepublik das Schicksal Weimars mit Sicherheit erspart bleibe, wird unter anderem aus der Konstruktion des Grundgesetzes gezogen. Der Parlamentarische Rat habe von Anfang an die richtigen „Lehren aus Weimar“ gezogen und das Grundgesetz von allen Webfehlern der Weimarer Reichsverfassung befreit, lautet die Zusammenfassung vieler Befunde und Überzeugungen. Dieses Gefühl der verfassungsrechtlichen Überlegenheit der aktuellen Verfassung gegenüber der von Weimar hat kein Geringerer als der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio auf bemerkenswerte Weise erschüttert: „Wäre im August 1919 das deutsche Grundgesetz von 1949 in Kraft getreten, darf bezweifelt werden, ob die Republik auch nur bis zum Jahr 1924 gekommen wäre.“ Di Fabio gibt an dieser Stelle zur Begründung zu bedenken, dass dann nämlich ein Friedrich Ebert nicht „aus einem starken Amt heraus über die Reichswehr und das Notverordnungsrecht hätte verfügen können“.42 Daraus lässt sich im Umkehrschluss ableiten: Die Bundesrepublik mit ihrer Verfassung hätte im Angesicht einer den Weimarer Rahmenbedingungen ähnelnden Entwicklung möglicherweise weniger stabilisierende Rettungsmöglichkeiten. Ein Scheitern der Demokratie könnte somit – zumindest bezogen auf die angeblich widerstandsfähigeren verfassungsrechtlichen Bedingungen – noch schneller verlaufen. Davon gleich mehr.
Schauen wir zunächst noch einmal auf weitere Leistungsdaten der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie. Sie zeigen, dass die zeitgenössische Perspektive auf die vermeintlich dem Untergang geweihte Weimarer Republik andere Eindrücke liefert. Werfen wir etwa einen Blick auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) je Kopf, um zu erfahren, wie die Bürger selbst die wirtschaftliche Entwicklung erleben konnten: War für sie ein Scheitern als zwangsläufige Folge der Gegebenheiten absehbar? Das wäre dann der Fall gewesen, wenn Deutschland im Vergleich zu den anderen großen Nationen auf der ökonomischen Verliererstraße gewesen wäre, was allein schon wegen der Milliarden-Reparationszahlungen und der Verwerfungen durch die Inflation auf der Hand gelegen hätte. Doch gemessen an der Kaufkraft von 1990 erreichten die Deutschen 1920 ein BIP von im Durchschnitt 2.986 Dollar, 1925 von 3.772 Dollar und 1930 von 4.049 Dollar.43 Das ist für die ersten fünf Jahre eine Steigerung um 26, für die gesamten zehn Jahre eine Steigerung um 36 Prozent. Großbritannien hatte zur selben Zeit BIP-Steigerungen von sechs und zwölf Prozent, die USA zunächst um 13, dann für den gesamten Zehnjahres-Zeitraum nur von zwölf Prozent. Die Basis lag mit 4.912 Dollar im Vereinigten Königreich und mit 5.559 Dollar in den Vereinigten Staaten zwar deutlich höher. Doch die deutsche Größenordnung ist mit der Frankreichs (4.417 Dollar im Jahr 1929) durchaus vergleichbar. Allerdings unterscheiden sie sich darin, dass sich Wirtschaft und Politik in Deutschland deutlich dynamischer zeigten. Von der Zwangsläufigkeit eines Scheiterns war also auch hier keine Spur. Die Konzeption Frankreichs für die Nachkriegsauflagen zu Lasten des Nachbarn ging davon aus, durch systematische Schwächung der deutschen Konkurrenz die eigene Schwerindustrie zur führenden in Europa zu machen und auch die Gefahr eines wieder erstarkenden Rüstungspotenzials Deutschlands zu minimieren. Durch nachdrückliches Einfordern großer Kohlelieferungen sollte auch die deutsche Schwerindustrie klein gehalten werden. Doch weil die wachsende Verwendung des neuen Bessemer-Verfahrens die Stahlerzeugung in Deutschland mit deutlich weniger Kohle ermöglichte, näherten sich die Produktionszahlen bereits 1922 wieder den Vorkriegswerten an.44 Und auch die anderen Ziele verfehlte Paris. Hitler musste nicht erst die Voraussetzungen für ein Wiedererstarken des deutschen wirtschaftlichen und militärischen Potenzials schaffen, er konnte gleich mit dem Ernten dess...