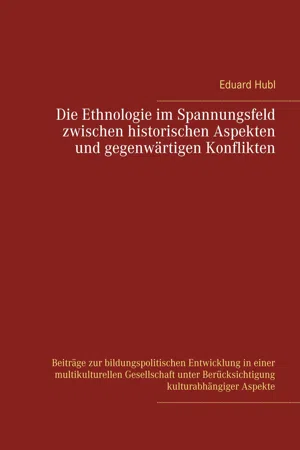
eBook - ePub
Die Ethnologie im Spannungsfeld zwischen historischen Aspekten und gegenwärtigen Konflikten
Beiträge zur bildungspolitischen Entwicklung in einer multikulturellen Gesellschaft unter Berücksichtigung kulturabhängiger Aspekte
- 128 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Ethnologie im Spannungsfeld zwischen historischen Aspekten und gegenwärtigen Konflikten
Beiträge zur bildungspolitischen Entwicklung in einer multikulturellen Gesellschaft unter Berücksichtigung kulturabhängiger Aspekte
Über dieses Buch
Der 2. Versuch einer eigenen Definition zum Kulturbegriff: Kultur entsteht durch das Zusammenleben unterschiedlicher sozialer Gruppen in einer Gesellschaft, die durch Erfahrungen und Erkenntnisse in der Vergangenheit gegenwärtige Zielsetzungen formuliert und durch nachhaltige positive Prozesse eine Basis für die zukünftige Sozialisation ermöglicht. (Hubl 2015)
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Ethnologie im Spannungsfeld zwischen historischen Aspekten und gegenwärtigen Konflikten von Eduard Hubl im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politische Freiheit. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Kapitel
Historische Prozesse in der Ethnologie im Spannungsfeld kultureller Verständigung
Einleitung
Die Ethnologie ist im Vergleich zur Philosophie eine relativ junge Wissenschaft. Aus der Ethnographie und der Völkerkunde hat sich um 1900 eine Ethnologie mit wissenschaftlichen Fragestellungen in Europa entwickelt. Die Sichtweise der Anthropologie, die sich in Frankreich, Großbritannien und Amerika etablierte, verursachte inhaltliche Spannungsfelder zur Völkerkunde und der Ethnographie in Deutschland.
Noch heute wird der Ethnologe in Afrika mit Ablehnung von der Bevölkerung betrachtet, denn die Ethnographie sowie die spätere Ethnologie beschäftigte sich sehr stark mit der Kolonialpolitik und unterstützte auch die Zielsetzungen der Kolonialherrschaft.
Die Anthropologie in Frankreich wurde auch durch das Zeitalter der Aufklärung sehr stark beeinflusst. Hier waren bedeutende Philosophen der Aufklärung, wie z.B. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant und Johann Gottfried Herder, um nur einige zu nennen, die gedanklichen Wegbereiter für die Begründer der europäischen Anthropologie bzw. der Ethnologie. Hier sind für Frankreich Emile Durkheim, Für Deutschland Adolf Bastian und Leo Frobenius sowie für Großbritannien James Frazer, aber auch Edward B. Tylor zu nennen.
Problemstellung
Meines Erachtens sollte sich die moderne Ethnologie und Anthropologie neuen Themenfeldern auch in der eigenen Gesellschaft öffnen. Die Ethnologen sollten sich mehr ethnologisch positionieren und ihre Forschungsergebnisse mehr in der Öffentlichkeit darstellen. In unserer multikulturellen Gesellschaft wird eine positive Neugierde für andere Kulturen immer wichtiger, denn nur durch gegenseitiges Verständnis und gegenseitigem Respekt können mögliche soziale Konflikte durch das Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien gemeinsam und nachhaltig gelöst werden. Die „Interkulturelle Bildung“ sowie die „Interkulturelle Kommunikation“ sollten unbedingt in der Politik, in der Wirtschaft und in den Bildungseinrichtungen als Kernaufgaben z.B. in der europäischen Wertegemeinschaft definiert werden, denn die Flüchtlingsströme an den europäischen Außengrenzen können meiner Meinung nach nur gemeinsam von der EU gesteuert werden. Gegenwärtig sind nur wenige Mitgliedsstaaten der EU dazu bereit. Frankreich und Deutschland gestalten derzeit eine gemeinsame positive und humanitäre Aufnahme der Flüchtlinge.
Es wird zu wenig nach Gemeinsamkeiten gesucht und die Andersartigkeit wird leider zu wenig als positive Entwicklung in der Vielfältigkeit wahrgenommen.
Auch Interkulturalisten gehen davon aus, dass alle Menschen vernunftbegabte Wesen sind, die auch ähnliche Konfliktstrategien besitzen, um grundsätzliche menschliche Probleme durch eine vergleichbare Logik nachhaltig zu lösen. Somit sind die Grundannahmen in der Ethnologie durchaus mit der interkulturellen Kommunikation vergleichbar. (Moosmüller 2011: 276) Nach Moosmüller (2011: 279) ist die Anerkennung von kultureller Differenz davon abhängig, ob die Mitglieder einer Mehrheitskultur oder einer Minderheitskultur befragt werden. Die Angehörigen von Minderheitskulturen wollen kulturelle Unterschiede sehen und Anerkennung für ihr Anderssein erfahren. Dahingegen wollen die Mitglieder der Mehrheitskultur die kulturelle Andersheit ignorieren. Durch diese beiden Betrachtungsweisen wird die Anerkennung kultureller Differenz unterschiedlich gewichtet.
Forschungsstand und theoretischer Rahmen
Aspekte und Aussagen zum Kulturbegriff
Aspekte zur historischen Entwicklung:
Die Philosophen und Humanisten des 17. und 18. Jahrhunderts hatten sich in ihrer philosophischen Arbeit mit dem Kulturbegriff auseinandergesetzt. Das zentrale Thema im Kulturbegriff war für Pufendorf und Herder die humanistische Betrachtungsweise. Pufendorf betonte, dass die menschlichen Werte und die Religion zu pflegen sind. Pufendorf bezog die Kultur auf das „Recht der Natur und der Völker“. Er definierte „Natura mit GÖTTLICH“ und „Cultura mit MENSCHLICH“. (Hahn 2013: 18 – 19)
„Obgleich die französische Ethnologie weiterhin unter dem beherrschenden Einfluß von Claude Lévi-Strauss stand, gelang es Maurice Godelier (1973), Claude Meillassoux (1976) und anderen Ethnologen ihrer Generation, eigenständige Positionen zu entwickeln, indem sie die Ansätze des historischen Materialismus für die Ethnologie fruchtbar zu machen versuchten. Auch in der niederländischen und in der deutschsprachigen Ethnologie spielten neomarxistische Ansätze in den sechziger und siebziger Jahren eine wichtige Rolle“ (Kohl 2012: 165).
Nach Rudolph (1992: 62) zeigt die Kultur eine durch Menschen entwickelte und zielgerichtete Innovation, die alles Nichtmaterielle und Materielle umfasst. In seinem Kulturverständnis werden keine von der Natur aus vorgegebenen Prozesse im menschlichem Dasein betrachtet. Durch die Erneuerungen in seiner Kulturbetrachtung wird eine „Gesamtheit der Ergebnisse“ entwickelt.
Alle menschlichen Kulturen haben Unterschiede und möglicherweise auch Gemeinsamkeiten, die sich aber oft nur durch abstrakte Fragestellungen hinreichend erklären lassen. Die hervorgehobenen Aspekte geben zwei grobe Richtungen in der Theoriebildung. In der einen Richtung sucht man hinter der Mannigfaltigkeit der Kulturen einen einheitlichen Grundsatz, um eine Gemeinsamkeit dokumentieren zu können. In der anderen Richtung sucht man Aspekte, die die unendliche Vielfalt menschlicher Kultur aufzeigt, also gewissermaßen den umgekehrten Weg in der Argumentationskette verfolgt. (Kohl 2012: 133)
Im Gegensatz zu Herder entwickelte Rousseau ein naturbezogenes Argumentationsmodell, denn für ihn war die Natur der Ausgangspunkt und erweiterte die biochemischen Prozesse auf die kognitive Ebene. So sollte Edelmut und moralische Sensibilität bereits im kindlichen Wesen dispositioniert sein und bräuchte nicht anerzogen zu werden. In diesem Modell erscheinen Kultur und Zivilisation als Störenfriede. (Hansen 2011: 227 - 228)
„Den universalen Strukturen des Geistes kommt letztlich der Status von allgemeinen Strukturen des Gehirns zu, sodass es gelingen könnte, Kultur- in Naturwissenschaften zu überführen [...]“ (Reckwitz 1992: 219).
Der 1. Versuch einer eigenen Definition zum Kulturbegriff:
Kultur ist eine ganzheitliche Entwicklung verschiedener Gruppen in einer Gesellschaft, mit variablen Zielsetzungen, sodass veränderbare Bildungsinhalte eine gemeinsame Sozialisation nachhaltig bzw. situativ gestalten und die unterschiedlichen Bedürfnisse gegenseitig mit respektvoller Achtsamkeit gewürdigt werden können. Der Prozess der kulturellen Aushandlung sollte in einer multikulturellen Gesellschaft eine positive Absicht zur gegenseitigen Verständigung in der Annäherung darstellen. Die Suche nach Gemeinsamkeiten und die Akzeptanz der Andersartigkeit könnte als eine „Entwicklungsenergie in der kulturellen Aushandlung“ angesehen werden. (Hubl 2015)
Die französische Kolonialherrschaft
Der Kolonialismus –„mit der unsozialen und ausbeuterischen Zielsetzung der Großmächte“ – hat meines Erachtens noch heute negative Auswirkungen auf die innenpolitischen und gesellschaftlichen Strukturen der ehemaligen besetzten Gebiete. Auch durch die Bekehrungsabsichten der christlichen Weltreligionen, die zwanghaft und kurzfristig ihre Religionsinhalte vermittelten, entstanden meiner Meinung nach strukturelle und nachhaltige Spannungsfelder, die noch heute Konflikte im Zusammenleben darstellen. Eine innere Phase der Reflexion war nach meiner Ansicht nicht möglich und somit konnte auch keine nachhaltige Akzeptanz der fremden Bildungsinhalte/ Religionsinhalte mit der traditionellen Glaubensentwicklung in Einklang gebracht werden.
Definition:
„Kolonialismus, Anlage von abhängigen Gebieten (Kolonien) durch einen Staat außerhalb seines Territoriums. K. wurde bereits von den antiken Reichen (bes. Rom) betrieben und gewann für Europa mit der Erschließung der Seewege in andere Kontinente seit dem 15. Jh. wachsende Bedeutung. Unterschieden wurden Wirtschafts- und Handlungskolonien als Rohstofflieferanten und Käufer von Fertigwaren sowie Siedlungskolonien zur Aufnahme des Bevölkerungsüberschusses der »Mutterländer«“ (Hirschberg: 211).
Historischer Überblick der Ausbreitungsabsichten einiger Großmächte:
Am Ende des 16. Jahrhunderts begann für Frankreich die Zeit des Kolonialismus in Amerika und besetzte in Nordamerika das heutige Kanada, einige karibische Inseln und das östliche Zentralgebiet der USA. Am Ende des „Siebenjährigen Krieges“ musste Frankreich (durch den Pariser Frieden) den größten Teil seiner amerikanischen Besitzungen an britische Regierung abgeben.
Ab 1830 mit der Besetzung Algiers konzentrierte sich Frankreich auf den größten Teil Zentral- und Westafrikas und eroberte zwischen 1845 und 1897 die gesamte Sahara. (Kinder: 107) Die vielen Kolonialgebiete der Franzosen in Afrika waren Französisch – Westafrika (1895-1960), Ägypten (1798-1801), Französisch – Nordafrika (1830-1960), Französisch – Äquatorialafrika (1910-1958), Französisch – Somalialand (1862-1977), Kamerun (1919-1960), und Togo (1919-1969). Im 19. Jahrhundert wurde Frankreich zur zweitgrößten Kolonialmacht der Welt und musste durch eine optimale Verwaltungsstruktur in den besetzten Gebieten ihre Kolonialpolitik organisieren, damit ihre definierten Ziele erreicht werden konnten. (Crowder: 1968) Nach Murray (1981: 56) behielten die Afrikaner – selbst auf den Höhepunkt der Kolonialherrschaft – ihre Religion, ihre eigenen sozialen Organisationsformen und ihre Wertvorstellungen bei.
Definition:
„Verwaltung, […] im materiellen Sinne, Funktionen der Staatsgewalt, die unmittelbar u. im einzelnen auf die Aufrechterhaltung oder Abänderung von bestimmten Lebensverhältnissen gerichtete Staatstätigkeit, die von den anderen „Gewalten“ gesetzte Zwecke relativ selbstständig gestaltend oder vollziehend ausführt“ (Bertelsmann: 307).
Strategien der Verwaltung nach Spittler (1981: 21 – 24):
In Bauernstaaten lassen sich drei Arten von Verwaltung unterscheiden:
(1) Willkürliche Verwaltung: Mitglieder des Verwaltungsstabes sind ständig unterwegs und entscheiden vor Ort im Sinne der Herrschaft. Willkürliche Herrschaft ist in Bauernstaaten weit verbreitet.
(2) Bürokratische Verwaltung: Abstrakte Regeln, die wiederum auf einem abstrakten Wissen über die Gesellschaft beruhen. Die Bürokratie setzt fest. Die Bürokratie organisiert den geregelten Ablauf immer wiederkehrender Abläufe und versucht dadurch die allgemeinen Aufgaben des Staates zu erfüllen (z.B. Steuern, innere Sicherheit, soziale Grundsicherung).
(3) Intermediäre Verwaltung: Für eine Bevölkerungsgruppe wird eine allgemeine Abgabenquote (Tribut) bestimmt und an einen Mittelsmann übergeben. Der Mittelsmann ist alleiniger Herrscher und für die Ablieferung des Tributs an die Verwaltungsspitze verantwortlich. Nicht die schriftliche Fixierung ist wichtig, sondern die mündliche Kommunikation ist für die intermediäre Verwaltung kennzeichnend. Ihre Verwaltungsmittel und ihr persönliches Einkommen richten sich nach den örtlichen Bedingungen. Sie entspricht den strukturellen Bedingungen von Bauerngesellschaften und wird deshalb einer Bürokratie eher bevorzugt.
Folgen französischer Verwaltungsstrukturen:
Französisch – Westafrika: Bis zu neun Territorien gehörten zu diesen Gebieten Obersenegal, Niger, Senegal, Mauretanien, Französisch – Sudan, Guinea und die Elfenbeinküste. Obersenegal/ Niger wurde 1911 ein eigener Militärdistrikt. Es wurden ober- und unterirdische Kernwaffentests in der algerischen Sahara durchgeführt und die Landwirtschaft leidet noch heute unter den Folgen der Atomtests. Der französische Staat hat durch gezielte Verwaltungsstrukturen – auch unter Einsatz militärischer Strategien – nicht nur in Afrika, sondern auch in Nordamerika und in Asien intensiv Kolonialpolitik betrieben.
Nach 1945 bis 1950 beschleunigte sich der Auflösungsprozess des französischen Kolonialreiches. Im Jahr 1960 wurden 14 französische Kolonien unabhängig. Zu den Entwicklungsländern Afrikas zählen noch viele ehemalige französische Kolonien.
Nach Kinder (1966: 109) wurde 1882 der Kolonialverein und 1884 wurde durch Carl Peters (1856 – 1918) die Gesellschaft für deutsche Kolonisation gegründet. Die Kolonialpolitik Bismarcks (1871 – 1890) und die Aktivitäten von Carl Peters hatten die deutsche Weltpolitik entscheidend mitgestaltet.
Nach Kinder (1966: 103) veränderte das britische Kolonialreich seine Ausbreitungspolitik seit dem Sklavenhandelsverbot. Das Interesse an afrikanischen Kolonialgebieten (Goldküste, Gambia) wurde stark reduziert und es wurde sogar um 1865 eine neue Ausbreitungsstrategie entwickelt, die neue Absatzmärkte und Industriestandorte in Südamerika, China und Indien sichern sollten. Die neu besetzten Gebiete dienten zur Sicherung der Seehandelswege und beinhalteten eine strategische Machtausbreitung der geplanten britischen Kolonialpolitik. Nach Kinder (1966: 117) ist das Ende des Binnenimperialismus in den USA ein Neubeginn für die Weltpolitik und Kolonialpolitik der USA (Hawaii 1998; Guam 1898; Tutuila 1900; Alaska 1867).
Die Ethnologie kann Visionen in den ehemaligen besetzten Ländern mit den unterschiedlichen ethnischen Gruppen gemeinsam formulieren bzw. entwickeln, um mit gegenseitigem Respekt die religiösen Unterschiede zu würdigen. Dadurch könnten langfristig Konfliktpotenziale reduziert werden. Eine Philosophie der konstruktiven, toleranten und respektvollen Begegnung kann der Weg einer zielorientierten Konfliktvermeidung sein.
Die Aufklärung und bürgerliches Zeitalter
„Prägend für die Aufklärung war unter anderem die Abwehr vom zirkulären Geschichtsverständnis des Mittelalters. Mit dem neuen Fortschrittsglauben hielten insbesondere im 18. Jahrhundert auch neue Vorstellungen über die Konstitution von Gesellschaft Einzug in das Denken: Die göttliche Legitimation absolutistischer Herrschaftsmodelle mit Ewigkeitswert wurde mit dem zunehmend vernunftbasierten Denken der Zeit in Zweifel gestellt. Damit einher ging die Anerkennung des Individuums als ein mit eigenem Willen ausgestattetes und nach den Parametern der Vernunft handelndes Wesen, das über ein Recht auf freies Denken und gesellschaftliche Teilhabe verfügt. An die Stelle der Wahrnehmung der Gesellschaft als namenlose Masse rückte ein individualistisches Konzept vom Menschen, und erstmals – sieht man von einigen seltsamen Ausnahmen einmal ab – bezogen Frauen außerhalb des häuslichem Universums dezidiert Position zu gesellschaftl...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Kapitel: Historische Prozesse in der Ethnologie im Spannungsfeld kultureller Verständigung
- 2. Kapitel: Darstellung verschiedener Aspekte in der Radikalisierung islamischer Strömungen
- 3. Kapitel: Die Politische Ethnologie in Spannungsfeld zwischen der „Interkulturellen Orientierung“ und der „Interkulturellen Bildungsentwicklung“ im Kindergarten, Bildungsstätten und im Sport
- Weitere Auswertung der empirischen Erhebung: Was verstehen Sie unter „Interkultureller Kompetenz“? (Zwei Angaben sind möglich)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
- Impressum