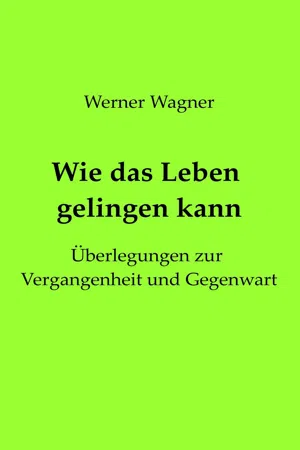![]()
1. Eine entscheidende Wende der Frühzeit
Wie vieles oder alles Entscheidende sich über große Zeiträume hinweg in der Frühzeit der Evolution herausgebildet hat, so geschah es auch mit den Eigenheiten der Menschen. Das Wie der Entstehung entzieht sich unseren derzeitigen Erkenntnismöglichkeiten. Wir können annehmen, dass der Naturverlauf im Großen sich ein alternatives Gegenüber im Kleinen geschaffen hat. So ähnlich wie die sogenannte tote Materie das organische Leben hervorbrachte, hat die Gesamtevolution den Menschen mit seinem Bewusstsein entstehen lassen. Dieses Gegenüber wurde dann immer mehr zu dem, was man später das Geistig-Seelische genannt hat. Es ist nicht mehr wie das, was wir als Materie bezeichnen, aber ohne diese ist es auch nicht, und auch nicht zu begreifen, da es sich als das ganz Andere im Menschen ohne Materie nicht zeigt.
Stellen wir uns den Menschen vor, der uns denkend, weil er spricht, leibhaftig begegnet. Das kann er nur, weil er geistig, leibhaftig lebt. Dabei ist das “Seelische” der die materielle Körperhaftigkeit durchdringende Geist. Das Licht, das durch eine Glasscheibe leuchtet, könnte dafür ein gutes Bild sein. Bei aller Fragwürdigkeit könnte man das Geistige wie ein Diaphragma sehen. Das Geistige ist köperhaft oder der Körper ist geistig. Deshalb hat der Mensch eigentlich keinen Körper, er hat einen Leib. Er lebt leiblich.
Das Leib-Seelische grundsätzlich so zu sehen, könnte der Ausgangspunkt der Naturerfahrung des Menschen der Vorzeit wie auch späterer Zeiten sein. Danach gehört der Mensch zu dieser Welt, zu der er sich als Teil gehörig fühlt, ohne in ihr völlig aufzugehen, denn er steht ihr immer auch noch gegenüber, und das schon in der Frühzeit, sonst wäre Magie nicht möglich gewesen. Diese zeigt die Zusammengehörigkeit von Mensch und Umweltmaterie wie deren Distanz, weshalb der Mensch auf ein Geschehen in diesem Bereich einwirken kann. Der Mensch ist von derselben Art wie das, worauf er mit seinem Tun eingreift; er steht diesem aber auch als der oder das ganz Andere gegenüber.
Diese Sicht auf die Geschichte des menschlichen Werdens, das viele Jahrhunderte kein Objekt der Erkenntnis, nur verkürzt erwähnt, eine Annahme des mythisch erzählenden Schöpfungsglaubens war, ist für unsere Deutung heute wichtig, weil sie unsere Eigenart beleuchtet. Kurz gesagt, wir sind und bleiben Naturwesen, die ein besonders Verhältnis, überhaupt ein Verhältnis, hier zur Natur, auch zur eigenen, haben.
Als Naturwesen erleben wir die Natur bewusst wie auch unbewusst. Für ein gelingendes Leben soll das Bedenken dieses “In der Welt Sein” ein Ausgangspunkt sein. Wie man sich fühlt, in welcher Stimmung man ist, wie die natürliche Umwelt auf uns wirkt, all das macht unser Weltbefinden aus, und zwar schon immer, weshalb es zu dem gehört, was Gelingen bedeutet. Der Mondschein, eine längere Regenzeit, die Frühjahrsmüdigkeit dürfen als Hinweis auf die Natureinflüsse dienen.
Zu diesem Gelingen gehört auch ein Bezugsrahmen, um den es im nächsten Abschnitt geht. Für Tiere ist das die Umwelt, der sie sich, um zu überleben, angepasst haben und zu der sie selbstverständlich schon immer gehören. Die Menschen haben in, aus und zu ihrer natürlichen Umwelt einen kulturellen Rahmen geschaffen, den wir Heimat nennen.
![]()
Die “natürliche” Welt als Heimat des Menschen
In unseren Tagen ist oft von Heimat die Rede. Sogar ein Ministerium beschäftigt sich damit. Ohne auf die geäußerten Meinungen, was Heimat ist, einzugehen, möchte ich all den möglichen Vorstellungen entgegenhalten, die eigentliche Heimat des Menschen ist vom Ursprung her gesehen, eigentlich die Natur. Und was für uns eigentlich etwas ist, wird dann bedeutsam, wenn wir es nicht mehr haben und und es uns unbedingt besorgen müssen.
Wenn Menschen Erholung brauchen, wenn Rekonvaleszenz angeordnet wird, wenn wir wegen Erschöpfung ausspannen sollen, dann gehen wir gewöhnlich nicht in den städtischen Trubel, etwa auf den Stachus. Jeder erfahrene Arzt wird uns davon abraten. Ein Heilmittel ist dann die Natur. Wenn wir entspannen wollen, dann gehen wir spazieren über Berge und Täler, in Wälder, Wiesen, Felder und Flure. Die Stille des städtischen Friedhofs ist nur ein Ersatz. Auf dem Gemäuer einer Burgruine kann man stundenlang sitzen, in das Auf und Ab der Berge und Täler schauen, den Gedanken freien Lauf lassen, und am Ende ist man von dem Vielen-Sehen nicht beschwert. Ganz anders ist das Erlebnis in den Straßen der Stadt mit den vielen verschiedenen Eindrücken. Diese können uns im Gegensatz zur Naturerfahrung verwirren und das Gemüt belasten.
Der Westerwald, die Höhen des Schwarzwaldes oder das felsenreiche Bergland der Pfalz sind begehrte Erholungsziele. Sie stehen stellvertretend auch für andere Gegenden, wo man erleben kann, was Natur heißt. Dort lebt man nicht einfach in der Natur, man erlebt sie. Dieses Naturerlebnis vermittelt ein bleibendes Heimatgefühl, auch wenn diese Natur nicht unsere ursprüngliche Heimat ist, und zwar deshalb, weil es bleibend unser Erleben bestimmt.
Eine Erfahrung, die das Gemüt ausgeglichen und standhaft machen kann.
Dennoch ist der Begriff Heimat gerade bei aller Vielfalt der Bedingungen (Migration, Integration, Isolation, Urbanisierung etc.) nach meinem Verständnis von uns heute vornehmlich soziologisch-kulturell zu gebrauchen. Der Bezug zur Natur, der wie die Grundlage der Kultur ist, kann in der Kindheit wie auch später erlebt werden; viele, die nicht mehr in der angestammten Heimat leben, fühlen sich in der neuen recht wohl. Deshalb sage ich im Hinblick auf die Mobilität moderner Gesellschaften, ist Heimat heute vor allem ein kultureller Begriff, der aber die Naturerfahrung späterer Jahre erfahrungsgemäß einschließt. An dieser Begriffsbestimmung ist nach meinem Verständnis, da er durch Erfahrungen belegt ist, nichts auszusetzen.
Man kann sich auch in zwei Kulturen wohlfühlen. Das war schon immer so. Ich sage nur, die Kultur kann oder soll ergänzt werden, entweder kulturell durch die Erfahrung einer anderen oder durch ein Erfahren von Natur. Zusammengefasst: Natur ist die Basis, Kultur die Gestaltung. Beide sind bleibend und aufeinander bezogen. Sie stehen zueinander in einem permanent dialektischen Verhältnis.
Da Heimat die “Annäherung an ein schwieriges Gefühl” ist, wie DER SPIEGEL Wissen 6/2016 auf dem Deckblatt schreibt, soll neben dem kulturellen Bezug, besonders der zur Natur, der heute, wie es scheint, in anderen Bezügen allgemein neu entdeckt wird und immer mehr in seiner Bedeutsamkeit auch gesehen werden muss, in Ansätzen dargelegt werden.
Heimat, Lebensgefühl, Geborgenheit, Dazugehörigkeitsbewusstsein sind primär natürliche Daseinserfahrungen.
Damit keine Missverständnisse oder Unklarheiten entstehen, sei gleich betont. Dieser Naturbezug hat nichts mit der naturnahen Heimatbestimmung der nationalsozialistischen Volkstumsideologie zu tun, höchstens mit dem Bereich eines ursprünglich naturnahen, individuellen wie gemeinschaftlichen Lebens.
Und das beginnt in der Kindheit, wobei besonders abgehoben wird auf die Sprache, dann auf die Gewohnheiten bei Tisch und beim Zu-Bett-Gehen, wenn nach dem Gebet und dem Gute-Nachtwunsch noch unbedingt erzählt werden muss, was der Nachbarjunge oder das Nachbarmädchen heute Nachmittag angestellt hat. All das betrifft das kindlich Soziale, was gemütsprägend ist.
Was ich noch besonders hervorheben möchte, ist das heimatlich Naturelle und Kulturelle. Der Einfluss, wo vom Morgen bis zum Mittag und dann vom Nachmittag bis zum Abend innerhalb der Straßen gemeinsames Geschehen erlebt wird; wie am Fichtensaum des Waldes, in der Nähe der drei Buchen am Abend die Rehe an den Wiesenrand kommen, um zu grasen; das alles hat man beobachtend gemeinsam erlebt. Die Gegend und das Mit-und Zwischenmenschliche beeindrucken unbewusst, sie können als bleibender Eindruck unbewusst im Gedächtnis bewahrt werden und als Alterserinnerung wieder auftauchen.
Die Natur als Garten mit Rasen und Hof, der Kinderspielplatz mit Bäumen und Wiesen und in der Ferne mit Waldwegen, die Äcker mit Getreide, Kartoffeln und Rüben, all das scheint nur einen blassen Schimmer zu hinterlassen, scheinbar. Es ist der Hintergrund unseres Erlebens. Dann kommt das eigentlich Menschliche. Dass es das Zwischenmenschliche oder anders gesagt das Soziale ist, was uns wegen seiner beeindruckenden Bedeutsamkeit vor allem interessiert, muss nicht besonders hervorgehoben werden
Unser vom Natürlichen bestimmter Heimatbegriff benötigt eine Ergänzung; und diese sollte auch in der Erziehung eine Zielvorstellung sein. Gemeint ist das soziale Umfeld in der Breite der Möglichkeiten. Dazu gehört zunächst die Offenheit für Menschen, Tiere und Sachen und ein Blick für die Gegend.
Das der Erziehung und der Einführung ins natürliche Leben Entsprechende, könnte auch damit beginnen, Kindern auf Spaziergängen allerlei, was man so sieht, Pflanzen, Blumen, Gräser, Büsche und Bäume zu benennen und zu erklären; auch von Menschen, denen man begegnet, etwas Nettes zu sagen. Das weckt Aufmerksamkeit und kann ein erster Schritt sein, das Leben positiv zu sehen oder wenigstens offen zu sein. Es wird allerdings schwierig, wenn Mama und Papa selbst keinen offenen, neugierigen Blick für Zufälliges haben oder sich selbst in der Natur nicht richtig auskennen und nicht wissen, Gerste von Hafer und Roggen vom Weizen und die verschiedenen Bäume zu unterscheiden. Und von Menschen kann man einfach etwas Lustiges zum Lachen sagen.
Das alles ist eine lockere Einführung ins heimatliche Leben.
Zu der Natur als Heimaterlebnis gehört neben der Gegend mit der Flora auch die Fauna, aber diese ist gegenwärtig für uns, ganz prosaisch ausgedrückt, der Fleischproduzent. Die Ausnahme ist vielleicht nur noch im Zoo oder im unzugänglichen Urwald anzutreffen. Der Bestand an Tieren wird allgemein in Tonnen und Kilo angegeben. Das passt gut in unsere Zeit, in der alles in Maßeinheiten angegeben wird. So ist auch die Wissenschaft der Neuzeit und Moderne bestimmt durch die Mathematik, die alles zahlenmäßig, d.h. quantitativ, angibt. Die Natur in Flora und Fauna ist aber von ihrem Ursprung her eine qualitative Vorstellung. Denn so wird die Natur als Form unseres Lebens zunächst erlebt. Für dieses Zusammenleben, das sich jenseits jeglicher Isolation vollzieht, ist der Begriff Heimat angemessen.
Dass die Isolation von Mensch und Tier heute heute völlig neu bedacht werden sollte, darauf weist uns der Einsatz von Therapiehunden in der Psychotherapie und Altenbetreuung hin. Wie Kinder sich Tieren im Zoo oder in einem freien Gehege nähern, ist nicht nur rührend. Es muss auch nachdenklich machen.
Wir sind hier am Anfang, die Isolation von Mensch und Natur als Problem zu erkennen. Und da es um das Gelingen des Lebens geht, sollte hier neben dem Sozial-Kulturellen auch das ursprünglich animalisch Natürliche zur Geltung kommen.
Wer die geschilderte Breite der Naturerfahrung als überzogen ansieht, hat sicher ein anderes Problembewusstsein. Es stehen sich hier zwei Deutungen von Natur-und Heimaterfahrung mit ihren Konsequenzen gegenüber. Ich meine, die geschilderte und gemeinte Erfahrung sollte breit sein, damit sie für junge Menschen wie ein festes und sicheres Sprungbrett für die typisch menschlichen Aktivitäten fungieren kann.
Die bisher beschriebene Naturerfahrung war vom Menschen her gesehen mehr eine hinnehmende. Die Offenheit für das sich in der Natur Zeigende bestimmt hier das Dasein und kann so das Leben auf der Basis des Naturgegebenen nach Möglichkeit gelingen lassen. Das weitere Gelingen des Lebens hängt ab von der Eigenaktivität des Menschen.
Das Leben als zu bedenkende Aufgabe
Das gelingende Leben mehr in der offenen Erwartungshaltung des Beschenktwerdens zu sehen, ist der eine Aspekt des Lebens. Der andere Aspekt ist der Rückbezug auf die Vergangenheit, an der nichts mehr zu ändern ist. Man kann aus einem Rückbezug nur entsprechende Folgerungen ziehen. Eine weitere Sicht ist die auf den Lebensraum, der zur Eigeninitiative und zur Selbstgestaltung herausfordert. Das ist die individuelle und soziale Welt des Menschen, in der er zeigt, was er jetzt alles kann, und wozu er darüber hinaus noch fähig ist. Als Beweis für die zu treffenden Feststellungen dienen Beispiele menschlicher Tätigkeiten, die sehr zahlreich sind und den verschiedensten Lebensbereichen angehören, und jeweils unter einer bestimmten Frage zu erörtern sind.
Durch dieses Bedenken ist dann das menschliche Tun nicht einfach nur eine zu schildernde oder geschilderte Tätigkeit, ein Konstatieren, eine quasi objektive Berichterstattung, wie nach einem Unwetter, vergleichbar einem Photo, das zeigt, was ist oder war. Es ist mehr. Es ist ein Bedenken.
Das Bedenken hinterlässt geistig-seelische Spuren. Es ist etwas anderes als ein Machen.
War das Naturerleben für den Menschen die Basis eines einfachen-natürlichen Gelingens des Lebens in der Eingebundenheit, so ist das Leben in der Distanz des Denkens Ausgang wie Begleitung menschlichen Strebens. Die Eingebundenheit und die Distanz des Denkens werden in der Wirklichkeit als emotionale Einheit erfahren. So wird aus dem Leben ein Erleben, in dem Leben gelingen kann.
Diese Erfüllung nannte die alte Welt Glück. Ich würde es beim Gelingen belassen.
Die Geistigkeit des Menschen ist etwas Besonderes, was den Menschen innerhalb der lebendigen Vielfalt auszeichnet. Aber das Animalische führt ihn wahrscheinlich zu einem Grunderlebnis, das man erst allmählich begreift. Wie das Emotionale im Menschen lebt, dazu sollten die Hinweise auf das ursprüngliche Naturerleben zum Weiterdenken anregen.
Die Frage, wie menschliches Leben gelingen kann, soll in der Beantwortung das Typische des Menschseins als Ausgangspunkt nehmen. So geht es um die Entfaltung von allgemein angenommenen Anlagen und nicht um bezweifelbare Meinungen.
![]()
2. Die alte Welt – ein immerwährendes Erbe
Klugheit
Man dachte schon vor Zeiten, das richtige Leben, d.h. das gelingende, bestehe darin, was gut ist, in die Tat umzusetzen. Da die Praxis, neben der Frage, was ist gut, ein entscheidendes Moment im Erreichen dieses Zieles ist, sind die Eigenschaften der Menschen, die das Gut in die Tat umsetzen, mit entscheidend. Wenn das Leben gelingen soll, dann sind vorgegebene Eigenschaften, die ja von der Möglichkeit her das Leben ausmachen, zu bedenken. Denn nur was möglich ist, kann auch gelingen.
Da es um die grundsätzliche Einstellung des Menschen zum Leben geht, und worauf die Art seiner lebensbewältigenden Tätigkeiten mit ihren jeweiligen Zielen zurückzuführen sind, ist nicht die Menge der Beispiele bedeutsam, sondern die Bestimmung des Eigentlichen, die Antwort auf die Frage nach der entscheidenden Lebenseinstellung.
Darüber nachzudenken, haben die Philosophen Sokrates, Plato, Aristoteles und die Stoiker begonnen, was dann im Mittelalter fortgeführt wurde. Von Petrus Lombardus (1100 bis 1160), der das philosophisch-theologische Unterrichtsbuch seiner Zeit schrieb, stammt der Satz: prudentia dicitur genitrix virtutum. Frei und sinngemäß übersetzt: Die Klugheit ist der Ursprung der sittlichen Lebensführung.
Danach sind Gerechtigkeit, Maßhalten und Tapferkeit Bestimmungen der Klugheit, bzw. sie sind durch die Klugheit bedingt. Als Einführung in die Klugheit soll ein kurzes Gebet Wesentliches sagen. Der Gebetsvorschlag lautet folgendermaßen, “Gott gebe Dir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die Du nicht ändern kannst, den Mut, Dinge zu ändern, die Du ändern kannst, und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.”.
(statt Weisheit müsste hier Klugheit stehen, denn Klugheit ist Handlungswissen (recta ratio agibilium), und Weisheit ist ein Wissen um die Welt als Ganzes, als große Einheit und die letzten Zusammenhänge, um die es in dem sonst klugen Gebet nicht geht. Gerechtigkeit und Tapferkeit sind hier direkt angesprochen, Maßhalten indirekt.
Um zu der gemeinten Klugheit zu gelangen, bedarf es der Überlegung, die zu einem Urteil führt, was man tun könnte und was man bleiben lassen sollte. Am Ende steht die Anweisung oder der Befehl, was man für klug hält und nichts anderes ist zu tun. Wer vor lauter Überlegungen um die Erkenntnis von Möglich...