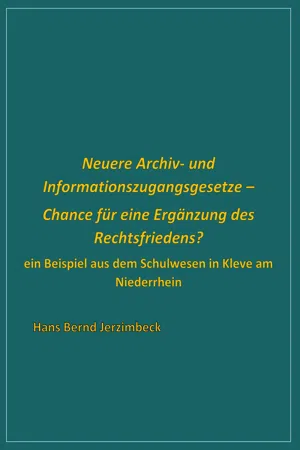
eBook - ePub
Neuere Archiv- und Informationszugangsgesetze - Chance für eine Ergänzung des Rechtsfriedens?
Ein Beispiel aus dem Schulwesen in Kleve am Niederrhein
- 76 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Neuere Archiv- und Informationszugangsgesetze - Chance für eine Ergänzung des Rechtsfriedens?
Ein Beispiel aus dem Schulwesen in Kleve am Niederrhein
Über dieses Buch
Der Zugang zu Verwaltungsakten ermöglicht manchmal Einsichten, bei Archivakten sehr späte. Trotzdem ist es, wie in diesem Fall auch nach 50 Jahren, immer noch interessant, diese zu erfahren.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Neuere Archiv- und Informationszugangsgesetze - Chance für eine Ergänzung des Rechtsfriedens? von Hans Bernd Jerzimbeck im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Lesehinweis
Die Broschüre ist mit ihren vielen Fußnoten nicht einfach zu lesen. In Kapitel 8, der „Zusammenfassung“, sollen Leserinnen und Leser, die nicht so schnell die Broschüre sich erlesen können oder wollen, an den Stand der schnelleren Leser näher herangeführt werden. So auf den gleichen Wissensstand gebracht, wird den Lesern die Diskussion auf annähernder Augenhöhe möglich.
2. Vorwort
„Geschichte ist vorbei. Warum sich um den Schnee von gestern kümmern und den Toten nicht ihre Ruhe lassen? Die Menschen haben noch nie etwas aus der Geschichte gelernt.“ In Wirklichkeit streiten sich die Menschen schon immer leidenschaftlich über Geschichte, finden eine neue Sichtweise auf Vergangenes, sehen Parallelen zur Gegenwart. Der Kampf gegen das Vergessen ist ein dauerndes Thema der Menschheit, selbst der Einzelnen (mit zunehmendem Alter noch intensiver). Auch werden Ereignisse aus der eigenen Lebenszeit mit immere größerem Abstand anders, im besten Fall klarer, gesehen. Wegen dieser positiven Sichtweise auf eine Beschäftigung mit der Vergangenheit bemühte sich der Verfasser [HBJ] um zwei kleine Veröffentlichungen1.
Das Suchen in Archiven kann auch heute noch zu Überraschungsfunden oder neuer Nutzung bzw. Bewertung bekannter Akten führen. Um das Geeignete zu finden und damit aus der Vergangenheit fruchtbar für die Gegenwart zu erzählen und zu berichten, muss Einiges zusammenkommen: dass die Quellen die Zeiten überstehen und auch gefunden werden.
Neben der Chance der Überlieferung und des Auffindens war die „natürliche“ Auslese der sprachlichen Quellen (mündliche gegenüber schriftlichen Quellen) bei den zwei vorigen Projekten – und ist bei diesem Vorhaben – von besonderer Bedeutung. Denn diese Auslese bevorzugt im Laufe der Zeit die schriftlichen Quellen und damit deren Inhalte.2 Da Schriftliches aus alten Bibliotheken, archäologischen Funden, aus Amtsstuben und Kontoren Jahrtausende nur von einem kleinen Kreis der Schreib- und Lesekundigen erstellt werden konnte, ergibt es notwendigerweise ein einseitiges Bild durch Zeugnisse aus der Sicht von Regierung, Administration, Produktion und Handel. Für eine Darstellung, die einen Schwerpunkt in der Sozialgeschichte hat, ist die zu geringe Gewichtung der Mündlichkeit oft eine Schwäche. Diese muss dann anderweitig so weit wie möglich ausgeglichen werden.3 In dieser hier vorliegenden Arbeit geht es darum, einen Wissensstand in einem Teil der Klever Bevölkerung als deren „mündlich erhaltenes Gemeingut“ aus Gesprächen des letzten Jahres zu erschließen und ihn durch einen Glücksfund aus dem Archiv in seiner Wahrheit bestätigt und noch weiter aufgefächert zu finden. Damit besteht die Möglichkeit ein „Aussterben“ des verbal tradierten, nicht verschriftlichen Wissens und eine Legendenbildung in Schrifterzeugnissen zu verhindern.
Unentdeckte und unerwartete schriftliche Informationen, wie sie hier nach 50 Jahren vorliegen, können heute in der Öffentlichkeit noch eine Wirkung entfalten, da noch ein Teil der damaligen Zeitgenossen leben. 20-30 Jahre später wird der Zugang trotz neuer Informationen wirklich nur noch „historisch“ sein.
Hier ist als Form nicht die Biografie geeignet sondern die Dokumentation einer innerbehördlichen und strafrechtlichen Aufarbeitung sowie der zugrunde liegenden Probleme.
Dieses die Verwaltungs-, Sozial-, Gesellschaftsgeschichte und auch die Sozialpsychologie berührende Thema wird mit seinen Ergebnissen ausgewertet im Rahmen eines übergeordneten Themas (nämlich das im Titel genannte). Diese Einbindung hat den Sinn, das Thema aus der Gefahr der unsachlichen Konfrontation und unproduktiver Konflikte zu holen. Das Mittel, diesen Sinn zu erreichen, ist, mögliche Einwände gegen eine Veröffentlichung in den Kontext eines laufenden wissenschaftlichen Diskurses zu stellen. Gemeint ist der Diskurs über Informationen zwischen Amtsgeheimnis und Amtsverschwiegenheit sowie dem Recht von Individuum und Öffentlichkeit auf Informiertheit im Rahmen der Zivilgesellschaft. Dabei wird hier vertreten, dass die Freigabe von Informationen bekannte Schwächen des Konzepts „Rechtsfrieden“ in Hinblick auf verbreitetes Gerechtigkeitsempfinden ausgleichen kann. Eine Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass die Beteiligten an den jeweiligen öffentlichen Diskussionen Spielregeln der Zivilgesellschaft einhalten oder sich zumindest hauptsächlich an ihnen orientieren. Dass die Broschüre sowohl den wissenschaftlichen als auch den journalistischen Bereich betrifft, hat Bedeutung für die Herangehensweise an das Thema und setzt unterschiedliche rechtliche Rahmen.
1 1. Ashauer-Jerzimbeck, Hans Bernd, Bekenntnis zu Weltoffenheit und Menschenfreundlichkeit, Zur Erinnerung an den Esperantisten Paul Tarnow (1881-1944), in: Düsseldorfer Geschichtsverein (Hrsg.), Düsseldorfer Jahrbuch 85, 2015, S. 271-289. 2. derselbe, Der anarcho-syndikalistische Fabrikarbeiter und Schmied Anton Rosinke (1881–1937), Zum 80. Jahrestag seines Todes durch Gestapofolter, in: Düsseldorfer Geschichtsverein (Hrsg.), Düsseldorfer Jahrbuch 88, 2018, S. 249-276.
2 Neben sprachlichen Dokumenten sind auch Bauten, Anlagen und Spuren von Eingriffen des Menschen in Landschaft und Umwelt sowie (Kunst-)Gegenstände Zeugnisse der geschichtlichen Vergangenheit.
3 Ob es um die Befragung von Zeitzeugen durch die Verfasser von historischen Schriften geht oder um die Nutzung von mündlichen Quellen aus zweiter Hand – immer müssen die Entstehungsgründe, Umstände der Übermittlung und Verwendungszwecke der Aussagen kritisch betrachtet werden.
3. Einleitung
Anlässlich des 200. Jubiläums des Klever Gymnasiums 2017 gab es eine Festschrift. Sie beschäftigte sich in nur wenigen Sätzen und mit wenigen Worten mit einem Thema, was in meinen sporadischen Gesprächen mit ehemaligen Schülern über die letzten 50 Jahre einen großen Raum einnahm: den Umgang des Lehrers Wilhelm Michels mit seinen Schülern. – Auch vorher war dieser Lehrer für viele Schüler ein Problem. - Die Festschrift hält sich an drei Stellen bei Wilhelm Michels auf:
- o Im Beitrag über Erlebnisse eines ehemaligen Schülers und später Lehrers der Schule mit den Worten „befremdlicher Umgang“4,
- o im Beitrag eines ehemaligen Schülers mit den Bezeichnungen „übergriffigen Lehrstil“ und „zerrissener Mann“5,
- o in einem weiteren Beitrag eines ehemaligen Schülers indirekt, dafür ausführlicher.6
Die ersten beiden Textstellen sehen den Lehrer Michels zwar im kritischen Licht, doch sind es Attribute (befremdlich, übergriffig, zerrissen) die dies – einer Festschrift angemessen – nur ohne konkrete Beschreibung und ohne neue Hintergrundinformationen ansprechen. Die letzte Textstelle zieht einen Schlussstrich, der Betroffenen unter die Haut gehen muss. Auf rein abstraktem Niveau wird ein gegenseitiges Abwägen zwischen Schädigungen einzelner Lehrer an ihren Schülern (viele Lehrer ... großen Schrecken verbreitet; Fußnote 6) und Schädigungen durch Schüler an einzelnen Lehrern (einige Studienräte ... sich sehr gut als Opfer eigneten – ebd.) vorgenommen und diese als ausgewogen erklärt. Als wenn sich dies gegeneinander aufrechnen ließe! Damit widerfährt weder den geschädigten Lehrern noch den geschädigten Schülern Gerechtigkeit. Obwohl sicher nicht so geplant, gibt diese Verharmlosung und Relativierung den Andeutungen der beiden anderen Textstellen den Anschein von etwas Unbedeutendem. Am Ende scheint damit alles gesagt. Denn mehr findet sich nicht in der Festschrift zur „Beinahe-Revolte“ (s. Hagen, vorige Seite) an der Schule im Jahr 1969 und seinem Anlass.
Bei Gesprächspartnern, mit denen der Verfasser [HBJ] über diese Textstellen sprach, nahm er – auch heute noch, 50 bis 60 Jahre danach – Unruhe oder Empörung über diese Darstellung der wirklichen Verhältnisse wahr. Die Gesprächspartner waren zwischen 63 und 74 Jahre alt.
Die Medien haben die Kenntnisse verbreitet davon, was Psychotraumatisierungen, ihre Überwindung und die Folgen der posttraumatischen Belastungsstörungen sind. In der Öffentlichkeit gab es dieses Wissen vor 50 bis 60 Jahren nicht. Schon die allgemeinen Aussagen der Festschrift lassen annehmen, dass eine nicht kleine Menge der ehemaligen Schüler mehr oder weniger von den Erfahrungen geprägt ist. Diese Annahme wird in dieser Broschüre erhärtet.) Diese Schüler dürften sich bei Kenntnisnahme der Textpassagen aus der Festschrift mit ihren teils Jahre langen Angstzuständen unverstanden und unbeachtet gefühlt haben (obwohl dies natürlich seitens der Schule nicht geplant war).
Mitte der 60er Jahre hatte der Verfasser [HBJ] den Lehrer nur mehrere Wochen erlebt und verließ die Schule, weil seine Eltern schnell die Notbremse zogen, als es sich abzeichnete, dass die Strafarbeiten die Hausarbeiten um ein Vielfaches überwogen. Ein Freund aus Kindheitstagen, der in dieselbe Klasse eingeschult wurde, blieb. Seine Mutter erzählte noch vorletztes Jahr, er sei mit zitternden Händen zur Schule gegangen, wenn der Unterricht bei Lehrer Michels anstand. – Von dem Phänomen des Zitterns wird noch die Rede sein. – Ein anderer Schüler ist ein paar Wochen später mir nach in eine neue Schule gekommen, nachdem er sich wohl geweigert hatte, in den Unterricht von Lehrer Michels zu gehen. Später hat der Verfasser [HBJ] die standhafte Weigerung als Ausdruck von dessen starken Willen verstanden. Über Jahrzehnte war es regelmäßig in sporadischen Gesprächen mit ehemaligen Schülern des Lehrers und ihren Eltern ein gesichertes Wissen, dass es schlimm bei dem Lehrer war und Alles eigentlich ungeahndet und folgenlos blieb. Ein Relativieren und damit sich entschuldigen, beispielsweise in der Form: „Wir haben auch Lehrer zur Verzweiflung getrieben.“ war nie zu hören. Heute sind die Eltern der ehemaligen Schüler von Lehrer Michels oft nicht mehr am Leben und die Schüler selber – nachvollziehbar – nicht geneigt, in aller Öffentlichkeit Verharmlosungen zu widersprechen. Das Gefälle zuungunsten der Tradierung mündlichen Wissens und zugunsten des Erhalts des schriftlichen neigt sich – scheinbar unvermeidbar – im Laufe der Zeit immer mehr.
Auf diesem Hintergrund ist das Kapitel „Wilhelm Michels – gefürchteter Pädagoge“7 im „Kalender für das Klever Land“, ab Dezember 2017 erhältlich, zu verstehen. Das Kapitel spricht deutlich mündlich tradiertes Wissen und dazu recherchierte Ergänzungen an und verzichtet darauf, sie stilistisch zu glätten. Es ist eine kritische, doch immer argumentierende Dokumentation zu „Levi“ (der Spitzname von Lehrer Michels). Schon allein die Abwägung von Einstellungen und Pro und Contra hebt den Artikel von der Festschrift ab.
Eine weitere Klärung – und Beweis der richtigen Erinnerung seitens N. Mappes-Niediek – verspricht hier die konkrete Benennung der Fakten aus Akten und eine entschiedene Bewertung von einer umfassend informierten Warte aus, wo mündliche und schriftliche Quellen schon zusammen genutzt wurden.8
4 Diedenhofen, Wilhelm, Meine Gymnasialzeit 1947 – 1955, in: Festschrift zum 200-jährigen Bestehen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Kleve 2017, S. 55: Die Jahre bis zum Abitur habe ich als die weniger schönen in Erinnerungen. Das lag zum einen an einem strengen Herrn, dem Klassenlehrer Wihelm ‚Levi‘ M., der einen befremdlichen Umgang mit uns 18-jährigen Schülern pflegte.
5 Hagen, Wolfgang, Abiturrede ‘68 – Ein nachdenkliches Vorwort, in: ebd. S. 63: Ein Jahr später brach wegen ihm und seinem übergriffigen Lehrstil an der Schule fast eine Revolte aus. Ein zerrissener Mann.
6 Rowold, Manfred, So schlimm war es doch nicht! [Womit das Jahr 1968 in Kleve gemeint ist; HBJ], in: ebd. S. 58: Ich kann nicht behaupten, dass unter diesen Göttern [diesen Lehrern; HBJ] viele gewesen wären, die ihre menschliche Herkunft verleugnet und großen Schrecken verbreitet hätten. Das mag natürlich sehr individuell empfunden und erlitten worden sein, mit frustriertem Leistungswillen und enttäuschtem Wohlwollen beiderseits. Gerüchteweise hörte ich von Mitschülern anderer Klassen, dass es einige wenige Exemplare unangenehmster Art gegeben haben soll, sogar Namen wurden genannt. Zuweilen hatte ich allerdings auch bei einigen Studienräten (…) den Eindruck, dass sie sich sehr gut als Opfer eigneten und als solche auch in Anspruch genommen wurden.
4. Einander näher als gedacht – Schüler, Eltern und Lehrer,
Schulleitung und Schulaufsicht des Klever Gymnasiums 1969
Es fanden sich drei Entnazifizierungsakten9 und die Personalakte10 von Lehrer Michels. Die Personalakte umfasst seine gesamte Arbeitszeit als Lehrer von 1938 bis 1978. Sie enthält die „Untermappe C“11 mit den Ereignissen vom 2. Mai 196912 bis zum 17.02.197013. Ihr ist zu entnehmen, wie die disziplinarischen Ermittlungen verliefen, welche Auffassungen von welchen Entscheidungsträgern im Schulverhältnis vertreten wurden und welche Änderungen sich in diesen Auffassungen ergaben. Die Akten geben den Blick frei auf den Verlauf, über den die Schüler und ihre Eltern nun fast 50 Jahre lang in vielen Punkten auf Spekulationen angewiesen waren. Auch Einiges, was vor de...
Inhaltsverzeichnis
- Weitere Informationen
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Lesehinweis
- 2. Vorwort
- 3. Einleitung
- 4. Einander näher als gedacht – Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitung und Schulaufsicht am Klever Gymnasium 1969
- 5. Rückkehr zu resignativer Grundstimmung
- 6. Spätfolgen
- 7. „Besser spät als nie.“
- 8. Zusammenfassung
- 9. Schluss
- Impressum