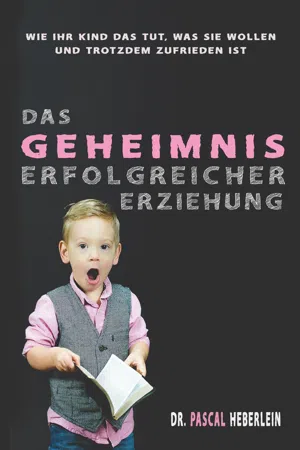![]()
Zweiter Teil:
Die Erziehungspraktiken
![]()
7 Wie wir Kindern begegnen – unsere sichtbare Seite
Wenn mich Menschen fragen, was ich beruflich mache, dann sage ich häufig, dass ich Berufsfußballer bin. Obwohl ich weder das Talent eines Lionel Messi noch die Fitness eines Christiano Ronaldo habe, ist das in gewisser Weise wahr. Als Leiter einer Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg verdiene ich mein Geld unter anderem damit, täglich mit Kindern und Jugendlichen Fußball zu spielen. Doch ist das nicht alles. Mein Team und ich dürfen sozialbenachteiligte junge Menschen begleiten, ihnen Essen und Kleidung geben, ihnen Nachhilfe vermitteln und ihnen vor allem ganz viel Wertschätzung und Liebe entgegenbringen. Natürlich gehört auch dazu, manche katastrophalen Zustände Zuhause wahrzunehmen und zum Wohle der Kinder zu handeln. Letztendlich geht es darum, die Kinder, die in ihrer Freizeit zu uns kommen, bestmöglich mit ansprechenden Angeboten zu versorgen.
Interessant dabei ist, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen ein gemeinsames Lieblingsangebot haben: Ferienfahrten. Nichts begeistert die jungen Menschen mehr, als wenn wir für ein paar Tage mit ihnen wegfahren. Das müssen keine außergewöhnlichen Ziele sein; es reicht eine einstündige Distanz in die Natur. Wichtig ist, dass es Übernachtungen gibt. Womit wir beim Thema wären: Der Moment auf diesen Freizeiten, in denen es darum geht, dass die Kinder schlafen sollen, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die ich in meinem gesamten Job habe. Die Kids sind müde, sehen das aber anders. Häufig lassen sie dann nicht mit sich reden, sondern wollen einfach wachbleiben – koste es, was es wolle.
So waren wir vor einigen Jahren zusammen auf einem Reiterhof eingeladen. Ein Wochenende lang durften wir mit fünf Jungen und fünf Mädchen im Alter von sieben bis zehn Jahren auf einem Pferdehof in Schleswig-Holstein gastieren. Der erste Tag war super, doch dann kam der Abend. Ich war dafür zuständig, dass die Jungs, die alle in einem Zimmer schliefen, zur Ruhe kamen. Sie hatten andere Interessen. Sie redeten noch weit nach der vereinbarten Zeit in ihren Betten, standen immer wieder auf und hatten nur wenig Lust zu schlafen. Ich hingegen war müde und wollte in mein Zimmer gehen, doch war klar, dass das erst geht, wenn die Jungs schlafen. Also legte ich los: zunächst mit mehrfacher Ermahnung, bitte leise zu sein. Das half jeweils kurz. Und immer kürzer. Irgendwann nahm meine innere Unruhe mehr und mehr zu, so dass ich kurz davor war, drakonische Strafen auszusprechen à la Ihr dürft morgen nicht reiten. Doch widerspricht dies – wie Sie sich mittlerweile sicher denken können – meiner pädagogischen Grundhaltung, würde dies doch die Kids in eine nicht konstruktive Ohnmachtsposition bringen. Also entschied ich mich für einen anderen Weg. Ich klopfte am Zimmer an, betrat es, ging zum Bett des lautesten Jungen und setzte mich davor. Natürlich war in diesem Moment absolute Stille im Raum. Dann sagte ich: »Jungs, ich bin ganz ehrlich: Ich bin müde und möchte schlafen. Was sollte ich tun, damit ihr ruhig seid und ich ins Bett gehen kann?« Daraufhin sagte der Junge – ein Sohn kenianischer Eltern –, der zuvor am lautesten war: »Du musst uns einfach richtig bestrafen!«
Dieses Erlebnis brannte sich mir tief ein. Er – und anscheinend die meisten anderen auch – kannte von Zuhause, dass falsches Verhalten durch Strafen gesteuert wird. Doch das widerspricht meinen Prinzipien zutiefst, weil ich glaube, wie weiter oben besprochen, dass dies nicht nachhaltig ist. Doch was sind gute Erziehungspraktiken? Wie kann man eine solche Situation lösen, wenn nicht mit Drohungen und Sanktionen?
Im ersten Teil haben wir uns mit der Grundhaltung von Erziehung befasst. Dabei haben wir festgestellt, dass dieser erste – unsichtbare – Pfeiler aus dem Menschenbild, den Erziehungszielen und den Erziehungsprinzipien besteht. Diese Haltung wiederum bildet das Erziehungsideal heraus, Kinder freiwillig zu dem zu bewegen, was man als Erwachsener möchte. Doch kann man die schönste Theorie und die besten Annahmen haben, nur werden sie niemandem nutzen, wenn nicht Sichtbares dabei herauskommt.
Die Erziehungspraktiken sind nicht nur der zweite Pfeiler unserer Brücke, sondern sie sind auch der sichtbare Teil von Erziehung und des Erziehungsstils. Durch sie zeigen wir unser Erziehungsverhalten, das das Kind unmittelbar erlebt und spürt. Wenn sich Kinder darüber unterhalten, wessen Eltern die strengsten sind, dann beziehen sie sich nicht darauf, welche das rückständigste Menschenbild oder die utopischsten Erziehungsziele haben, sondern ganz allein, welche die autoritärsten Methoden haben. Und auch wenn wir Erwachsenen von Erziehung sprechen, beziehen wir uns nahezu komplett auf die Erziehungspraktiken.
Und dann stellt sich die Frage: Ist Ihr Handeln geprägt von liebevoller Zuneigung oder eher von ständigen Ermahnungen? Kritisieren Sie ein falsches Verhalten verbal oder greifen Sie zu körperlichen Maßregelungen? Platzt Ihnen leicht der Kragen oder reagieren Sie normalerweise ruhig, wenn Ihr Kind sich danebenbenimmt?
Der sichtbare und der unsichtbare Teil der Erziehung sind eng miteinander verbunden, weshalb die Erziehungspraktiken im Idealfall Rückschlüsse auf die pädagogische Grundhaltung zulassen. An einer Bushaltestelle konnte ich einmal beobachten, wie ein Vater seinen ca. sechsjährigen Sohn auf der Sitzbank herumklettern ließ und ihm nicht verbot, darauf zu stehen. In meiner Nähe, also außerhalb der Hörweite des Vaters mit seinem Sohn, stand ein älteres Ehepaar, das sich zwar leise, aber für mich gut verständlich, darüber echauffierte, warum dieser Mann dem Kind keine Grenzen setze. Der ältere Mann sagte: »Das ist ja wieder typisch für diese jungen Eltern. Erlaubt der dem Jungen mit seinen Dreckschuhen auf die Bank zu klettern. Bei uns hätte es das nicht gegeben, da haben Eltern noch erzogen!« Was hier passierte, war, dass nicht nur die Erziehungspraktik kritisiert wurde, sondern automatisch Rückschlüsse auf die Erziehungsprinzipien, also die erzieherische Grundhaltung gezogen wurden. So wurde vermutlich implizit angenommen, dass eine antiautoritäre Haltung des Vaters Grund dafür sei, dass er den Jungen gewähren lässt. Es wurde also unterstellt, der Vater würde – aus welchen Gründen auch immer – lieber nicht erziehen, statt durchzugreifen. Dass dieser Rückschluss – lässt seinen Sohn auf der Bank klettern, also hat er eine antiautoritäre Haltung – nicht immer stimmt, wird weiter unten deutlich. Doch wird anhand dieser Geschichte ersichtlich, wie sehr uns allen eigentlich bewusst ist, dass der unsichtbare Teil mit dem sichtbaren zusammenhängt.
Deshalb verwundert es nicht, wenn sich Ihre Grundhaltung an vielen Stellen in Ihren Praktiken ausdrückt. Oder sagen wir: Wenn sich Ihre Grundhaltung an vielen Stellen in Ihren Praktiken ausdrücken würde. Denn das ist häufig nicht so einfach, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. Da war die Rede davon, dass die theoretische, unsichtbare Grundhaltung sagt, dass Kinder geliebt werden, so, wie sie sind. Doch auf der praktischen, sichtbaren Ebene wurde dann deutlich, dass das Kind schon erst einmal ein paar Änderungen vornehmen muss, bevor es vollständig geliebt und akzeptiert wird. Doch trotz aller Schwierigkeiten kann man davon ausgehen, dass die unsichtbare Seite der Erziehung sehr stark die sichtbaren Handlungen prägt.
Wenn wir uns nun konkrete Erziehungspraktiken ansehen, die das beschriebene erzieherische Ideal berücksichtigen, müssen wir uns bewusst machen, dass Erziehung nicht gleich Erziehung ist. Man unterscheidet vielmehr zwischen intentionaler und funktionaler Erziehung. Intentionale Erziehung umfasst alle bewusst eingesetzten Erziehungsmaßnahmen. Grundlage hierfür sind die im ersten Teil des Buches erarbeiteten Bestandteile Ihrer erzieherischen Grundhaltungen. Wenn Sie also Strafen und Belohnungen anwenden, dann sind dies Methoden intentionaler Erziehung, denn Sie verfolgen damit eine Intention, eine Absicht. Alle in Kapitel 9 aufgeführten Tools zählen zu dieser Form der Erziehung. Doch ist intentionale Erziehung nur eine Hälfte der Möglichkeiten, Kinder zu prägen. Die andere Hälfte ist die funktionale Erziehung. Diese umfasst alle nicht gezielten Einwirkungen aus der Umwelt, die das Kind prägen und damit ungewollt eine Erziehungsfunktion übernehmen. Hierzu zählen gesellschaftliche Einflüsse, Medien, Trends, aber auch beispielsweise die Gruppe Gleichaltriger, also die Peer-Group. Diese Dinge sind normalerweise nicht bewusst erschaffen worden, um Menschen zu erziehen, doch bewirken sie genau das. Die wohl wichtigste Form funktionaler Erziehung ist die Vorbildfunktion, die eine Bezugsperson hat. Natürlich kann die Person ihren Status bewusst einsetzen, um ein Kind zu prägen (was sehr sinnvoll ist, wie wir gleich sehen werden), aber dass sich Menschen durch Vorbilder prägen lassen, wird durch eine nicht bewusst geschaffene Funktion von Erziehung ermöglicht.
Es lässt sich nicht genau sagen, welche Form der Erziehung nun die wirksamere ist. Denn führt die intentional gesetzte Strafe zur gewünschten Verhaltensänderung oder kommt es nur aufgrund der guten Beziehung zwischen Strafendem und Kind zur Veränderung des Verhaltens, so dass es die Strafe gar nicht gebraucht hätte? Obwohl also die Wirkung der beiden Erziehungsformen nicht abschließend gemessen werden kann, wird zu sehen sein, dass eben jener wichtigste Vertreter der funktionalen Erziehung – die Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind bzw. Jugendlichem – eine unumgängliche Wirkgröße ist. Mit dieser beschäftigen wir uns im folgenden Kapitel.
![]()
8 Das A und O: die Beziehung
Ich sprach einmal vor angehenden Erziehern in der Berufsschule über meine Arbeit. Dabei stellte ich unser Konzept vor und betonte mehrfach die Wichtigkeit einer guten Beziehung. Ich erzählte, dass ich davon überzeugt bin, dass es keine Regeln, Strafen, Drohungen etc. braucht, wenn eine tragfähige Beziehung vorhanden ist. Kurze Zeit später meldete sich ein Schüler und sagte, dass er sich nicht vorstellen könne, wie pädagogische Arbeit allein durch Beziehung und ohne Hilfsmittel wie ein Regelsystem ablaufen könne. Er stellte sich vor, dass es drunter und drüber gehen müsse. Daraufhin meldete sich die Lehrerin und sagte, dass sie selbst früher mit hochaggressiven Jugendlichen in einer sozialen Einrichtung gearbeitet habe. Für sie galt ebenfalls immer Beziehung vor Erziehung. Und dann berichtete sie, dass sie niemals Angst davor hatte, einer ihrer »schweren Jungs« könne ihr etwas antun, da eine Beziehung gewachsen war, die diese Option ausschloss. Ich verstand sehr gut, was sie sagte.
Wenn wir eine tragfähige Beziehung zu Menschen haben, dann vertrauen wir ihnen. Und wenn wir ihnen wirklich vertrauen und vertrauen können, dann lassen sie sich führen. Denn nur wenn wir ihnen vertrauen, kann es dazu kommen, dass sie uns vertrauen und glauben, dass wir es gut meinen. Dass dies nicht immer positiv sein muss, zeigen wiederum viele andere Geschichten. Hitler folgten viele Menschen ebenfalls blind, doch wusste er dieses Faktum zu seinen eigenen Gunsten auszunutzen. Auch an der Spitze vieler Terrororganisationen und Sekten stehen charismatische Persönlichkeiten, die ein solch enges Beziehungsgeflecht gewoben haben, dass ihnen Menschen blind vertrauen – die Führer aber nicht verantwortungsvoll damit umgehen.
Wenn wir im Folgenden von Beziehung und ihrer Rolle für Erziehung nachdenken, dann gehe ich immer von Vorbildern aus, die zum Wohle ihrer Nachfolger handeln und nicht ihre eigenen Interessen schamlos anstreben.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wir nach wie vor eine gute Antwort auf die Frage suchen, wie wir Kinder freiwillig zu dem bewegen können, was wir wollen – und was im Sinne der Kinder und gegebenenfalls der Gesellschaft ist! Wir haben gesehen, dass Belohnungen und Bestrafungen dieses Ideal nicht erfüllen. Nun sind wir an der Stelle im Buch angelangt, wo nachhaltige Lösungen für die besagte Herausforderung aufgezeigt werden sollen. Dabei gilt aber immer, dass wir nicht zuerst danach trachten, kindliches Verhalten »ohne Rücksicht auf Verluste« zu verändern, so wie es uns passt – auch wenn das Kind freiwillig folgt. Vielmehr impliziert das im Folgende beschriebene Vorgehen, dass wir zuerst schauen, warum sich ein Kind verhält, wie es sich verhält. Möchte es uns etwas mitteilen? Geht es ihm nicht gut und das störende Verhalten ist seine Art, dies zu kommunizieren? Erst wenn klar ist, dass kein beachtenswertes Problem vorliegt oder es wirklich keinen rational zu findenden Kompromiss gibt, dann kommen die Erziehungspraktiken zum Einsatz, die eine Verhaltensänderung bewirken wollen. Ich werde dies nicht immer wieder betonen, sondern setze es voraus.
Wenn Sie 100 Sozialarbeiter befragen würden, was der wichtigste Faktor für das Gelingen ihrer Arbeit ist, was wäre wohl die Topantwort? Klare Regeln? Konsequentes Handeln? Gute Angebote? Ich möchte eine These aufstellen: Über 90% aller Befragten würden aussagen, dass eine gute Beziehung zwischen ihnen und ihren Klienten der entscheidende Wirkfaktor ist. Die Wichtigkeit einer guten Beziehung gilt aber nicht nur für die soziale Arbeit, sondern für alle Kontexte, in denen Menschen zusammenleben und -arbeiten: zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Therapeuten und Klienten und selbst im Büro zwischen Chefs und Angestellten. Stimmt die Chemie zwischen den Beteiligten, herrscht Vertrauen vor und – banal gesprochen – finden die Akteure den anderen irgendwie gut, dann ist die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt. Um es in den Worten des Neuroimmunologen Prof. Dr. Schubert zu sagen: »Wenn ich alle Erkenntnisse zusammenfasse, läuft es auf eines hinaus: Menschliche Beziehungen!«18
Wenn Beziehung so wichtig ist, dass wir davon ausgehen können, sie als Lösungsweg zum Erreichen unseres Erziehungsideals zu sehen, dann müssen wir uns intensiver damit befassen. Dies soll nun anhand einiger Fragen ausführlich geschehen.
Was bewirkt Beziehung?
Unser Gehirn ist großartig – und zwar auf sehr vielfältige Weise, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden. Ein erster Aspekt dafür ist, dass es eine Art Zaubertrank mit dem Namen Oxytocin hat. Dieses zauberhafte Hormon bewirkt – ganz ähnlich wie Amors Pfeil –, dass wir andere Menschen lieben, ihnen vertrauen und uns an sie binden möchten. Bereits vor der Geburt wird das Bindungshormon im Kopf der Mutter ausgeschüttet; aber auch der Vater und natürlich das Baby selbst dürfen die Wirkung dieses »Zaubertranks« erleben. Dadurch ist von Geburt an in der Regel natürlicherweise garantiert, dass es eine Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern gibt. Dies ist übrigens lange Zeit so, unabhängig davon, wie die Interaktion geprägt ist: Auch in Fällen, in denen Eltern ihre Kinder schwer missbrauchen, bleibt der Bindungswunsch erhalten. Sehr häufig beschreiben Kinder im Erwachsenalter, die früher Opfer von solcherart Missbräuchen wurden, wie sie in einer inneren Zerrissenheit gefangen waren, weil sie ihre Eltern doch liebten, aber natürlich auch massiv litten. Fast immer richten sie ihre Wut letztendlich gegen sich selbst oder Unbeteiligte. Damit die Eltern verschont werden, erdulden die Kinder häufig das Martyrium still. Kinder wollen ihren Eltern gefallen!
Diese enge Bindung mag in Missbrauchsfällen destruktiv sein, weil der Selbstschutz dadurch erschwert wird, ist im Normalfall aber ein wirklicher Segen. Denn aus der neuronalen Festigkeit der Beziehung folgt eine enorm wichtige Tatsache für Erziehung: der Erwachsene wird zum Vorbild für das Kind.
Dieses Vorbildsein bewirkt, dass Kinder automatisch Dinge nachahmen, die Erwachsene tun. Es ist mitunter erschreckend, wie sehr Kinder das eigene Verhalten spiegeln. Das fängt bei der Sprache an. Unsere Tochter hat mit anderthalb Jahren schon Sätze gesagt, die uns den Spiegel vorgehalten haben, welche Floskeln oder unreflektierten Äußerungen wir anscheinend regelmäßig zum Besten geben. Doch kommt dieses Spiegeln nicht nur bei der Sprache vor, sondern auch im Verhalten. Beispielswei...