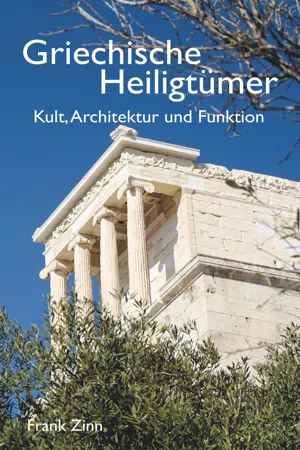![]()
Der griechische Begriff für Heiligtum war hierón, was wörtlich übersetzt nichts anderes als »das Heilige« bedeutet. Es war ein unspezifischer Begriff, der außer für die Örtlichkeit auch für das Opfer, die Kultfeier oder den religiösen Brauch verwendet wurde und auf einen wie auch immer gearteten Bezug zur Sphäre des Göttlichen hindeutet. Für die Griechen war die Welt erfüllt von numinosen Mächten. Götter, Daimonen und Heroen (Sterbliche, die nach ihrem Tode göttergleiche Verehrung empfingen) waren Realitäten, die auf sämtliche Aspekte des öffentlichen und des privaten Lebens starken Einfluss ausübten. An manchen Orten in der Welt empfanden die Menschen die Präsenz des Göttlichen als besonders stark, und solche Orte waren für sie hierá, heilige Stätten. Die Griechen glaubten, diese besondere Aura der Heiligkeit sehr bewusst und intensiv verspüren, sie geradezu sinnlich erfahren zu können.
In seinem Dialog Phaidros (230 b–c) beschreibt Platon eine idyllische Szenerie. Sokrates und seine Begleiter haben sich außerhalb der Mauern Athens unter einer Platane niedergelassen. Wohlgeruch erfüllt den Ort, der Baum spendet kühlenden Schatten und in seiner Nähe fließt das erfrischende Nass einer Quelle. Mit ungewohntem Enthusiasmus lobt der bekennende Stadtmensch Sokrates die Schönheit der natürlichen Umgebung. Dass es sich hier um eine Kultstätte für den Flussgott Acheloos und die Nymphen handelt, schließt Sokrates nur aus dem Vorhandensein von Votivgaben; eine architektonische Ausgestaltung oder eine sonstige eindeutige Kennzeichnung des Sakralbezirks hat es offensichtlich nicht gegeben. Es war ihre außergewöhnliche Atmosphäre, die die Örtlichkeit heilig machte. So konnte auch ein Ortsfremder selbst ohne die geringsten Anzeichen menschlicher Aktivitäten einen Ort als hierón identifizieren. In Sophokles’ Tragödie Ödipus auf Kolonos erkennt Ödipus’ Tochter Antigone einen heiligen Hain allein an der Schönheit der unberührten Natur:
»Doch heilig ist der Ort, das spürt man gleich: er prangt
von Lorbeer, Ölbaum, Wein; ein ungezählter Chor
von Nachtigallen singt tief drinnen holden Lauts.«
In der griechischen Literatur mangelt es nicht an Hinweisen darauf, wie sehr die natürliche Umgebung das religiöse Empfinden beeinflusst. Am klarsten und eindringlichsten hat die antike Sichtweise aber wohl der römische Autor Seneca formuliert: »Kommst du in einen Hain, dicht bestanden mit alten Bäumen, die das gewöhnliche Höhenmaß überschreiten, wird dir der Anblick des Himmels entzogen durch das Gewirr mächtiger, einander verdeckender Zweige, dann wird die Erhabenheit des Waldes, das Geheimnisvolle des Ortes und das Staunen über das dichte, ununterbrochene Schattendach unter freiem Himmel in dir den Glauben an die Gottheit wachrufen. Findest du eine Grotte, die durch zerklüftete, ausgefressene Felsen den Berg bis tief hinein unterhöhlt hat, nicht von Menschenhand geschaffen, sondern durch Naturkräfte in solcher Größe ausgearbeitet, dann wird die Ahnung einer göttlichen Kraft deine Seele erfüllen. Wir verehren die Quellen großer Flüsse als heilige Stätten. Die plötzliche Entstehung eines gewaltigen Stromes, aus dem Unbekannten heraus, lässt uns Altäre gründen. Verehrung finden die heißen Quellen, und manchem stehenden Gewässer hat die schattige Lage oder die unergründliche Tiefe Weihe verliehen.«
Die genannten Beispiele machen hinreichend deutlich, wie wichtig die natürliche Umgebung war, um sich der Heiligkeit eines Ortes bewusst zu werden. Griechische Kultstätten lagen häufig in Hainen, an Quellen oder an Flussmündungen, in Grotten sowie auf markanten Anhöhen oder Berggipfeln (s. u. S. →ff.). Die intensiv wahrgenommene Gegenwart des Göttlichen in der Natur war aber nur ein Kriterium von vielen, das zur Gründung eines Heiligtums an einem bestimmten Ort führen konnte. Das »Wesen« und die Wirkungsbereiche einer Gottheit hatten auf die Lage ihrer Sakralstätten ebenfalls beträchtlichen Einfluss. Beispielsweise lagen die Kultbezirke der Athena Polias und des Zeus Polieus, der »Städtebeschützer«, innerhalb der Stadtgrenzen, Heiligtümer von Natur- und Fruchtbarkeitsgöttern wie Demeter, Pan oder Dionysos oft im fruchtbaren Umland und Hermes, der Gott der Übergänge, wurde an Wegkreuzungen und Grenzen verehrt. Eine wichtige Rolle spielten die mit einem Ort verbundenen Mythen und religiösen Traditionen. So entstanden Kultbezirke an den Begräbnisstätten von Heroen oder an Plätzen, von denen man glaubte, eine Gottheit sei einst dort erschienen oder ihr Wirken habe dort auffällige Spuren hinterlassen. Manchmal wurde der Ort einer Verehrungsstätte durch einen Orakelspruch oder durch eine andere Form göttlicher Willensbekundung vorgegeben. Bei der Ortswahl waren auch immer topographische und kultische Gegebenheiten zu berücksichtigen. Bei der Neugründung eines Heiligtums musste man stets darauf achten, Konflikte zu bestehenden Kulten zu vermeiden. Als der Kult des Heilgottes Asklepios 420 v. Chr. in Athen eingeführt wurde, stand zunächst kein geeigneter freier Platz für eine eigenständige Sakralstätte zur Verfügung. Man brachte ihn daher vorübergehend im Eleusinion, dem städtischen Heiligtum der Demeter und der Kore, unter. Bald schon zog der Gott in den Kultbezirk eines Heilheros um, bis ihm endlich sein eigenes Heiligtum am Südabhang des Akropolisfelsens zugewiesen wurde (Abb. 2). Die Inbesitznahme durch Asklepios verlief indes nicht ohne Probleme. Es kam zu einem Disput mit dem Priestergeschlecht der Keryken, der zu einer Unterbrechung der Baumaßnahmen führte. Der genaue Grund für diesen Streit ist nicht überliefert, aber wahrscheinlich hatte er damit zu tun, dass die neue Kultstätte das Pelargikon, die uralte, in besonderen Ehren gehaltene mykenische Befestigungsmauer, verletzte.
Wie im Falle des Asklepios im Eleusinion wurden in Heiligtümern sehr oft neben der Hauptgottheit, der der Sakralbezirk ursprünglich geweiht worden war, noch weitere Kulte gepflegt. Im Zeus-Heiligtum in Olympia standen drei große Tempel (für Zeus, Hera, Rhea/Kybele) sowie rund 70 Altäre für unterschiedliche Gottheiten bzw. ihre unterschiedlichen Funktionen.
Die Heiligkeit eines Ortes allein machte ihn noch nicht zu einem Heiligtum. Er musste erst in einem Gründungsakt der darin verehrten Gottheit geweiht und übereignet werden. Außerdem mussten die spezifischen Kultvorschriften und andere Regelungen (z. B. zu den Einnahmen) festgelegt werden. Da die griechische Religion nicht institutionalisiert und nicht hierarchisch organisiert war, konnte im Prinzip jeder als Gründer auftreten: der Staat, ein politischer Bund, eine dörfliche Gemeinschaft, eine Gruppe von Personen, die die Verehrung eines bestimmten Gottes oder Heros einte, eine Sippe oder auch eine Einzelperson.
Erster und unerlässlicher Schritt bei der Einrichtung eines Heiligtums war die Festlegung seiner Grenzen. In einem der Gründungsmythen von Olympia legte Herakles für seinen Vater Zeus am Fuße des Kronos-Hügels eine Kultstätte alleine dadurch an, dass er eine Fläche abmaß und sie von dem umliegenden Gebiet abgrenzte (Pindar, Olympische Ode 10, 45f.). Mehr war im Grunde nicht nötig, um einen Platz als Sakralbezirk zu definieren. Dieser Platz galt fortan als abgesondert von der profanen Welt, die ihn umgab. Die Griechen nannten ein solches Areal Temenos (témenos, Plural teménē, wörtlich übersetzt »das Abgeschnittene«), ein Begriff, der über seine spezielle Bedeutung hinaus ganz allgemein ein Heiligtum bezeichnen konnte. Das Temenos konnte von einer Mauer (períbolos) umgeben sein, die manchmal sogar Festungscharakter besaß, oder wurde mit Grenzsteinen (hóroi) abgesteckt; allerdings war eine sichtbare Markierung nicht zwingend notwendig. Der Kultbezirk war menschlichem Zugriff entzogen und ging in den Besitz der Gottheit über. Die Kultstätte und alles, was sich darin befand, waren somit sakrosankt; nichts durfte fortan entfernt oder bedenkenlos verändert werden.
Die Unverletzlichkeit des göttlichen Besitzes erstreckte sich auf Bauten und Gegenstände, Tiere und Pflanzen, ja sogar auf nistende Vögel und das Laub der Bäume. Auch Menschen, die im Heiligtum Zuflucht gesucht hatten, genossen göttlichen Schutz. Jeder Verstoß bedeutete ein schweres Sakrileg, das nach menschlichem und göttlichem Recht geahndet wurde. Die Androhung selbst schlimmster Strafen wirkte freilich nur bedingt abschreckend. Immer wieder sind Heiligtümer geplündert und sind die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten worden. Nicht nur einfallende »Barbaren«, sondern auch die Griechen selbst und der griechischen Kultur nahestehende Völker haben sich solcher Sakrilege schuldig gemacht. Die Römer betrieben in den unter ihrer Kontrolle stehenden Städten und Kultstätten Griechenlands einen systematischen Kunstraub. Kaiser Nero beispielsweise soll zur Ausschmückung seiner Bauvorhaben nicht weniger als 500 Statuen aus dem delphischen Heiligtum des Apollon fortgeschafft haben (Pausanias 10, 7, 1).
Die religiösen Traditionen und Gebote waren stark und bindend. Die Weihung eines Heiligtums wurde prinzipiell als ein Akt für die Ewigkeit verstanden. Allerdings konnte aufgrund besonderer Umstände – wie gewaltsame Zerstörungen, Naturkatastophen, wirtschaftliche Notlagen, Bevölkerungsschwund, Umsiedlungen – die Kultausübung an einem Ort zum Erliegen kommen. Diese heiligen Stätten gerieten dann in Vergessenheit oder ihre Kulte wurden an anderer Stelle neu eingerichtet. Außergewöhnlich war die Verlagerung ganzer Sakralarchitekturen an einen neuen Aufstellungsort. Auf der Athener Agora, dem zentralen öffentlichen Platz der Stadt, fand man bei den Ausgrabungen Reste von Bauten, die erst im späten 1. Jh. v. Chr. von ihren ursprünglichen Aufstellungsorten im attischen Landgebiet nach Athen versetzt worden waren; darunter der Tempel des Kriegsgottes Ares, der vorher in Pallene gestanden hatte. Die Kulte waren in ihren Heimatgemeinden nicht mehr gepflegt worden und sind dann, wohl unter Einfluss der konservativen Religionspolitik des Kaisers Augustus, auf die Agora übergesiedelt worden.
Für ein Heiligtum war nicht nur die Festlegung des Temenos unverzichtbar, sondern auch das Vorhandensein eines Altars. Ohne einen Altar hätten die zentralen Kulthandlungen nicht durchgeführt werden können. An ihm wurden die vorgeschriebenen Riten – insbesondere das Opferritual – vollzogen. Altäre wurden ephemer oder dauerhaft in unterschiedlichem Format und aus unterschiedlichen Materialien errichtet (s. u. S. →ff.).
Sehr wichtig für den Betrieb eines Heiligtums war der Zugang zu frischem, sauberem Wasser. Wasser wurde nicht nur für die Sauberhaltung des heiligen Bezirks, für die Hygiene, für die Zubereitung ritueller Mähler und für die Trinkwasserversorgung des Kultpersonals und der Besucher benötigt. Es war auch für die Durchführung ritueller Handlungen (z. B. das Besprengen der Opfertiere) und für die rituelle Reinigung unverzichtbar. Reinheit war im griechischen Kultwesen von herausragender Bedeutung. Schon der frühgriechische Dichter Hesiod (Werke und Tage 723ff.) mahnte eindringlich, dass die Götter die Bitten derjenigen zurückweisen, die es versäumen, sich vor dem Opfer die Hände zu waschen. Zur Reinigung standen in den Heiligtümern u. a. steinerne Wasserbecken (perirrhantêria) zur Verfügung, die nicht selten eine beachtliche Größe hatten und aufwendige Verzierungen tragen konnten. Zu einer Verunreinigung führte vor allem der Kontakt mit Blut und mit Toten. Daher war Gebärenden und Sterbenden der Zutritt zu Heiligtümern in der Regel untersagt; aber auch der Vollzug des Liebesaktes war nicht gestattet. Wie streng diese Verbote gehandhabt wurden, veranschaulicht das Beispiel der Insel Delos. Auf dem winzigen Eiland, der Geburtsstätte des Apollon, befand sich eines ...