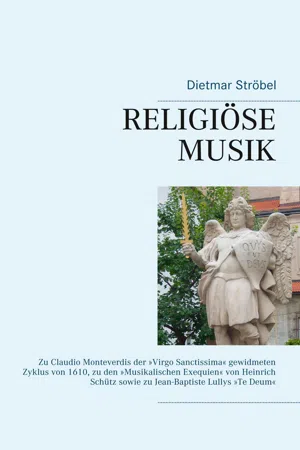
eBook - ePub
Religiöse Musik
Zu Claudio Monteverdis der »Virgo Sanctissima« gewidmeten Zyklus von 1610, zu den »Musikalischen Exequien« von Heinrich Schütz sowie zu Jean-Baptiste Lullys »Te Deum«
- 204 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Religiöse Musik
Zu Claudio Monteverdis der »Virgo Sanctissima« gewidmeten Zyklus von 1610, zu den »Musikalischen Exequien« von Heinrich Schütz sowie zu Jean-Baptiste Lullys »Te Deum«
Über dieses Buch
In den fünf Kapiteln dieses Buches mit über 85 Notenbeispielen geht es um Monteverdis Marienzyklus von 1610 mit der sog. »Marienvesper« (samt Messe), um Schützens »Musikalische Exequien« von 1636 und schließlich um Lullys »Te Deum« von 1677, zusammengefasst: um Vokalmusik des 17. Jahrhunderts unter dem Blickwinkel der menschlichen Äußerungsform SINGEN. Beschrieben und interpretiert werden die drei als exemplarische Entwürfe für ein Singen als je gemeinschaftlicher Ausdruck einer persönlichen Religiosität. Doch werden darin auch die unterschiedlichen und quasi nationalen Wege und Ziele der implizierten Selbsttätigkeit in Glaubenssachen deutlich, die wir als Selbstbehauptung, Selbstvergewisserung und Selbstrepräsentation fassen können.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Religiöse Musik von Dietmar Ströbel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medien & darstellende Kunst & Musik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
I
»MARIA – FELIX PORTA COELI«
Zu Monteverdis sog. »Marienvesper« im Marienzyklus
von 1610
Mit dem Datum 16102 erschien in Venedig Monteverdis Marienzyklus im Druck. Die sieben Stimmbücher und die „partitura“ (= die unbezifferte Generalbassstimme für die Orgel mit teilweisen Eintragungen zu Stimmeinsätzen) enthalten die sechsstimmige Messe „In illo tempore“, Stücke zu einer Quasi-Vesper (= der sog. Marienvesper) mitsamt dem Magnificat in zwei Entwürfen, einem für sieben Vokalstimmen und sechs Instrumente3 und einem für sechs Stimmen und Generalbass.4
Im Einzelnen enthält der Druck folgende Stücke:
| »Missa da capella a sei voci, fatta sopra il motetto In illo tempore del Gomberti…«5 | [Kyrie] [Gloria] [Credo] Cucifixus Et in Spiritum sanctum | [6-st.] [6-st.] [6-st.] a 4 vocibus a 6 |
| [Sanctus mit Benedictus] [Agnus Dei] | [6-st.] [6-st.] [2. = 3.] Agnus Dei „a 7“ | |
| »Vespro della beata Vergine / da concerto, composto sopra canti fermi«6 | [Deus in adiutorium]/Domine ad adiuvandum Dixit Dominus [Psalm 109/110] | Sex vocib[us] & sex Instrumentis, si placet Sex vocib[us] & sex Instrumentis / Li Ritornelli so ponno sonare & anco tralasciar secondo il volere |
| Nigra sum | Motetto ad una voce | |
| Laudate pueri [Psalm 112/113] | à 8 voci sole nel Organo | |
| Pulchra es | A due voci | |
| Laetatus sum [Psalm 121/122] | A sei voci | |
| Duo Seraphim | Tribus vocibus | |
| Nisi Dominus [Psalm 126/127] | A dieci voci | |
| Audi coelum | Sex vocibus | |
| Lauda Jerusalem [Psalm 147/147, 12 ff.] | A sette voci | |
| Sonata sopra San[c]ta Maria Ora pro nobis | à 8 [Instrumente] + Parte che canta sopra la sonata à 8 [= Cantus] | |
| Ave maris stella /Hymnus | à 8 2., 3. A 4 / 4., 5. Ad una voce soprano / 6. Tenore solo / 7. Sit laus à 8. Senza ritornello inanti Ritornello à 5 | |
| Magnificat / Septem vocibus, & sex Instrumentis | [Magnificat in 12 Abschnitten] | (Bassus generalis = Orgel: durchgehend mit Registrieranweisungen) |
| Magnificat a 6 voci | [Magnificat in 12 bzw. 13 Abschnitten] | (Bassus generalis = Orgel: durchgehend mit Registrieranweisungen) |
Sicherlich „kennt“ man daraus vor allem die sog. Marienvesper oder den ersten der Magnificat-Entwürfe; man hat sie, wenigstens in Teilen, im Laufe seines Lebens öfters gehört, vielleicht sogar einmal als konzertante Aufführung erlebt. Und doch lässt vielleicht erst eine Begegnung mit dieser Musik im Alter einen mit fast ohnmächtiger Bewunderung und mit vielen Fragen zurück. Es erscheint unglaubhaft, dass diese Musik als eine per se liturgische entstanden sein sollte; und es erscheint (mir) ebenso unglaubhaft, dass Monteverdi sie gleichsam per se (und als eine Art Bewerbung für einen Gunstbeweis in Rom etwa) komponiert haben sollte. Wer aber in den Ausgaben und in der Literatur ebenso wie in den oft ausführlichen Kommentaren zu Einspielungen nach Aufklärung über das Selbstverständnis dieser Musik sucht, der stößt fast ausnahmslos auf Versuche, sie als eine liturgische Musik für eine „Vesper“ im ausdrücklichen Sinn zu verstehen und entsprechend zu „bearbeiten“: durch Umstellung von Teilen und/oder durch Hinzufügung von Antiphonen (zu den Psalmen).7 Erst in Helmut Huckes bemerkenswertem Beitrag vom Musikwissenschaftlichen Kongress 19818 findet er Einsichten, mit denen er sich das Vorliegende einigermaßen plausibel machen kann. Doch wären auch diese – Hucke handelt nur von den Psalmen und Concerten der sog. Vesper – in Bezug zum gesamten Druck ergänzungsbedürftig.
Offensichtlich ist es auch nicht selbstverständlich, zur sog. Marienvesper einen gültigen bzw. brauchbaren Notentext zu finden. „Brauchbar“ meint: entweder brauchbar für die Dokumentation des von Monteverdi Hinterlassenen oder brauchbar für das Aufführen bzw. Hören. Denn der sehr spärlich überlieferte Druck Monteverdis ist für die Ausführung – wer genau soll wo singen oder spielen? – und für die Ordnung des Ganzen eher fragmentarisch gehalten. Dies mag z. T. einer selbstverständlichen Freiheit der Ausführenden (in dieser Zeit) entsprechen, wirft aber im Zusammenhang dieses Zyklus vermeintlich das Problem auf, wie das im Druck Vorgelegte überhaupt zu verstehen wäre. Gleichzeitig geben aber Gesamttitel und Einzeltitel (scheinbar) ebenfalls Rätsel auf.
Neben einem 1992 in Belgien erschienen Faksimile (vgl. Whenham9, S. 121), mit dem nur Spezialisten arbeiten können, bietet (nach Whenham, S. 4) Jerome Roche’s Ausgabe in der Edition Eulenburg (No. 8024, London etc. 1994) einen verlässlichen Notentext; für die Messe ist die Ausgabe H. F. Redlichs (ebenfalls bei Eulenburg) hinzuzuziehen. Anderseits mag die von Walter Goehr bei der UE Wien (1956) herausgegebene Partitur der Vespro della Beata Vergine das Herrichten einer Dirigierpartitur für eine konkrete „Aufführung“ anschaulich machen. Eine solche entspricht ja dann auch im Prinzip den (älteren) Einspielungen, wie die von Jürgen Jürgens in der Reihe DAS ALTE WERK (Telefunken). Solche Aufführungen fügen aber den Psalmen – wie gesagt – noch Antiphonen hinzu, um sie im Sinne einer Vesperliturgie zu vervollständigen.
Zum Selbstverständnis der sog. »Marienvesper« und unserer
Darstellung
Darstellung
Hucke interpretiert die in der obigen Aufstellung angemerkten Innentitel als (hinzugefügte) Hinweise des Druckers, der hier den Beginn eines neuen „Teils“ kenntlich machen wollte. Maßgebend sei der Gesamttitel:
SANCTISSIMAE / VIRGINI / MISSA SENIS VOCIBUS / AD ECCLESIARUM CHOROS / Ac Vespere pluribus decantandae / CUM NONNVLLIS SACRIS CONCENTIBUS,/ ad Sacella sive Principum Cubicula accommodata./ OPERA / A CLAUDIO MONTEVERDE / nuper effecta / AC BEATISS. PONT. MAX. CONSECRATA./ Venetijs, Apud Ricciardum Amadinum./ MDCX
Gemäß diesem sei das SANCTISSIMAE VIRGINI als eine Art Zueignung an die Gottesmutter, nicht aber als eine liturgische Zuweisung zu verstehen.
(1) Monteverdis Druck von 1610 versammelt »Stücke« zu einem der Virgo sanctissima gewidmeten Tag.
Wir sehen auch, dass der weitere Titel nur die Messe für die kirchliche Liturgie, ohne Festlegung auf ein Fest bestimmt.10 Die „Vespergesänge“ aber – wir sehen sie in der Typographie wesentlich zurückgenommen (wie eine Nebensache) – werden als Komposition für eine höfische Andachtsmusik bezeichnet. Hinzu kommt die bemerkenswerte Anlehnung an den Orfeo im Einleitungsstück („Domine ad adiuvandum me“), das wir hier aber nicht als „Signal“ (wie Hucke andeutet), sondern eher als tatsächliche Eröffnung (im Sinne eines Prologs) anzusehen hätten.
Dass und wie aus der Vesper als „Chorgebet“ der Hofkapelle eine Art geistliches höfisches Festspiel wird (was Hucke ausführlich erörtert), auch dies wäre für uns ein Vorgang einer Aneignung, an der Monteverdi mit diesem Entwurf teilhat und mit der der Hof von Mantua nicht alleine steht. „Den festlichen Komödien, Intermedien, Balletten, Opern wird ein geistliches Festspiel zur Seite gestellt.“ Und dies, die Transposition der Vesper in eine repräsentative musikalische Veranstaltung, meint Hucke (S. 299), sei für die oberitalienische Entwicklung bezeichnend.
(2) Die sog. Marienvesper verwendet u. a. eine den Vespergottesdiensten zugeordnete Psalmenreihe für eine Art „Handlung“.
Die von Monteverdi für dieses Festspiel – wir bleiben vorläufig bei diesem Begriff, auch wenn wir zu der Überzeugung kommen werden, dass die sog. Marienvesper wohl nicht als real zu inszenierendes „Spiel“ gedacht war –, die für dieses „Spiel“ also herangezogenen Texte der Concerte oder Solomotetten erscheinen (nach Hucke) extra für diesen Zweck bearbeitet und zwischen die Psalmen gesetzt, die ihrerseits eine gute Grundlage für eine inhaltliche Folge abgäben11:
„Das Rückgrat der Vesper sind die fünf Psalmen. Dass Monteverdi die Psalmenreihe an Marien- und Jungfrauenfesten wählt, ist ebenso wie sein Ex voto Sanctissimae Virgini und wie die Schlussbitte im letzten Concerto Audi caelum, in der Maria geradezu anstelle des Heiligen Geistes erscheint[…] Zeugnis barocker Marienfrömmigkeit. Überdies ist die Psalmenreihe mit dem Psalm 126, Nisi Dominus aedificaverit domum und mit Psalm 147, Lauda Jerusalem Dominum am Schluss, in dem sich Jerusalem als Gleichnis des irdischen Staats verstehen lässt, für ein höfisches Festspiel weit besser geeignet, als es die Psalmenreihe an Sonntagen und Herrenfesten gewesen wäre.“
Die vermutete inhaltliche Folge aber ist je von der inhaltlichen Deutung der Concertotexte wie auch der Psalmen selbst abhängig. Solche Deutung bewegt sich in einem großen Spielraum, der von der kirchlichen Tradition ebenso wie von mittelalterlichen Spekulationen und zeitgenössischen theologischen Interpretationen ausgefüllt ist.12 Gemäß Hucke und unserem eigenen Verständnis könnte das Thema des Festes die Verbindung von Staat (→ Jerusalem als Sinnbild des himmlischen Staates) und Kirche (→ Jerusalem als Symbol der Kirche) sowie des konkreten Mantua und der göttlichen Trinität sein, vermittelt und personifiziert in Maria (die ja auch selbst als Symbol der Kirche gedeutet wird13). Aber dies wäre in unserer Beschreibung noch zu konkretisieren.
„Es ist offensichtlich,“ so Hucke (S. 304), „dass die Texte der Concerti sorgsam ausgewählt sind und einen Zusammenhang zwischen den Psalmen herstellen.“ Die Concerti „fügen die Psalmen zu einem Libretto zusammen“. Für uns erscheint vorläufig wichtig, dass das, was das Hören (im Falle zumindest des Autors hier) von sich aus vermuten lässt, tatsächlich feststellbar ist: eine „Handlung“; wir werden diese bei der Erörterung der einzelnen Stücke näher anzudeuten versuchen. Die Frage aber – und darüber spricht Hucke nicht – ist für uns: „Wer“ singt hier? Und: Wie gehören diesem Singen etwa die „Sonata“ und der Hymnus (in dieser Reihenfolge!) zu?
(3) Die sog. Marienvesper ist „Geistliche Musik“ (u. d. h. nicht von vornherein „Kirchenmusik“); sie hat etwas mit dem Mantuaner Hof zu tun.
Im folgenden gehen wir davon aus, dass diese Musik (trotz ihrer Widmung an den Papst) nach Mantua gehört. Auffallend ist die Nähe des Singens zu den gleichzeitig entstandenen Mantuaner Opern; und naheliegend ist, dass diese Musik für einen oder (in ihren Teilen) mehrere Mantuaner Anlässe entworfen wurde.
Fraglich bleibt, ob die sog. Marienvesper je als solche realisiert wurde und ob sich in ihr der Hof in Mantua und der Herzog in „geistlichen Dingen“ in analoger Weise wie in den Opern erleben wollten.14 Offen bleibt weiterhin – obwohl die Arbeit in den einzelnen Sätzen (und nicht nur in den sog. „Concerten“) auf eine Personalisierung der Singenvorstellung weist –, ob die „Satzfolge“ einer „Theologie“ Monteverdis sich verdankt. Annehmen können wir: Hier sprechen (im Ansatz) sich Personen aus; hier geht es nicht (mehr) allein um das Aussprechen von Text (durch Menschen). Im jeweiligen Satz und „Aussprechen“ erscheint (mir) eine besondere sekundäre Intentionalität mitkomponiert.15
Es ...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Über »Religiöse Musik« – ein Vorwort
- I. »Maria – felix porta coeli« – Zu Monteverdis sog. »Marienvesper« im Marienzyklus von 1610
- II. »Der Glaube und das Wort sind die Flügel, die uns zum Himmel tragen« – Zur Quasi-Messe in den Musikalischen Exequien von 1636 von Heinrich Schütz
- III. Was dem einen das Tönen der Stimme, das ist dem andern die Artikulation des „Wortes“ – Zu den emanzipatorischen Tendenzen in den Zyklen von Monteverdi und Schütz
- IV. »Salvum fac populum tuum, Domine« – Zu Jean-Baptiste Lullys »Te Deum« von 1677
- V Die »Arbeit« mit der musikalischen Artikulation – Das Gotteslob als konstruktiver Umgang mit dem „eigenen Gott-Loben“ in Lullys »Te Deum«
- Ergänzendes Resümee
- Materialien
- Zum Autor
- Hinweis
- Impressum