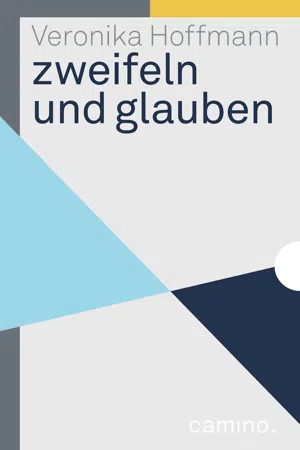![]()
1. Warum »Glauben Sie an Gott?« manchmal die falsche Frage ist
»Noch glauben« und »nicht mehr glauben«?
»Glauben Sie an Gott?« – Es gibt inzwischen ziemlich viele Umfragen, die diese und andere Fragen zu unserer religiösen Orientierung gestellt haben. Das religiöse Feld in Europa ist insgesamt religionssoziologisch gut ausgeleuchtet. Dabei scheint mindestens ein Ergebnis unbezweifelbar: Immer weniger Menschen glauben heute an Gott oder Göttliches oder bezeichnen sich in anderer Weise als religiös – die angebliche »Wiederkehr der Religion« hat daran bislang nichts geändert.3
Das gilt freilich in dieser einfachen Form nur für Westeuropa. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass Religion ein zu komplexes Feld ist, als dass man allzu pauschal angebliche »globale Trends« beobachten könnte – dazu gleich mehr. Zumindest in Europa scheint es aber so zu sein: Es gibt Menschen, die »noch« glauben oder sich als religiös verstehen. Und es gibt mehr und mehr Menschen, die es »nicht mehr« tun. Eine solche Rede von »noch« und »nicht mehr« lädt zu einer Bewertung ein, die freilich sehr verschieden ausfallen kann. Beispielsweise: Die »noch Glaubenden« sind die Beständigen, die an Bewährtem festhalten, gegen den Orientierungsverlust derer, die »nicht mehr« glauben. Oder aber: Die aufgeklärte Selbstbestimmung derer, die sich von einer überholten Religiosität emanzipiert haben, steht gegen eine rückwärtsgewandte Beharrung solcher, die an ihr festhalten.
In kirchlichen Kreisen herrscht nicht selten das deprimierte Gefühl: Früher waren die großen Mehrheiten bei uns, jetzt werden wir zur Minderheit. Das kann zur Selbstbeschuldigung führen: Wir machen etwas falsch, weil die Menschen nicht mehr zu uns kommen. Oder man beschuldigt andere: Die heutige Gesellschaft ist schlecht, weil sie den Wert des Glaubens nicht mehr erkennt.
Ich möchte behaupten, dass diese Umfragen und ihre instinktiven Wertungen uns ein wenig in die Irre führen. Das heißt natürlich nicht, dass die Zahlen nicht stimmten, die den Rückgang von religiösen Überzeugungen und Praktiken belegen. Sie stimmen, jedenfalls wenn man nach Westeuropa schaut. Meine Behauptung ist: Der Vergleich zwischen »früher« und »heute« (wobei noch zu klären ist, was »früher« genau heißen soll) funktioniert nur bedingt, weil »glauben« »heute« und »früher« nicht dasselbe bedeutet. Es geht nicht einfach um veränderte Zahlen. Die Veränderung ist tiefergehend und betrifft alle: die Glaubenden und die Nichtglaubenden – und die, die sich in dieser Unterscheidung gar nicht einordnen können.4 (Warum auch die Grundunterscheidung Glaubende – Nichtglaubende heute schwierig ist, wird im Lauf des Kapitels noch zur Sprache kommen.)
Wer heute glaubt, glaubt anders als die Jünger zur Zeit Jesu, anders als eine Bäuerin im Europa des 14. Jahrhunderts, anders als noch die Karmelitin Thérèse von Lisieux in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Andersheit wird durch Fragen wie »Glauben Sie an Gott?« eher verdeckt. Denn das suggeriert, dass sich nur die einen verändert hätten: Sie sind weggegangen, beispielsweise aus der Kirche ausgetreten, haben ihren Glauben aufgegeben. Aber schon das ändert die Lage auch für die, die »noch glauben«. Für manche von ihnen ist es schwerer geworden zu glauben, weil das Umfeld dem Glauben nicht mehr so freundlich gesinnt ist. Andere hingegen mögen ihren Glauben mehr als ihren eigenen, ganz persönlichen, empfinden, weil er nicht mehr selbstverständlich von allen geteilt und sozial erwartet wird. Schon hier zeichnet sich ab, dass die Veränderung in Sachen Glauben nicht nur eine quantitative ist, sondern sich auch die Weise geändert hat, wie man glaubt – oder nicht glaubt.
Die These lautet also: In Sachen Religion hat sich etwas für alle verändert. Diese Veränderungen liegen gewissermaßen vor Fragen wie »Glauben Sie an Gott?« und werden von ihr deshalb nicht richtig erfasst. Man muss hinter die Frage zu diesen tiefer liegenden Veränderungen zurückgehen, zu den gemeinsamen Bedingungen, unter denen heute in der einen oder anderen Weise geglaubt oder nicht geglaubt wird. Das ist nicht ganz unkompliziert, wie sich im Folgenden zeigen wird. Aber es lohnt sich, nach diesen geänderten Bedingungen zu schauen, wenn man die heutige religiöse Landschaft verstehen will.
Wer von »geänderten Bedingungen« spricht, muss mindestens zweierlei erklären: Geändert im Vergleich zu wann? Wann also war dieses »Früher«? Und geändert in welcher Weise? Was unterscheidet »heute« von »früher«? Um das zu erläutern, greife ich auf Analysen des kanadischen Philosophen Charles Taylor zurück.5 Seine Überlegungen bilden den Hintergrund für alles Weitere in diesem Buch. Wir können hier allerdings nicht sein umfangreiches Werk in allen Aspekten betrachten. Ich werde nur zwei Stichworte herausgreifen: sein Verständnis unserer Gegenwart als eines »säkularen Zeitalters« und seine Beobachtung einer »Kultur der Authentizität.«
»Säkular« oder »postsäkular«?
Nun drängt sich ein Verdacht auf. Ist es nicht Schönfärberei zu behaupten, die Veränderungen in der religiösen Landschaft seien nicht adäquat erfasst, wenn man schlicht von einem Rückgang von Religion spricht, sie lägen tiefer? Immerhin sprechen die Statistiken schon lange eine eindeutige Sprache: Die Zahl derer sinkt, die sich als religiös verstehen und das auch praktizieren. Sollte man das nicht einfach anerkennen? Wird hier nicht eine Umdeutung vorgenommen: Wenn die Statistiken gegen uns sind, dann erklären wir sie eben für nicht relevant? Das mag Balsam sein für Kirchenverantwortliche, die gegenüber Mitgliederschwund und Traditionsabbruch bisher weitgehend hilflos sind. Aber ist das nicht Realitätsverweigerung? Unsere Gesellschaft ist, so scheint es, eindeutig eine säkulare, die immer noch säkularer wird.
Man kann aber auch umgekehrt fragen: Leben wir überhaupt in einer »säkularen Gesellschaft«? Das ist durchaus nicht unumstritten. So hat der Philosoph Jürgen Habermas in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2001 von einer »postsäkularen Gesellschaft« gesprochen.6 Das sei »von der deutschen Öffentlichkeit einhellig als Sensation wahrgenommen«7 worden, vermerkt dazu der Soziologe Hans Joas. Das Sensationelle rührt daher, dass Habermas nicht nur sich selbst bis dahin immer als »religiös unmusikalisch« bezeichnet hat. Er sah auch in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft keinen Ort mehr für Religion. Jetzt aber betrachtet Habermas unsere Gesellschaft als »postsäkular« und meint damit, dass sie sich »auf das Fortbestehen religiöser Gemeinschaften in einer sich fortwährend säkularisierenden Umgebung einstellt«8. Religion werde also auch in den westlichen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts ein Faktor bleiben.
Die Basis für die frühere Annahme einer »säkularen Gesellschaft« bei Habermas und anderen war die klassische sogenannte »Säkularisierungstheorie«. Diese These war lange Zeit gesellschaftliches Allgemeingut. Im Kern lautet sie: Je moderner eine Gesellschaft wird und je aufgeklärter ihre Mitglieder sind, desto geringer wird die Bedeutung von Religion, bis sie schließlich nur noch in Restbeständen existiert oder ganz verschwindet.9 Religion war früher wichtig, aber alle ihre Aufgaben werden heute von anderen Instanzen übernommen. Religion diente beispielsweise dazu, Phänomene zu erklären, die wir heute naturwissenschaftlich erklären. Sie stiftete gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber spätestens seit den reformatorischen Spaltungen des Christentums in Europa war Religion auch Motor gesellschaftlicher Spaltung. Als gemeinsame Basis einer Gesellschaft kann sie heute nicht mehr fungieren. Religion gab und gibt Menschen moralische Orientierung, aber auch hier ist sie nicht unersetzlich. Man kann auch moralisch sein, ohne an Gott zu glauben. Sie spendet Trost im Leid und angesichts des Todes. Aber sollte man das Leid nicht besser bekämpfen, statt es einfach zu akzeptieren, und spricht es nicht sogar gegen die Existenz Gottes? Aus all dem ergab sich die scheinbar logische Folgerung: Religion und Moderne, Religion und naturwissenschaftliche Weltsicht, Religion und ein demokratischer, toleranter Staat passen nicht zusammen. Die gesellschaftliche Entwicklung wird deshalb dazu führen, dass Religion nach und nach aus dem öffentlichen und dann auch aus dem privaten Bereich verschwindet.
Das ist eine sehr vergröberte Darstellung der Säkularisierungsthese, aber in dieser grundsätzlichen Stoßrichtung war sie einige Jahrzehnte lang Standard in der religionssoziologischen Forschung. Außerhalb der Wissenschaft wird sie immer noch viel vertreten, aber unter Wissenschaftlern hat sie inzwischen massiv an Zustimmung verloren. Denn ein einliniger und zwingender Zusammenhang zwischen Prozessen der Modernisierung und abnehmender Religiosität lässt sich empirisch nicht nachweisen. Noch nicht einmal die Behauptung abnehmender Religiosität an sich, mit der das Kapitel begann, lässt sich erhärten, wenn man nicht nur auf Westeuropa schaut. Die Verhältnisse sind schlicht in verschiedenen Ländern mit ihrer je verschiedenen Geschichte, verschiedenen politischen Lage und verschiedenen religiösen Traditionen und Institutionen sehr verschieden. Joas fasst die neueren Forschungen so zusammen: »Trotz aller weiteren Verbreitung von Industrialisierung, Urbanisierung und Bildung in den letzten Jahrzehnten haben alle Weltreligionen in diesem Zeitraum ihre Vitalität erhalten oder gesteigert. Die wichtigen Ausnahmen sind bekannt: In einigen kommunistischen Ländern war die totalitäre Unterdrückung des religiösen Lebens erfolgreich, und die Folgen halten bis heute an; in weiten Teilen Westeuropas und einigen ex-kolonialen Siedlergesellschaften (wie Neuseeland und Argentinien) spielt sich spätestens seit den 1960er Jahren ein schleichender und nicht-erzwungener, langgezogener Abbau religiöser Bindungen ab. Aber es wäre eine gänzlich eurozentrische Perspektive, aus diesen Tatsachen auf einen globalen Trend zu schließen. Noch nicht einmal für alle Gesellschaften Europas träfe die Behauptung zu, sie scheiterte spektakulär am Fall der USA.«10
In den Augen von Joas und anderen ist die Säkularisierungsthese deshalb falsch. Religion ist, global gesehen, nicht im Rückgang begriffen, und es gilt auch nicht, dass ein Land umso säkularer wäre, je moderner es ist. Die Zusammenhänge sind viel komplexer. Wenn man von »postsäkular« spreche, könne das deshalb nicht eine veränderte Situation bezeichnen, sondern nur eine veränderte Einschätzung der Situation: »›Postsäkular‹ drückt dann nicht eine plötzliche Zunahme an Religiosität nach ihrer epochalen Abnahme aus – sondern eher einen Bewusstseinswandel derer, die sich berechtigt gefühlt hatten, die Religionen als moribund zu betrachten.«11 Wer wie Habermas von »postsäkular« spreche, fordert Joas, solle stattdessen besser zugeben, dass die Säkularisierungsthese eine religionssoziologische Fehldiagnose war.
Ein »säkulares Zeitalter«
Geänderte Bedingungen des Glaubens
Dass die klassische Säkularisierungsthese fragwürdig geworden ist, heißt aber nicht, dass wir in keinem Sinn in einem »säkularen Zeitalter« leben. Denn wir müssen auch fragen, was mit »Säkularität« überhaupt gemeint sein soll. Der Begriff kann sich nämlich auf sehr Verschiedenes beziehen. Das trägt dazu bei, dass die Debatte ziemlich unübersichtlich ist.12 Der kanadische Philosoph Charles Taylor unterscheidet drei Bedeutungen von »Säkularität«, wobei seine eigenen Überlegungen sich vorrangig auf die dritte Bedeutung beziehen.
Ein erstes Verständnis von Säkularität ist uns gerade schon begegnet: Häufig wird unter einer »säkularen Gesellschaft« eine verstanden, in der die Zahl der Menschen, die sich als religiös verstehen, im Rückgang begriffen ist. Gemäß Joas »Ausnahmen« sind v.a. Westeuropa und in besonderer Weise bekanntlich Ostdeutschland in diesem Sinn säkular.
Man kann »Säkularität« zweitens im Blick auf den Staat als einen »säkularen Staat« verstehen. So gibt es z.B. in Deutschland keine Staatsreligion. Und staatliche Schulen bieten zwar konfessionellen Religionsunterricht an, aber man muss an ihm nicht teilnehmen, es gibt Alternativen. Diese zweite Bedeutung von Säkularität hat mit der ersten nicht unbedingt etwas zu tun: Ein in der zweiten Bedeutung des Wortes säkularer Staat kann problemlos hochreligiöse Bürger haben, sodass dieser Staat in der ersten Bedeutung des Wortes nicht säkular wäre.
Wenn Taylor noch eine dritte Bedeutung von »Säkularität« einführt, tut er dies nicht in Konkurrenz zu den ersten beiden und meint damit auch nicht etwas völlig anderes. Es gibt durchaus Verbindungen zwischen den verschiedenen Begriffsverwendungen. Aber er will Zusammenhänge beschreiben, die mit den ersten beiden Bedeutungen noch nicht im Blick sind. Seine Begriffsverwendung ist etwas ungewöhnlich, weil »säkular« in diesem dritten Verständnis nicht einfach der Gegenbegriff zu »religiös« ist. Es bezieht sich vielmehr auf den gemeinsamen Rahmen, in dem sich heute alle Weltanschauungen bewegen, religiöse und nichtreligiöse. Dieser Rahmen ist heute »säkular« und war es früher nicht. »Säkularität« in der dritten Bedeutung des Wortes bezeichnet damit das von uns angezielte Gebiet »vor« der Frage »Glauben Sie an Gott?«. Die Entwicklung, die Taylor untersucht und die zu dieser dritten Bedeutung von Säkularität führt, beschreibt er in einem viel zitierten Passus in der Einleitung von Ein säkulares Zeitalter so:
»Der Wandel, den ich bestimmen und nachvollziehen möchte, ist ein Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben anderen ist. Es mag mir zwar undenkbar vorkommen, den eigenen Glauben fallenzulassen, doch es gibt auch Menschen, zu denen vielleicht auch solche gehören, die mir überaus nahestehen, deren Lebensweise ich, wenn ich ganz aufrichtig bin, nicht einfach als verkommen, verblendet oder unwürdig abtun kann, obwohl diese Menschen keinen Glauben haben (jedenfalls keinen Glauben an Gott oder das Transzendente). Der Glaube an Gott ist heute keine unabdingbare Voraussetzung mehr. Es gibt Alternativen.«13
Wir werden gleich etwas genauer schauen, was Taylor mit diesem Wandel meint. Zuvor müssen wir jedoch noch einen kurzen Blick auf die verwendeten Begriffe werfen.
1. Taylor spricht von »believer« und »unbeliever«, was in der deutschen Übersetzung zu »Gläubigen« und »Ungläubigen« wird.14 Mir scheint jedoch in der Rede von »Unglaube« oder »Ungläubigen« im Deutschen eine negative Wertung mitzuschwingen, die weder bei Taylor noch in diesem Buch gemeint ist. Der mögliche Alternativbegriff »Atheist« ist zu speziell: In der Regel versteht man unter einem Atheisten jemanden, der ausdrücklich die Existenz Gottes oder von Göttern leugnet. Ein »Ungläubiger« in Taylors Sinn kann aber z.B. auch jemand sein, der sich jeder Aussage über Gott oder Göttliches enthält. Deshalb wird hier der – zugegebenermaßen wenig elegante – Begriff des »Nichtglaube...