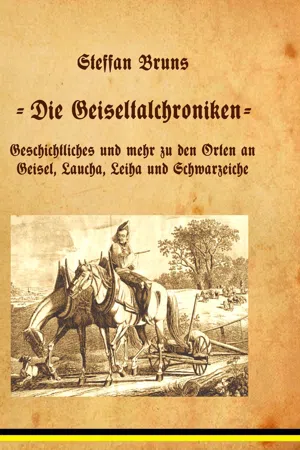![]()
Chroniken zu den Orten des Geiseltals und dessen Umgebung
Einleitung
Das Geiseltal gibt es heute faktisch nicht mehr, im 20. Jahrhundert wurde es im Zuge des Braunkohlentagebaues abgebaggert, damit verschwand auch ein Großteil der Dörfer des Geiseltales. Viele der Einwohner dieser Dörfer verschlug es in die umgebenden Orte. Aber nicht zu weit weg, denn was einst Heimat war, wurde nun Arbeitsplatz.
Daher, aber auch weil die Dörfer des Geiseltales und seiner Nebentäler (Klia, Stöbnitz, Leiha) besonders enge Beziehungen zu den Dörfern den Tälern der Schwarzeiche und Laucha hatten, bietet es sich an, all die Täler dieses Gebietes hier zusammenzufassen. Die Geschichte des Geiseltales an sich, sowie der Region in welcher es sich einbettet, dem historischen Hassegau, habe ich im Buch 'Der Hassegau – Geschichtliches zwischen Saale und Unstrut' eingehend behandelt. Dort beschrieb ich die geologische Entstehung der Region und des Geiseltales, aber auch zahlreiche geschichtliche Zusammenhänge von der Steinzeit bis hinein in die Moderne. Die Region im Wandel der Zeiten. Was fehlte, waren die Beschreibungen der Orte, also einzelne Ortschroniken der Teilregionen. Hier mit diesem Buche soll nun von den Chroniken der Orte des Geiseltales und der ihm benachbarten Täler von Stöbnitz, Leiha, Klia, Schwarzeiche und Laucha berichtet werden. Am Ende folgt den Chroniken eine umfangreiche Beschreibung über das Geiseltal, mit geschichtlichen, geologischen, wirtschaftlichen und weiteren Hintergründen.
Das Geiseltal war im frühen Mittelalter Bestandteil der sächsisch-thüringischen Landschaft 'Hassegau' (auch 'Hosgau'), im Westen davon entstand dann das 'Friesenfeld', auch 'Friesengau', bezeichnet, im Norden der 'Nord-Hosgau'. Es war das Land zwischen Unstrut, Saale und Salza. Wohl unter Karl den Großen kam es zu einer Erweiterung nach Norden hin, bis zur Schlenze und bis vor dem Hornburger Sattel. Dieser nördliche Teil führte aber bald schon als 'Nord-Hosgau' ein Eigenleben. Friesenfeld und Nord-Hosgau wurden später zur Grafschaft Mansfeld. Im Norden, Osten und Süden des Harzes reihten sich weitere Kleingaue aneinander.
Die Landschaft wurde und wird als Teil einer reich gegliederten Gefildelandschaft im größten zusammenhängenden Börde-Offenland Mitteleuropas charakterisiert. Das Geiseltal stell sich als sanftes, aber durchaus gut ausgeprägtes Muldental dar, ähnlich wie auch die Täler der Schwarzeiche, Laucha, Stöbnitz, Klia und Leiha, allesamt mit wasserreichen Bächen. Von Westen, also von der Saale bei Merseburg aus gesehen, haben wir eine ruhige Offenlandschaft. Die Ackerfluren bestimmen heute die Physiognomie der Landschaft, Gehölzgruppen und kleine Waldungen an den Wasserläufen gehörten auch dazu. Aber die Horizonte sind nicht unendlich weit entfernt gewesen, recht nah säumten im Süden Wälder die Landschaft. Im Neolithikum war gar die gesamte Landschaft bewaldet und nur mäßig von Lichtungen aufgelockert. In der Bronzezeit wurde die Landschaft aber mehrfach fast vollkommen entwaldet und erst in der Eisenzeit konnte sich wieder ein Waldbestand entwickeln, welcher im Frühmittelalter seine umfangreichste Ausdehnung hatte. Wohl die größte seit der frühen Bronzezeit.
Bei den Chroniken habe ich vor allem Wert auf die früheren Zeiten gelegt. Ob die LPG 'Rote Zukunft' den Kindergarten 'Lenins kleine Oktoberrevolutionäre' baute oder der Bürgermeister der örtlichen großen Koalition so tut, als hätte er die Dorfstraße persönlich neu gepflastert, mag durchaus in eine gute Ortschronik gehören, ich fand es aber eher uninteressant und habe so etwas in der Regel auch ignoriert. Gerne hätte ich zu den vergangenen Jahrhunderten, besonders denen vor der Neuzeit, mehr geschrieben, aber aus den schriftarmen bzw. -losen Zeiten weiß man nicht allzu viel spezifisches – dies ist bedauerlich, liegt aber in der Natur der Sache.
Zu zahlreichen der hier genannten Orte habe ich bereits 'Ortschroniken mit Ortsfamilienbüchern' verfasst, gelegentlich sind die Angaben dort umfangreicher als hier, oftmals aber auch ziemlich identisch. In jedem Falle aber sind diese Bücher um Ortsfamilienbücher erweitert, also umfangreichen Rekonstruktionen der lokalen familiären und verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich gehe davon aus, dass dieses Buch hier vor allem von Leuten gelesen wird, welche entweder selbst aus den beschriebenen Orten stammen, oder Ahnen aus diesen haben. In jedem Falle aber dürften Sie die Hoffnung haben, in den jeweiligen Ortsfamilienbücher mehr zu ihren Vorfahren erfahren zu können. Mit etwas Glück können ihre hiesigen Ahnenketten bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Zu erwerben sind diese Bücher über einen guten Buchhändler bzw. direkt beim Verlag ‚www.cardamina.de‘. Darüber hinaus gibt es aber auch weiterführende Informationen auf meiner Webseite www.steffanbruns.de‘.
Gelegentlich kommt mir beim Schreiben der Chroniken, wenn es um die Herkunft der Ortsgründer und des Ortsnamens geht, was nicht identisch sein muss, der Gedanke: 'Das ist alles so widersprüchlich, warum mache ich dass überhaupt?' Ich denke, diese Widersprüchlichkeit ist auch dem Leser nicht zu verheimlichen. Der Grund, die Chroniken gehe ich aus dem Denken eines Ahnenforschers an, somit ist für mich wichtig, zu wissen, welche Völker oder Stämme einst diese besiedelten. Archäologen, Historiker und Ortsnamensforscher haben hier ihre eigenen, oft sich widersprechenden Ansichten. Man kann sich, ganz nach Belieben mal auf die eine Seite schlagen, mal auf die andere. Meine Sichtweise soll dabei nur eine von vielen möglichen sein. Da Geschichtsdarstellung nicht objektiv ist, es auch niemals war, muss man sich faktisch zu vielen Themen seine eigene Meinung bilden.
Relativ einhellig ist man sich, die Giebelstellung von Gebäuden oder bestimmte Endungen von Ortsnamen bestimmten Stämmen und Völkern zuordnen zu können. So gilt allgemein die Ansicht, die zahlreichen auf '-stedt (-städt)' endenden Ortsnamen der Gegend stammen von Thüringern, genauer gesagt dem thüringischen Teilvolk der Angeln, Germanen die einst nördlich der Elbmündung lebten. Dies könnte sehr gut möglich sein, denn nachgewiesener Maßen siedelten Angeln genau in den Regionen, in welchen sich auf '-stedt' endende Ortsnamen gehäuft vorkommen. Das Problem, bei den Angeln an der Nordsee waren nicht nur die auf '-stedt' endenden Ortsnamen häufig, sondern noch öfter auch solche die auf '-wik' enden, solche lassen sich aber in Thüringen faktisch gar nicht feststellen. Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum die Angeln die eine Endung mitnahmen, die andere aber nicht. Wäre es umgekehrt, könnte man dies deutlich leichter erklären, denn '-wik' ist faktisch ein Synonym von '-dorf', hingegen ist '-stedt' kein Synonym von Stadt, sondern steht für einen hochwassergeschützten Platz in unmittelbarer Gewässernähe – wie z. B. im Ortsnamen 'Stade' oder im Wort 'Gestade' erkennbar. Hier in der Region gibt es nur Bäche und Flüsse, diese sind zwar oftmals recht hochwassergefährdet, aber eher über einen längeren Zeitraum betrachtet. Zudem sind die '-stedt'-Orte hier hauptsächlich auf die oberen Teile der Täler beschränkt, in welchen die Hochwassergefahr zumeist noch etwas geringer ist, als die an den Mittel- und Unterläufen der hiesigen Gewässer. Die auf '-stedt' endenden Ortsnamen an der Nordsee sind dazu im Gegensatz zu Orten gehörend die (einstmals) im Ebbe-Flut-Bereich der Nordsee bzw. großer Flüsse lagen. Logische Konsequenz dieser Feststellung müsste daher sein, dass eine Zuordnung der auf '-stedt' endenden Ortsnamen zu den Angeln nicht machbar ist. Allerdings gibt es hier ein dickes 'aber'! Aber, in Thüringen, und die Region gehörte einst zu Thüringen, ist eine Häufung der auf m '-stedt' endenden Ortsnamen faktisch nur in den Gegenden gehäuft, in welchen man eine Siedlung von Angeln auch aus anderen Gründen annimmt oder sogar nachgewiesen hat. Vielleicht hatten die anderen Thüringer, zum Beispiel die Warnen oder Hermunduren auch eine Vorliebe für auf '-stedt' endende Ortsnamen, denn man kann ihn nicht nur mit 'Gestade' gleichsetzten, sondern auch mit 'Stelle' im Sinne von Platz.
Ähnlich ist es auch mit den zahlreichen auf '-ow/-au' endenden Ortsnamen. Ich komme aus dem Berliner Stadtteil Pankow und als Ureinwohner spreche ich diesen Ortsnamen als 'Pank-ko' aus, Leute aus dem germanischen Altsiedelgebiet sagen aber aus Unwissenheit oftmals nicht 'Pank-ko', sondern 'Pankkoff'. Nur diese sprechen den Namen also 'slawisch' aus, die Ostdeutschen, die mit auf '-ow' endenden Ortsnamen täglich leben, wissen um die richtige Aussprache. Es gibt keinen Beweis, dass es jemals anders war. Schaut man sich die Erstnennungen vieler '-ow'-Namen an, merkt man, dass diese einst auf -au endeten, damit aber auch mit der deutschen Endung '-aue' gleichzusetzen wäre. Eine angebliche Eindeutschung ist zwar möglich, aber nicht zwingend, letztlich oft nur Behauptung. Auch in den Regionen Deutschlands von welchen keine einstige slawischen Besiedlung angenommen wird, gibt es zahlreiche auf '-au(e)' endende Ortsnamen, warum also sollten denn ausgerechnet im Osten Deutschlands, nur weil man für diesen eine einstige slawische Besiedlung annimmt, die gleichen Endungen nun Beleg für eine slawische Besiedlung sein? Und tatsächlich liegen die meisten der auf '-au/-ow' endenden Ortsnamen in einer (einstigen) Aue oder auenähnlichen Landschaft. Kein Grund also, Ortsnamen wie Krakau oder Milzau per se den Slawen zuzuordnen.
Schwerer sind die auf '-itz' endenden Ortsnamen zu erklären, allgemein werden sie ja den Slawen zugeordnet. Schaut man sich aber rein slawische Siedlungsgebiete in Polen, Serbien oder Russland an, dann findet man eine solche Endung bei Ortsnamen eher selten. Betrachtet man die Verbreitungsgebiete dieser Ortsnamen, dann stellt man fest, dass diese nur in einem Band zwischen westlicher Ostsee und nördlicher Adria gehäuft vorkommen. Dieses Gebiet kann man aber den Wenden zuordnen, welche wohl weniger Slawen, als ein Mischvolk mit venetischen Wurzeln waren. Dazu aber mehr in meinem Buch über den Hassegau. Nebenher kommen solche Namen sonst nur in Gegenden vor, wo es eine starke germanische Restsiedlung gab bzw. eine spätere deutsche, so im Grenzsaum Ungarns hin zu den Südslawen oder Ruthenen. Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, die '-itz'-Namen eher germanischen Restsiedlungen, vor allem solchen, die zum vandalischen bzw. auch suebischen Stammesverband gehören, zumindest aber solchen, die man den frühmittelalterlichen venetisch-germanischen Mischvolk der Wenden zurechnen darf. Nun scheint auf dem ersten Blick aber die Endung '-itz' kaum deutsch erklärbar, anders als '-stedt' oder '-dorf', aber dies scheint nur so, denn es dürfte in Verbindung mit dem althochdeutschen 'sezzi = Sitz' zu stehen. Tatsächlich wird '-itz' als Synonym für Dorf verwandt. Im Hoch- und Spätmittelalter werden Orte die mit '-itz' enden, auch gerne mit '-dorf' am Ende geschrieben bzw. auch umgekehrt. Aus dieser Sicht betrachtet, dürften diese Ortsnamen ganz neue Gesichtspunkte bieten. Die Behauptung dass das Grundwort '-itz' verwandter mit dem slawischen 'sedlo = Siedlung' sei, also mit dem deutschen 'sezzi = Sitz', klingt wenig logisch. Zumal dieses slawische Wort ohnehin eine Entlehnung aus dem Deutschen ist, sogar die Engländer kennen es (Settler).
Auch der Bezugsname zur Ortsnamensendung ist ein guter, wie auch irreführender Hinweis. Bei einem Ort namens Hermannsdorf ist alles klar, der Ortsgründer hieß Hermann und lebte wohl im hohen Mittelalter. Bei Orten wie Geusa oder Bedra ist dies gänzlich anders, hier ist jeglichen Deutungsversuchen Tür und Tor geöffnet, und gegenteiliges mindestens genauso schwer zu beweisen, wie dafürhaltendes. So nimmt es denn auch kein Wunder, dass für Orte wie die beiden eben genannten, es Ortsnamenstheorien gibt, die locker mehrere Jahrtausende abdecken – zuweilen von Vorindoeuropäern bis hin zu den Slawen. Ortsnamensforscher versuchen einen guten Job zu machen, nach allen Regeln der Wissenschaft, aber anders als Linguisten fehlen ihnen oft die geeigneten Werkzeuge. Ein solches Werkzeug wäre das Wissen um den Ortsnamen bei seiner Entstehung, aber gerade alte Ortsnamen haben es natürlicherweise an sich, eben erst erstmals genannt zu werden, wenn sie schon seit Jahrhunderten in Gebrauch waren und von unterschiedlichen Völkern mehrfach umgeschliffen wurden.
Gleich wie, wenn ich im nachfolgenden von 'Wenden' oder 'wendisch' schreibe, dann meine ich ein Volk, welches im Frühmittelalter aus Abkömmlingen nicht-germanischer Vasallen entstand und den Venetern bzw. Nemetern nahe stand. Eventuell nahmen auch noch die Teurii an der Ethnogenese der hiesigen Wenden teil. Die Vorfahren der Wenden lebten hier bereits vor Ankunft der Germanen und waren selbst Indogermanen – jedenfalls oberflächlich bzw. mehrheitlich. Bei der Ethnogenese der Wenden im Frühmittelalter mischten sich zu diesen noch Reste der sich in Resignation befindlichen Germanen, sowie auch bereits einzeln hinzu wandernde Slawen. Die Slawen nennen ihre östlichen Nachbarn nicht umsonst 'Nemet', eben so auch wie die germanischen Deutschen ihre westlichen Nachbarn einst als 'Wenid' (und ähnlich) bezeichneten.
Wenn ich von 'Suraben' bzw. 'surabisch' schreibe, dann meine ich ein Volk, welches seine Ethnogenese zur selben Zeit bzw. etwas später hatte, wie die Wenden. Ihr Kristallisationskern besteht aber nur zu kleinen Teilen aus Veneter / Nemeter, sondern hauptsächlich germanische Sueben. Aus den Sueben wurden im süddeutschen die Schwaben, während aus den in ihrer Heimat Verbliebenen die Suraben wurden. Im Mittelalter sagte man noch Suraben, erst später dann Sorben. Sorbe ist also vor allem ein neuzeitlicher Begriff. Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde dieser dann auch auf eigentlich mindestens zwei verschiedene Völker der Lausitzer übertragen, welche wir heute n...