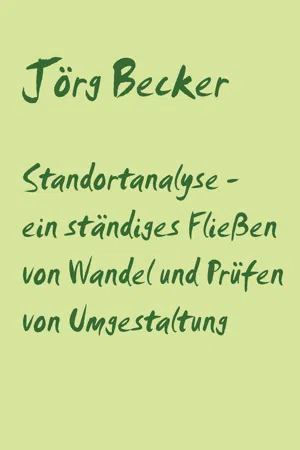![]()
II.
2
Themen-Leitfaden
Standort-Check: fit für eine Standortbilanz? Den unkalkulierbaren Gefahren von „Standort-Blindflügen“ kann am besten durch präzise und vollständige Vermessungen begegnet werden
Standort-Check: geeignet – ungeeignet? In vielen Fällen entscheidet das Humankapital über Erfolg oder Misserfolg eines Standortes, über die Werthaltigkeit von Gebäuden und Grundstücken
Standort-Check: Geschäftsumfeld, d.h. über welche zentralen Leistungsprozesse werden Ergebnisse der Standortentwicklung erzielt? Welche Standortergebnisse müssen mittelfristig erreicht werden, um das Leitbild zu erfüllen? Welche Vision hat der Standort für sich entwickelt?
Standort-Check: Gewichtung gebündelter Bewertungen. Im global vernetzten Wirtschafts- und Finanzgeschehen mit den für alle Beteiligten nahezu unbegrenzten Informationsmöglichkeiten und Datenquellen gibt es keine „Standort-Inseln“. Jeder Standort steht somit direkt oder indirekt in Wirkungs- und teilweise Abhängigkeitsbeziehungen zu einer Vielzahl anderer Standorte
Standort-Check: Grundsatzfragen. Jede Kommunalverwaltung sowie jedes ortsansässige, ansiedlungsinteressierte oder existenzgründende Unternehmen muss für sich selbst herausfinden, ob damit alle individuellen Zwecke, Ziele und Anforderungen abgedeckt werden können
Wissensmanagement für eine Steuerung „weicher“ Erfolgsfaktoren - Wirkungszusammenhänge auch mit nichtfinanziellen Kennzahlen analysieren
Standorte sind ein (lebendiges) System aus Menschen und gesellschaftlichen Organisationen, die in ständiger Wechselwirkung zueinander stehen
Ganzheitliches contra selektives Denken, um eine Scheinobjektivität mancher Evaluierungskriterien zu umgehen
Nur wer über alle Standortfaktoren genau im Bild ist und über sie Buch führt, vermag damit zusammenhängende Risiken und Chancen in einem ausgewogenen Verhältnis zu steuern
Informationstransfer immer nur mit leichter Sprache?
Menschen verändern sich schneller als die baulichen Strukturen. Aber schon heute müssen sich Kommunen der Herausforderung stellen: sich zu überlegen, welche Weichen sie heute stellen müssen, um möglichst günstige Rahmenbedingungen für eine angestrebte Entwicklung zu schaffen
Immer weniger Menschen vertrauen Statistiken
Zeitliche Realisierungsperspektive und Wirkungsmechanismen der Flächenkreislaufwirtschaft - ein Standort ist mehr als nur die Summe seiner Gebäude, Flächen oder Straßen
Technikfolgeabschätzung kommender Gegenwarte
Die Welt der Zahlen verspricht Reduktion von Komplexität - statistische Daten sind jedoch nicht naturgegeben, sondern von Menschen gemacht: ihnen liegen Interessen und Prämissen zugrunde, die nur in Verbindung mit qualifizierenden Argumenten zu sinnvollen Erkenntnissen führen
Wandel ist ein ständiges Fließen von Umgestaltung und ist nicht die Folge irgendeiner Kraft, sondern eine nahezu natürliche Tendenz, die allen Dingen und Situationen schon von Vornherein innezuwohnen scheint
Für die angemessene Darstellung von Analysen und Ergebnissen der Standortbeobachtung braucht es geeignete Instrumente - insofern ist jede Standortbeobachtung immer auch eine Fortsetzungsgeschichte mit offenem Ausgang
Der herausragende Einflussfaktor für fast alle wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen ist die Digitalisierung
Im global vernetzten Wirtschafts- und Finanzgeschehen mit den für alle Beteiligten nahezu unbegrenzten Informationsmöglichkeiten und Datenquellen gibt es keine Standort-Inseln
Kommunen öffnen sich wirtschaftlichem Controlling - mit dem zugehörigen Instrumentarium eröffnen sich Möglichkeiten, frühzeitig Erfolgspotentiale sowie künftige Stärken und Schwächen aufzuspüren
In dynamischen Situationen kann eine nicht hinterfragte und gegebenenfalls korrigierte Schwerpunktbildung zu Einseitigkeiten und damit unangemessene Entscheidungen führen
Standortakteure müssen in der Lage sein, die für sie relevanten Themen möglichst frühzeitig zu erkennen- für einen nachhaltigen Standorterfolg gehört nicht zuletzt die Fähigkeit zur erzählerischen Aufladung und kreativen Thematisierung
Modelle für die Standortanalyse - die Wirklichkeit vereinfachende Konstrukte zur kritischen und objektiven Analyse realer, komplexer Probleme nutzen
Regionale Identitäten - grundsätzlich gibt es im Markt keine schlechten Standorte, sondern lediglich solche, die nicht für jede Nutzung und jedes Unternehmen geeignet sind
Neue soziale Zeitordnung
Wenn der Standort-Bildschirm zielgenau auf bestimmte Einzelaspekte ausgerichtet und „gezoomt“ werden soll, muss dabei trotzdem zu jeder Zeit der systematische Gesamtzusammenhang gewahrt bleiben
In Standortdaten liegen noch viele ungehobene Schätze
Grundverständnis über die wesentlichen Geschäftsprozesse des Standortes und deren Bedeutung - die wesentlichen Themengebiete zur Wirtschaftsentwicklung des Standortes abbilden
Intellektuelle Anstrengung und Kompetenz bedeuten, alle Elemente, d.h. auch und gerade die nicht quantifizierbaren, in Entscheidungen einfließen zu lassen
Eine Bestandsaufnahme mit einer sorgfältigen Identifikation und Evaluation kritischer Fähigkeiten ist eine unerlässliche Voraussetzung für das Management der Standortressourcen - das Instrument einer Standortbilanz ermöglicht die ansonsten sehr aufwendige Analyse von Kausalnetzen, deren Knoten innerhalb und außerhalb des Standortes liegen können
Strategisches Denken und Planen – eine Symbiose zwischen Management der Chancen und Management der Risiken optimieren
Was ist dran an der Theorie zur Bedeutung von Wissens- und Humankapital für den Wohlstand eines Standortes?
Intangibles mit Zukunft - nicht alles, was wichtig ist, muss immer auch zu messen sein
Sektorale Struktur mit Lokationsquotient und Spezialisierungsvorteilen regionaler Wertschöpfungsketten
Standorte brauchen Kompetenznetzwerke - den Wettbewerb um kreative Köpfe gewinnen nur Standorte mit Chancenpotenzial
Digitalisierung prägt Informationskulturen mit Nebenwirkungen von ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen - Kommunikationsrevolution mit Wissensnutzung für kreative Freiräume
3
Standort-Check: fit für eine Standortbilanz? Den unkalkulierbaren Gefahren von „Standort-Blindflügen“ kann am besten durch präzise und vollständige Vermessungen begegnet werden
Standortbezogene Entscheidungsumfelder sind laufenden Veränderungen unterworfen: durch die Globalisierung erweiterte Wirtschaftsräume, durch das Internet neue Interaktions- und Veränderungsdynamiken. Durch die multidimensionale Verflechtung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, gibt es immer weniger Ereignisse, die nicht in der einen oder anderen Form auch immer einen (direkt oder indirekt) tangieren würden. Es gibt keine guten oder schlechten Standorte. Es gibt nur geeignete oder ungeeignete Standorte. Der geeignete Standort ist alles, ohne den geeigneten Standort ist alles nichts. Die Eignung eines Standortes zeigt sich weder dem nach ihm Suchenden noch dem bereits vor Ort Ansässigen immer schon auf den ersten Blick. Suchende und Ansässige benötigen zu ihrer Sicherheit eine möglichst genaue und transparente Vermessung des Standortes. Die politisch und fachlich Verantwortlichen eines Standortes sollten bestmögliche Hilfen und Informationen bieten, um Interessenten wie Ansässigen oft existenzbestimmende Standortentscheidungen soweit als nur möglich zu erleichtern. Beide Gruppen sollten ihrerseits die möglichen Instrumente und Arbeitshilfen nutzen, um sich selbst ein genaues Bild von der Gesamtbilanz des Standortes zu machen. Ein möglichst realitätsgetreues Bild des Standortes muss aus den oft sehr verschiedenen Blickrichtungen eines Betrachters, also vor Ort ansässigen Unternehmen, kommunalen Verwaltungsstellen, ansiedlungs- und investitionsinteressierten Firmen oder Personen und Existenzgründern, zusammengefügt werden. Die Frage des richtigen, d.h. am besten geeigneten Standortes ist für Unternehmen zu wichtig, als dass man sie an Dritte delegieren oder auf eine von Zeit zu Zeit notwendige Überprüfung verzichten könnte. Jeder Strategie-Check des Unternehmens sollte deshalb immer auch die Standortfrage mit einschließen. Denn einmal getroffene Standortentscheidungen lassen sich, auch wenn sie „suboptimal“ sind, nur schwer korrigieren. Nur wer über alle Standortfaktoren genau im Bild ist und über sie Buch führt, vermag damit zusammenhängende Risiken und Chancen in einem ausgewogenen Verhältnis zu steuern. Standortbilanzen können aus unterschiedlichen Sichtweisen (z.B. Innen- oder Außenbetrachtung), von unterschiedlichen Personen oder Stellen, für unterschiedliche Standorte oder auch nur Bereiche hiervon, für unterschiedliche Zeiträume und Zeitpunkte aufgenommen und zusammengestellt werden. Aufbau und Struktur bleiben hiervon unabhängig immer gleich. Durchgängig bruchfreie Systematik und Abstimmbarkeit: einheitliche Abgrenzung und Zuordnung auf Faktoren-Cluster, einheitliche Bewertungsmethoden nach Quantität, Qualität und Systematik, eindeutige Zuordnung von Indikatoren von Standortfaktoren, einheitliche Definition und Interpretation von Indikatoren, eindeutige Zuordnung von Maßnahmen auf Standortfaktoren, einheitliche Strukturierung von Maßnahmen, eindeutige Verknüpfung von Faktoren nach Wirkungsstärke und –dauer, alle Einzel-Tatbestände im System durchgängig abstimmfähig, zeitlich oder lokal unterschiedliche Standortbilanzen immer vergleichbar.
4
Standort-Check: geeignet – ungeeigne? In vielen Fällen entscheidet das Humankapital über Erfolg oder Misserfolg eines Standortes, über die Werthaltigkeit von Gebäuden und Grundstücken
Kaum eine Einzelperson verfügt über genug Wissen, um sämtliche Möglichkeiten der ungeheuren Komplexität von Standorten noch sicher verstehen und kontrollieren zu können. Wer aber das umgebende Geschehen nicht mehr vollständig erfassen kann, muss Wissenslücken, Zielkonflikte und Kontrollverluste in Kauf nehmen. Denn jeder Standort ist anders und weist ganz spezifische Bedingungen auf, die u.a. von klimatischen, geographischen, politischen und sozio-ökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Die natürlichen Standortvorteile (Rohstoffvorräte, Hafennähe u.a.), die im Zeitalter der Industrialisierung noch bestimmte Standorte privilegiert hatten, spielen eine immer geringere Rolle, weniger Transportkosten verschaffen vergleichbaren Standorten damit eine relative Chancengleichheit. Unter den Standorten gibt es, heute mehr denn je, Gewinner und Verlierer: an einem Standort Bilder von überfüllten Kindergärten, Schulen, Wohnungen und Büros und leeren an einem anderen Standort. Aufgrund einer Disparität von Standortentwicklungen stehen schrumpfende Standorte auf der anderen Seite wachsenden Regionen gegenüber. Mit der Gleichzeitigkeit ungleicher Entwicklungen als Folge des wirtschaftlich-strukturellen Wandels steigt auch an vielen Orten die Notwendigkeit von Anpassungen durch einen Standortumbau. Im harten Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen genügt potentiellen Investoren der Verweis auf die Prosperität, hervorragende Infrastruktur und geografische Lage nicht mehr. Es geht um die Lösung von Fragen wie beispielsweise: wie kann der Standort mit der Dynamik des ihn umgebenden Umfeldes mithalten? aus welchen individuellen und kollektiven Standortfaktoren setzt sich das Kapital des Standortes zusammen, auf das er bei der Lösung seiner Aufgaben zurückgreifen kann? sind die notwendigen Fähigkeiten vorhanden, um das vorhandene Potenzial produktiv nutzen zu können? wie kann man die vorhandenen Erfolgsfaktoren des Standortes bündeln und konzentrieren? Die Wirtschaftsförderung braucht daher neue Impulse, um in ihrem Bereich die Zukunft von Arbeitsplätzen zu sichern. Der Standort unterliegt einem dynamischen Wandel und Anpassungsdruck: insbesondere der richtige Umgang mit dem verfügbaren Standortkapital als Ressource wird für die Zukunft immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor. D.h.: die vorhandenen Ressourcen müssen auf den Ausbau und die Weiterentwicklung des Standortes optimiert werden. Gegenüber dem Management klassischer Produktionsfaktoren hat das Management der Standortfaktoren (speziell der "weichen Standortfaktoren" wie beispielsweise Image als Wirtschaftsstandort, Image als Wohnstandort, Umwelt, Lebensqualität und Sicherheit, unternehmensfreundliche und flexible Verwaltung) seine Zukunft noch vor sich. Verantwortliche für Standorte wie Standortanalysten in Unternehmen wären gut beraten, eine eigene Indikatorkompetenz mit einem zeitnah aktualisierten Daten- und Informationspool einzurichten. Kernelement der Standortstrategie ist die verbindliche Vereinbarung und Festlegung von Zielen. Dieses wiederum ist die Grundlage für alle operativen Umsetzungsaktivitäten. Insbesondere geht es darum, wie und welche „weichen“ Standortfaktoren nachhaltig weiterentwickelt werden sollten. Für das Standortumfeld erkannte Möglichkeiten und Risiken sollten zur Vision und Strategie in Bezug gesetzt werden. Die Standortstrategie soll dann beschreiben, wie künftig am Markt agiert werden soll sowie welche Investitionen und Maßnahmen hierfür vorgesehen sind. Die Strategie beschreibt zukünftige Aktionen. Dabei ist auf die Einhaltung der Reihenfolge: Ziel-->Weg---->Erfolg zu achten. In einer zahlenorientierten Finanzwelt reichen zu einer detaillierten Standortbeurteilung nur verbale Darstellungen nicht aus. Eine der Hauptursachen, warum komplizierte, da an vielen Stellen miteinander vernetzte Sachverhalte des Standortes bislang so wenig greifbar gemacht werden konnten, liegt in der komplizierten Bewertung und Messung immaterieller sogenannter weicher Faktoren begründet. Für Standorte geht es aber gerade darum, anhand von immateriellen Faktoren eine Marktposition zu erobern. Die richtige Positionierung basiert aber nicht nur auf materiellen oder immateriellen Standorteigenschaften, sondern auch auf der Zielrichtung, d.h. dem Finden der richtigen Zielgruppe. Wenn die Wirtschaftsförderung Bemühungen auf bestimmte Segmente konzentriert, ist es leichter, spezifische Anforderungen von Investoren zu verstehen und sich hierauf einzustellen. Dies erhöht die Erfolgsaussichten.
5
Standort-Check: Geschäftsumfeld, d.h. über welche zentralen Leistungsprozesse werden Ergebnisse der Standortentwicklung erzielt? Welche Standortergebnisse müssen mittelfristig erreicht werden, um das Leitbild zu erfüllen? Welche Vision hat der Standort für sich entwickelt?
Die traditionellen Planungsmethoden und Managementberichte müssen daher auf die neuen Anforderungen des Informations- und Wissenszeitalter hin angepasst und ausgerichtet werden. Hierfür muss ein barrierefreier Austausch erfolgsrelevanter Informationen über funktionale Grenzen hinweg sichergestellt werden. Voraussetzung ist eine genaue und detaillierte Analyse aller zugrunde liegender Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Welche Chancen und Risiken beeinflussen das Geschehen am Standort? Welche aktuellen Entwicklungen im Geschäftsumfeld (z.B. neue Wettbewerber, neue Technologien, neue Gesetze) gibt es? Wie sieht de...