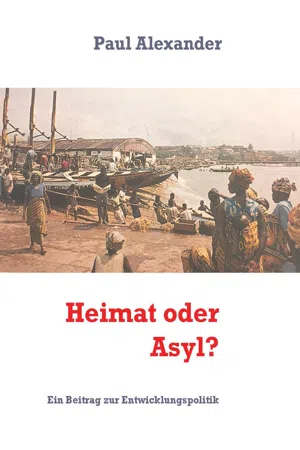
- 330 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
30 Jahre lang kümmerten sich unsere Hilfsorganisationen um sie.Nun stehen sie vor unserer Haustüre. Die Menschen aus den armenLändern.Welchen Nutzen zogen sie aus ihrer Gastarbeitertätigkeit, unserenNahrungsmittellieferungen, unseren Kleiderspenden, unsererEntwicklungshilfe, unseren Rüstungsexporten und unserem Asylrecht? Welche entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen müssengewährleistet sein und welche Grundsätze verfolgt werden, umallen Menschen dieser Erde Heimat zu schaffen?Welche besonderen Schritte sind dabei in unseren neuen Bundesländern zu unternehmen?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Heimat oder Asyl? von Paul Alexander im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Business & Business General. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil 1: Die Dritte und die Erste Welt
1. Einwanderungsland Europa - ein aktuelles Thema
Für die BRD und andere westeuropäische Industrieländer sei die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte und deren Integration in unsere Bevölkerung nur von Vorteil, betonen die Vertreter der Bundesregierung und zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens angesichts der kriminellen Ausschreitungen gegen Asylanten und deren Unterkünfte.
Kein Zweifel, unsere ökonomischen Vorteile bei der Beschäftigung von Ausländern liegen auf der Hand. Ausländische Arbeitskräfte sind in wachsendem Maße an der Steigerung unseres Bruttosozialprodukts beteiligt, sie übernehmen häufig Arbeiten, die von Deutschen ungerne ausgeführt werden, sie und ihre Familien stellen darüber hinaus ein wichtiges Nachfragepotential für unsere Erzeugnisse dar. Insbesondere der Markt für Gebrauchtartikel aller Art findet seine entscheidende Stütze bei unseren ausländischen Mitbürgern. Sie sind vergleichsweise arm und haben einen hohen Nachholbedarf an Konsumgütern. Last not least tragen ausländische Arbeitskräfte angesichts einer schrumpfenden deutschen Bevölkerung dazu bei, unsere staatliche Sozialversicherung zu stützen.
Ohne Frage: Rechnen wir die wirtschaftlichen Effekte für die Bundesrepublik insgesamt aus, so ergeben sich beachtliche Vorteile aus der wachsenden Zuwanderung von Ausländern.
Allerdings sind diese Vorteile für einzelne Gruppen in unserem Lande sehr unterschiedlich. Den zweifellos größten Vorteil ziehen daraus die Unternehmer. Zumal aus dem Zuwachs an Arbeitskräften, mit deren Hilfe die Produktion gesteigert werden kann, zweitens aus dem Zuwachs an Konsumenten zum Absatz der wachsenden Produktion und drittens übt der Zuwachs an solchen Arbeitskräften eine dämpfende Wirkung auf den Anstieg der Lohnkosten aus.
Wie verhalten sich die Gewerkschaften?
In ihrer Ausländerfreundlichkeit hat sich während der letzten 20 Jahre ein grundlegender Wandel vollzogen. Bei den wichtigsten Gewerkschaften, wie der IG Metall und der IG Bau, nehmen die ausländischen Arbeitskräfte einen sehr starken Anteil, sowohl an den Beschäftigten der Branche als auch an den gewerkschaftlichen Organisierten ein. Seither gehören die Gewerkschaften zu den wichtigsten Fürsprechern ausländischer Arbeitskräfte. Ausländer, insbesondere ausländische Facharbeiter, finden heute somit eine wichtige Lobby, sowohl bei Unternehmern wie Gewerkschaften.
In ihrer Ausländerfreundlichkeit hat sich während der letzten 20 Jahre ein grundlegender Wandel vollzogen. Bei den wichtigsten Gewerkschaften, wie der IG Metall und der IG Bau, nehmen die ausländischen Arbeitskräfte einen sehr starken Anteil, sowohl an den Beschäftigten der Branche als auch an den gewerkschaftlichen Organisierten ein. Seither gehören die Gewerkschaften zu den wichtigsten Fürsprechern ausländischer Arbeitskräfte. Ausländer, insbesondere ausländische Facharbeiter, finden heute somit eine wichtige Lobby, sowohl bei Unternehmern wie Gewerkschaften.
Für den durchschnittlichen deutschen Bürger indessen ist der Zustrom von Ausländern nicht nur mit Vorteilen verbunden, denn er steht mit ihnen in wachsender Konkurrenz bei der Nachfrage nach Wohnraum und in der Benutzung der vorhandenen Infrastruktur (Verkehrswege, Ausbildung, Gesundheitsdienste etc.).
Beides, Wohnraum und Infrastruktur sind in den letzten Jahren deutlich langsamer gewachsen, als es dem Zustrom an Ausländern entsprochen hätte, und dies hat zu Spannungen geführt.
Aber selbst dann, wenn Wohnraum und Infrastruktur rascher wachsen würden, müßte der Bürger über Steuern und Abgaben an seiner Finanzierung beteiligt werden, also an etwas, was ihm gar nichts nützt, vielmehr seinen Lebensraum (1992 lebten in den alten Bundesländern rund 253 Einwohner pro qkm) weiter einengt und seine Umwelt weiter belastet.
Ein großer Teil unserer Bevölkerung, wahrscheinlich eine qualifizierte Mehrheit, sieht dem weiteren Zustrom von Ausländern mit großer Sorge entgegen.
Die Regierung und die im Bundestag vertretenen Parteien versuchen dieser Sorge auf zweierlei Weise Rechnung zu tragen:
- einmal durch einen forcierten Ausbau von Wohnraum und Infrastruktur,
- zum zweiten durch eine Reglementierung des Ausländerzustroms mit dem Ziel, diesen mit dem Wachstum von Wohnraum und Infrastruktur in Einklang zu bringen.
Im ganzen sind Parteien wie Regierung aber weit davon entfernt, den Zustrom an Ausländern zum Stillstand bringen zu wollen. Wichtig erscheint lediglich eine Harmonisierung der Wachstumsraten.
Muß bei solch hoher Aufnahmebereitschaft für die Menschen aus den armen Ländern mein Herz als Entwicklungshelfer nicht höher schlagen? Die Antwort hierauf finden wir rasch, wenn wir uns der Frage zuwenden, welchen Vorteil die Heimatländer unserer ausländischen Mitbürger aus der Abwanderung von Teilen ihrer Bevölkerung ziehen. Eine Fragestellung, mit der wir endlich zum Thema der Entwicklungspolitik. vorstoßen und zugleich eine Fragestellung, die m.E. allein geeignet ist, einen Maßstab für unsere Ausländerfreundlichkeit zu liefern. Dabei ist es entwicklungspolitisch unerheblich, ob der aus dem Ausland Zuziehende politisch Verfolgter ist oder Wirtschafts flüchtling, deutschstämmig oder nicht.
Als ich im Sommer 1968 mit einem Forschungsauftrag unseres Entwicklungshilfeministeriums am Institut für ausländische Landwirtschaft der Universität Hohenheim meine Arbeit in der Entwicklungshilfe begann, galt die Türkei, unser Hauptlieferant an ausländischen Arbeitskräften, als ein Schwellenland, das nach Einschätzung von Fachleuten keiner Entwicklungshilfe mehr bedurfte, da es zu einer weiteren selbsttragenden Aufwärtsentwicklung, insbesondere seiner Industrie, künftig allein imstande sein würde.*
*(Der Nationalökonom W. W. Rostrow legte die die nach ihm benannte “Take-off-Periode” für die Türkei auf die Jahre 1933-1961 fest).
Diese Einschätzung hat sich in der Folgezeit, in der immer mehr Türken eine Beschäftigung im Ausland fanden, als Fehleinschätzung erwiesen. Die Türkei ist bis 1992 nicht über das Stadium eines Schwellenlandes hinausgewachsen. Im BSP/Kopf rangierte es in der Weltbankliste unter den Plätzen 67-70 wie schon zuvor; etwa auf der Höhe von Tunesien und Jordanien. Auch unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität lag die Türkei l989 hinter Polen und ganz deutlich hinter Ländern wie dem damaligen Jugoslawien und Ungarn. Das größte Wachstum verzeichnete der Dienstleistungssektor (Tourismus und Handel). Demgegenüber blieb das Wachstum des Industriesektors, das vom Textilsektor dominiert wird, deutlich zurück. Auslandsschulden und Inflation nahmen zu. Von l983-89 erhielt die Türkei noch immer öffentliche Entwicklungshilfe in Höhe von durchschnittlich 0,4 % ihres BSP von 1989, wenn auch weniger als der Durchschnitt der Länder ihrer Einkommensgruppe mit 1,3 % des BSP (vgl. Anl. 1b).
Was hat diese Entwicklung mit der wachsenden Beschäftigung ihrer Arbeitskräfte im Ausland zu tun? Wären die Probleme des Landes ohne die hohen Devisenzuflüsse durch die Gastarbeiterüberweisungen in ihre Heimat nicht noch größer? Diese Frage läßt sich nur beantworten, wenn wir die wirtschaftlichen Wirkungen der Gastarbeitertätigkeit für die Türkei analysieren:
- Zunächst besteht der potentielle Reichtum eines Landes nicht zuletzt in der Zahl der Arbeitskräfte, über die es verfügt. Jeder Wegzug von Arbeitskräften reduziert somit dieses Potential.
- Hinzu kommt, daß es nicht vorzugsweise Arbeitslose in der Türkei sind, die wegen fehlender Ausbildung und/oder Motivation um Arbeit in der BRD nachsuchen, sondern um vergleichsweise gut ausgebildete und hochmotivierte Kräfte, die bereit sind, hart zu arbeiten und die besonderen Anpassungsschwierigkeiten, die mit dem Leben im Ausland verbunden sind, zu überwinden. Bei solchen Arbeitskräften kann man gewiß sein. daß ihr Wegzug eine spürbare Lücke im Bruttosozialprodukt der Türkei hinterläßt.
- Wird diese Lücke nicht überkompensiert durch die hohen Ersparnisse, die ein Arbeiter bei einer Beschäftigung in der BRD macht und in seine Heimat überweisen kann? Verdient er beispielsweise netto 3000 DM pro Monat, kann er hiervon 1000 DM bis 1500 DM nach Hause überweisen, während er selbst als Facharbeiter in der Türkei nur 500 DM bis 700 DM pro Monat verdient hätte.
- Entscheidend ist also, was mit dem Geld, das er nach Hause schickt, geschieht. Wird es produktiv angelegt, sei es im landwirtschaftlichen, sei es im gewerblichen oder kleinindustriellen Bereich, kann es maßgeblich zur Wertschöpfung der türkischen Volkswirtschaft beitragen und stellt zugleich die Devisen zum Import überlegener Technologie zur Verfügung, solange und soweit diese in der Türkei noch nicht hergestellt werden kann.
- Tatsache ist, und dies gilt nicht nur für die Türkei, sondern für alle Länder, die Teile ihrer Arbeitskräfte nach Westeuropa entsenden, von der Türkei im Osten bis in den Senegal im Westen, daß die harten Devisen, die sie nach Hause überweisen, ganz überwiegend dem Konsum zufließen und dabei wiederum vorzugsweise dem Konsum von Importwaren.
Um dies zu verstehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, welchen Einfluß oder, besser gesagt, welchen Eindruck die Überweisungen der im westlichen Ausland tätigen Arbeitskräfte auf die zu Hause gebliebenen Teile ihrer Familien, ihre weiteren Verwandten und Freunde ausüben. In den genannten Ländern des Mittelmeerraumes leben etwa 30 bis 50% der Bevölkerung von einer landwirtschaftlichen Tätigkeit. Sie erwirtschaften dort ein Arbeitseinkommen von etwa 5,- bis 15,- DM pro Arbeitstag (den Arbeitstag zu 6 Stunden gerechnet), was einen Stundenlohn von DM 0,80 bis DM 2,50 ausmacht, ohne irgendwelche Zuschläge für soziale Absicherung. In dem noch schwach ausgeprägten Industriesektor liegt das Arbeitseinkommen für Facharbeiter etwa zweimal so hoch, also zwischen DM 1,50 und DM 5,- pro Stunde. Die Lohnnebenkosten liegen bei 30 bis 60 % verglichen mit 80 % in der Bundesrepublik.
Überweist nun ein türkischer Arbeitnehmer aus der Bundesrepublik oder ein marokkanischer Arbeiter aus Frankreich, wo er vielleicht am Fließband in einer Automobilfabrik arbeitet, 1000 DM bis 1500 DM pro Monat an seine Großfamilie, so wirkt dies gleich doppelt demotivierend auf die im Berufsleben stehenden Familienmitglieder und Freunde: Einmal können dort von dem überwiesenen Geld 5 bis 10 Personen leben, zum anderen fühlen sich die lokalen Arbeitskräfte für ihre Arbeit maßlos unterbezahlt. Dies gilt in besonderem Maße für den landwirtschaftlichen Sektor mit seiner vergleichsweise niedrigen Arbeitsproduktivität. Da dieser Sektor aber in den genannten Ländern nach wie vor dominiert, kann man sich leicht vorstellen, welche Wirkung die Gastarbeiterüberweisungen haben. Anstatt die Gelder produktiv anzulegen, werden sie von den Familienangehörigen für den Kauf von zunehmend importierten Basisnahrungsmitteln und sonstigen, meist westlichen Konsumgütern ausgegeben, während die Eigenerzeugung reduziert bis eingestellt wird.
Während der letzten 30 Jahre hat die Bevölkerung in den armen Ländern der Dritten Welt eine unerwartet hohe Präferenz für moderne westliche Konsumgüter entwickelt, von der Taschenlampe über den Transistorradio und den Kühlschrank bis zum PKW, aber in keinem dieser Länder wurde diese Präferenz so ausgeprägt wie in jenen, die Teile ihrer Bevölkerung in eben jenen westlichen Ländern in Beschäftigung bringen konnten und die dadurch zugleich die Möglichkeit erhielten, ihre Nachfrage nach westlichen Konsumgütern zu befriedigen. Wir alle kennen jene ”Gastarbeiterüberweisungen”, die nicht in bar in die Heimat fließen (und daher auch nicht den Devisenvorrat ihrer Nationalbanken erhöhen), sondern von vornherein in Gestalt westlicher Konsumgüter die PKW unserer ausländischen Mitbürger randvoll füllen, wenn diese auf Heimaturlaub fahren und mit dem Flugzeug zurückkommen, weil auch der PKW vor Ort günstig verkauft werden konnte.
Die Präferenz für Produkte aus den USA, Westeuropa und Japan ist in allen Ländern der Dritten Welt ungebrochen und stellt seit 30 Jahren ein gewaltiges Hindernis für jeden Unternehmer dar, der, gleichgültig ob als westlicher Ausländer oder als Einheimischer, die gleichen Konsumgüter im Entwicklungsland herstellen und verkaufen möchte. Nur bei einfachen Textilien wendet sich das Blatt inzwischen.
1980 bereiste ich im Auftrag einer Entwicklungshilfeorganisation Malawi, um zusammen mit zwei Experten der deutschen Tabakindustrie die Möglichkeiten für den Anbau von Orienttabak zu erkunden. Wie mir diese Experten versicherten, gab man dem sehr arbeitsintensiven Orienttabakanbau in seinen klassischen Produktionsländern Griechenland und Türkei kaum noch Chancen, weil die Bauern nicht mehr bereit waren, Kulturen mit derart niedriger Arbeitsproduktivität anzubauen.
Zur großen Enttäuschung der Tabakexperten mußten wir auch in Malawi feststellen, daß die Bauern wenig Neigung zeigten, sich mit dem vergleichsweise niedrigen Arbeitseinkommen pro Manntag zufriedenzugeben, das der Orienttabakanbau bot, denn ein großer Teil von ihnen konnte sein Geld wesentlich günstiger in den Goldminen Südafrikas verdienen. Erst als Südafrika seine malawischen Gastarbeiter wegen der rückläufigen Goldpreise in ihre Heimat zurückschickte, hatte der Orienttabakanbau in Malawi wieder etwas mehr Chancen.
1975 führte mich meine Arbeit in den Nordjemen. In keinem Land hatte ich zuvor eine so hoch entwickelte traditionelle Landwirtschaft vorgefunden, mit der sich seine Bevölkerung auch unter schwierigsten Umweltbedingungen ihre Lebensgrundlage gesichert hatte. Eine weiträumige Gebirgslandschaft im semiariden Klima war durch mühevolle Anlage unzähliger Terrassen und Bewässerungsgräben für eine saisonale Zusatzbewässerung in eine intensive Nutzung gebracht worden. Aber wie wurden diese Anlagen, in Jahrhunderten mühevoller Arbeit geschaffen, im Jahre 1975 genutzt?
Der Ölboom hatte ihre armen nomadisierenden Nachbarn, die Saudis, über Nacht zu Millionären gemacht, die es sich fortan leisten konnten, jeden Handgriff von bezahlten Dienstboten ausführen zu lassen, und bei guter Bezahlung fanden sich solche dienstbaren Geister. Es kamen Palästinenser und sogar Philippinos und es kamen auch die Bauern aus dem jemenitischen Hochland. Bis 1975 arbeitete schon etwa die Hälfte ihrer männlichen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in Saudi-Arabien. Die Veränderung ihrer wirtschaftlichen Situation konnte mit der jener Türken verglichen werden, denen es gelungen war, in der BRD Arbeit zu finden. Mit dem, was die jemenitischen Gastarbeiter zu Hause ablieferten, konnten ihre Großfamilien leben. Die mühsame Terrassenlandwirtschaft verkam mehr und mehr. Der landwirtschaftliche Anbau wurde auf die günstigen Tallagen beschränkt und die Bewässerungslandwirtschaft mit Hilfe moderner Tiefbohrgeräte unter Raubbau am Grundwasserspiegel betrieben. Zur Rentabilisierung der Investitionen wurde vorzugsweise das Rauschmittel Qat angbaut, nicht nur bei der heimischen Bevölkerung begehrt, sondern auch in den Nachbarländern. Der wachsende Bedarf an Grundnahrungsmitteln wurde indessen durch Importe gedeckt. Auch hier führte also die gut bezahlte Tätigkeit von Arbeitskräften im Ausland nicht zur Stimulanz lokaler Produktion, sondern ganz eindeutig zu deren Abbau. Man verließ sich mehr und mehr auf das westliche Ausland und geriet in immer größere Abhängigkeit von dessen Konjunktur, hier: der Nachfrage nach Erdöl.
Ein weiteres Beispiel solcher Wirkungen erlebte ich noch im gleichen Jahr 1975 im Gebiet des östlichen Rifs in Marokko, einer vom Klima besonders benachteiligten Region: marginale Böden, unzureichende Niederschläge, schlechte Verkehrsanbindung. Hier wollte die marokkanische Regierung durch ein von der BRD unterstütztes staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm der verbreiteten Arbeitslosigkeit entgegenwirken und zugleich die Produktionskapazität der Region durch Investitionen in den Ressourcenschutz und die Infrastruktur stärken, also durch Aufforstung, Anlage von Trinkwasser- und Bewässerungsbrunnen, durch Feldwegebau etc. Mit anderen Worten: Mit westlicher Hilfe sollten eben jene Maßnahmen neu durchgeführt werden, die aufgrund westlichen Einflußes (Ölboom) im Jemen dem Verfall anheimgegeben waren.
Bei der Prüfung dieses Projekts fiel mir sogleich auf, daß sich trotz hoher Arbeitslosigkeit kaum Arbeitskräfte fanden, um sich am Programm zu beteiligten. Es waren vorwiegend alte Leute und Jugendliche unter 14 Jahren, die man jedoch kaum zum Wegebau in diesem felsigen Gelände einsetzen konnte. Die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter aber hatte weit bessere Verdienstmöglichkeiten als jene Grundnahrungsmittelrationen, die das staatliche food for work Programm für harte körperliche Arbeit anbot.
Bereits wesentlich günstiger war es, zeitweilig als Erntearbeiter in anderen Teilen Marokkos zu arbeiten, noch besser natürlich als Saisonarbeiter oder gar permanent Beschäftigter in Frankreich. Den Gipfel an bequemer Verdienstmöglichkeit aber bot die Beschäftigung in der nahegelegenen spanischen Exklave auf marokkanischem Boden, dem Freihandelshafen Melilla. Hier verdiente man als Hilfsarbeiter nicht nur eine harte Währung, man konnte seinen Verdienst darüber hinaus durch den Schmuggel mit zollfreiem Alkohol aus dem Freihafen verdoppeln. Durch die Nähe Spaniens verwandelte sich unser Hilfsprojekt im östlichen Rif in eine tragikomische Farce.
Was unternahm die Bevölkerung mit dem Geld, das sie in Frankreich oder im spanischen Melilla so günstig verdiente? Hier, wie schon in unseren Beispielen aus der Türkei, aus Malawi und dem Jemen, wurde nicht in die lokale landwirtschaftliche Produktion investiert. Die mit deutscher Hilfe verbesserte ländliche Infrastruktur blieb ungenutzt. Vielmehr ließ auch hier die lokale Eigenerzeugung nach und der Konsum von importierten Basisnahrungsmitteln und sonstigen importierten Konsumgütern nahm entsprechend zu. Wer es gewohnt war, sein Geld mit einer Produktivität von DM 3000 pro Monat zu verdienen, war nicht mehr zu bewegen, sich bei noch größerer Anstrengung nur mit DM 300 pro Monat zufriedenzugeben. Und wer nicht das Glück hatte, DM 3000 zu verdienen, während sein Bruder oder sein Vetter dieses Glück hatte, war entmutigt und versuchte, am Reichtum des Verwan...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zum Nachdruck als eBook
- Nachdruck der Erstauflage von 1992
- Frontseite mit Titelbild
- Einführung
- Teil 1: Die Dritte und die Erste Welt
- 1. Einwanderungsland Europa - ein aktuelles Thema
- 2. Agrarüberschüsse aus Nord und West gegen Arbeitskräfte aus Süd und Ost
- 3. Die lokalen Eliten
- 4. Der Einfluss des Westens
- 4.1 Die westlichen Exportinteressen
- 4.2 Die Hilfsorganisationen
- 5. Entwicklungshilfe und öffentliche Meinung
- 5.1 Im Zeichen der Entkolonialisierung
- 5.2 Verteilungsgerechtigkeit und Grundbedürfnisbefriedigung
- 5.3 Der "Tag von Afrika" und die Dritte-Welt-Gruppen
- 5.4 Das Mißbehagen am Überfluß und die Bewahrung der Umwelt
- 5.5 Stiefkind Marktwirtschaft - Die Strukturanpassungsprogramme
- 6. Wieviel Geld kosten wirtschaftliche und soziale Entwicklung?
- Teil 2: Die Zweite und die Erste Welt
- 1. Die deutsche Wiedervereinigung und ihre entwicklungspolitische Bewältigung
- 2. Entwicklungsland Sowjetunion
- Teil 3: Was sollte geschehen?
- 1. Grenzen des Wachstums
- 2. Aktionsbereiche und Maßnahmen
- 2.1 Politischer Föderalismus
- 2.2 Kein Dumping, keine Warenhilfe
- 2.3 Stabile Währung und Kampf gegen die Kapitalflucht
- 2.4 Maßnahmen zur Reduzierung des Bevölkerungswachstums
- 2.5 Vermeidung entwicklungsschädlicher Wanderungen
- 2.6 Aktive Friedenssicherung
- 2.7 Privates Eigentum an den Produktionsmitteln
- 3. Auf dem Weg zu einer technischen Hilfe
- 4. Sonderfall: Die neuen Bundesländer
- Schlussbetrachtung
- Anlagen
- Anlage 1
- Anlage 1a
- Anlage 1b
- Anlage 2
- Anlage 3
- Anlage 4
- Anlage 5
- Anlage 6
- Anlage 7
- Anlage 7a
- Anlage 7b
- Anlage 8
- Anlage 9
- Anlage 10
- Anlage 11
- Anlage 12
- Anlage 13
- Anlage 14
- Anlage 15
- Anlage 16
- Anlage 17
- Anlage 18
- Anlage 19
- Anlage 20
- Rückseite
- Impressum