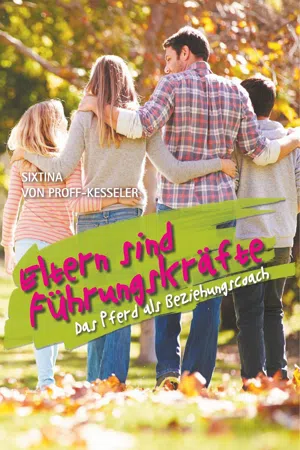![]()
DAS THEMA SCHULD UND IHRE AUSWIRKUNGEN
Das Thema habe ich nun bis zum Schluss aufgehoben, denn das ist ein gewaltiges Thema zum einen bei der Persönlichkeitsentwicklung und zum anderen beim Feedback.
Wir leben in einer Kultur, in der Schuld und Verantwortung eine große Rolle spielen.
In anderen Kulturen ist das anders, da ist es nicht so schlimm, wenn „man“ sich nicht an die Regeln hält, solange es keiner merkt. Das möchte ich hier aber nicht näher vertiefen. Denn hier geht es natürlich nicht darum, was für rechtliche, strafrechtliche, steuerliche oder finanzielle Auswirkungen das Thema Schuld hat, sondern was macht es mit uns als Mensch.
Ich habe mich selbst mal überprüft, als ich mit meiner Enkelin, sie ist zweieinhalb, einen Spaziergang gemacht habe.
Wir nähern uns einer Pfütze. Die Kleine steuert zielsicher auf die Pfütze zu: „Aber nicht in die Pfütze treten, dann bekommst du nasse Schuhe.“ Ein Blick zu mir, sie geht an dieser Pfütze vorbei, aber in die nächste, da habe ich nichts gesagt, weil ich dachte, es langt für den ganzen Spaziergang.
Patsch platsch – „Hihi, Omi, guck mal.“
„Ich hatte doch gesagt, du sollst nicht durch die Pfütze. Guck mal deine schönen neuen Schuhe an, die sind jetzt ganz dreckig. Und die Mama hat dann wieder ganz viel Arbeit, die Schuhe wieder sauber zu machen!“ Die Kleine steht mit gesenktem Kopf da. Ich beiße mir schon auf die Zunge, merke selbst, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin.
„Aber du hast doch gesagt, da hinten bei der Pfütze soll ich nicht durch!“ Große Kinderaugen gucken mich flehend an. „Ja, du hast recht, es war mein Fehler, ich hätte dich hier bei der Pfütze wieder daran erinnern sollen“, sage ich. Das kleine Kind atmet erleichtert auf. So habe ich gerade noch die Kurve bekommen und nicht die Schuld auf das Kind geschoben.
Was verursacht dieses „Schuld zuschieben“?
Ich erinnere mich noch genau, eines Tages kam ich in die Küche. Meine vier Kinder saßen am Küchentisch, sie waren zwischen 3 und 10 Jahre alt. Ein Glas Milch war umgefallen und die Milch tropfte vom Tisch auf den Boden. Ehe ich den Mund aufmachen konnte, zeigte jedes der Kinder auf ein anderes und wie aus einem Munde: „Der war‘s!“ Da musste ich auch lachen.
Woher kommt das, bloß nicht schuld sein?
Daraufhin habe ich mal die Redewendungen überprüft. Was sagen wir, um dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben?
Ich gebe meinen Einkaufszettel meiner Tochter – sie sagt: „Mama, das Gekritzel kann ich ja gar nicht lesen!“
„Ja, der Stift hat nicht gut geschrieben und da musste ich so draufdrücken. Du weißt doch, ich mit meiner Arthrose in den Fingern.“
Natürlich ärgere ich mich über mich selbst. Es ist ja auch blöd, mit einem unleserlichen Einkaufszettel im Kaufhaus herumzulaufen. Und meine Tochter ist eben ein kleiner Perfektionist, das weiß ich ja selbst. Ich kann natürlich auch ordentlich schreiben, das dauert nur länger!
Ich bin kurz zur Haustüre hinausgegangen und habe sie nicht ganz zugemacht. Prompt ist die Katze ins Haus gewitscht.
„Wer hat denn die Tür aufgelassen?“ Fragt mein Schwiegersohn. „Kann sein, dass ich das war?“, sage ich, statt zu sagen: „Ich war das!“
Der Autoschlüssel ist weg: „Weißt du, wo der Autoschlüssel ist?“, frage ich meine Tochter. „Den habe ich in den Schlüsselkasten gehängt“, sagt sie und hofft, dass er auch tatsächlich da drin ist. Da ist er aber nicht. Sie hat ihn noch in der Tasche.
Warum ist das so schwer, einfach zu sagen: „Ich war‘s!“
Da ist dieses Hintergrundprogramm im Kopf, das uns vor schlechten Konsequenzen schützen will, die es befürchtet, wenn wir genau diesen Satz sagen: „Ja, ich war‘s.“
Wie sieht das denn nun umgekehrt aus:
Ich gehe mit meiner Schwester spazieren. Es dauert nicht lange und dann regnet es. „Hast du den Schirm dabei?“, fragt sie mich. „Nein“, sage ich. „Warum nicht, es war doch klar, dass es regnet.“ Ich komme mir wieder vor, wie die dumme kleine Schwester. Dabei ist es ja gar nicht so, denn meine große Schwester hat den Schirm genauso vergessen.
Also dieses Schuldverteilen führt in den meisten Fällen dazu, dass sich einer oder mehrere ohne Grund schlecht oder eben schuldig fühlen.
Dafür sorgen diese und ähnliche Sätze aus unserer Kindheit.
- „Warum hast du das gemacht?“
- „Hättest du nicht besser aufpassen können?“
- „Siehst du, habe ich es dir nicht gleich gesagt?“
- „Du hättest mal auf mich hören sollen, dann wäre das nicht passiert!“
- „Oh, Mensch, wegen dir kann ich jetzt nicht weggehen!“
Das sind aber nur die gesprochenen Sätze, die das Ganze noch vervollständigen.
Was viel wirkungsvoller ist, ist das wortlose Feedback, das spüren die feinen Antennen der Säuglinge. Sie erkennen das schon am Schritt der Mutter.
Genau wie die Pferde. Ich gehe mal davon aus, dass der sechste Sinn eines Säuglings noch genauso intakt ist wie der eines Pferdes. Und mein Pferd hört schon daran, wie ich auf den Hof fahre, in welcher Verfassung ich bin. Wie mache ich die Autotür zu, wie komme ich in den Stall.
Sein Feedback zeigt mir meine Laune. Und warum soll das bei einem Säugling anders sein? Wenn ich mal nicht an meine Termine und an alles Mögliche andere denke, sondern einfach in mich hineinhöre, dann merke ich auch sofort, wie es meinem Partner, Kind, Bruder etc. geht. Also haben wir diesen Sinn gar nicht verloren, wir nutzen ihn nur einfach nicht.
Was hat das nun wieder mit der Schuld zu tun?
Wir haben erstens ererbte Erinnerungen in unseren Körperzellen, dazu kommen erlernte und erworbene Verhaltensmuster. Diese sind so stark, dass sie unserem Bewusstsein überlegen sind. Wir können dieses Verhalten nur ändern, wenn wir uns unsere unbewussten und auch ererbten und erworbenen Verhaltensmuster bewusst und sichtbar machen und sie bearbeiten und somit ändern wollen.
Das Schuldgefühl entsteht dann, wenn wir keine Verantwortung übernehmen. Also Verantwortung übernehmen verhindert Schuld.
Wie kann das nun funktionieren?
Ich nehme die Beispiele von weiter oben:
Der Einkaufszettel:
Statt dem Stift die Schuld in die Mine zu schieben, kann ich ja auch ganz einfach sagen: „Ja, ich habe nicht leserlich geschrieben. Gibst du mir den Zettel noch mal, dann schreibe ich es leserlich auf!“ Dann ist meine Tochter zufrieden und ich fühle mich nicht schuldig.
Die Katze:
„Ich habe die Tür nur angelehnt und sie ist vom Wind weiter aufgegangen. Das nächste Mal weiß ich, dass der Katze das nicht entgeht.“ Aus Fehlern lernen.
Der Autoschlüssel:
„Ich dachte, ich habe ihn in den Schlüsselkasten gehängt. Hier ist er!“ Etwas zu vergessen ist ja nicht strafbar.
Das geht überall:
Ich gehe mit einer Bekannten spazieren. Mein Hund latscht direkt neben ihr durch die Pfütze und ihre weiße Hose bekommt lauter braune Punkte. „Kannst du nicht auf deinen Hund aufpassen!“ Mir lag der Satz auf der Zunge: „Wieso denn, du hättest ja auch einen Schritt weiter links gehen können!“ Aber ich habe dann gesagt: „Der Hund hat es nicht böse gemeint und die Flecken gehen wieder raus.“ Damit gebe ich den Ball nicht wieder zurück, sondern lasse die Verantwortung bei ihr oder dem Hund.
Wir sitzen beim Essen: „Ist noch was von den Kartoffeln da?“, fragt jemand am Tisch. „Nein, die habe ich gerade aufgegessen. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du noch welche möchtest.“ „Ach so, ja stimmt.“ Muss ich mich jetzt schuldig fühlen?
Was verursacht denn nun das Schuldgefühl? Es gibt ja auch Leute, die scheinen das nicht zu haben.
„Hören Sie mal, das war mein Parkplatz!“ – „Ah, so, ich war eben schneller!“
„Hallo, da hinten ist das Ende der Schlange an der Kasse! Nicht vordrängeln!“
Auf dem Spielplatz habe ich mal alle Sätze aufgeschrieben, die dazu führen, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Das Eis am Stiel ist runtergefallen und hat die Eltern zu folgenden Äußerungen veranlasst:
„Warum hast du das gemacht?“
„Kannst du nicht aufpassen?“
„Ich habe dir doch gesagt, dass du langsam gehen sollst!“
„Was lernen wir daraus?“
„Hättest du auf mich gehört, dann wäre das nicht passiert!“
„Guck mal, jetzt ist das Eis ganz voll Sand und du kannst es nicht mehr essen. Und ich habe das Geld ganz umsonst ausgegeben!“
„Na, das war’s dann wohl, jetzt gibt es keine Eis mehr.“
„Oh, je, das ist aber schade, soll ich dir eine neues Eis kaufen?“
Der Satz „Das ist ja nicht so schlimm“ ist nur „nicht schlimm“, wenn er ernst gemeint ist. Sonst hat er nur Alibifunktion und das Kind fühlt sich gerade schuldig.
So, genug davon.
Wie könnte es denn ausgedrückt werden, ohne Schuldzuweisung?
„Oh je, das arme Eis!“ Da das Kind ja bestimmt traurig ist, weil es das Eis nicht mehr essen kann, kann dann noch ein Satz hinterher. „Ist mir auch schon passiert! Aber es gibt ja irgendwann wieder ein Eis.“ Und dann: „Was wollen wir denn jetzt machen, gehen wir nach Hause oder möchtest du noch ein Stück spazieren gehen?“ Dann sind die Wogen erst mal wieder geglättet.
Ich finde, dieser Schuldkomplex ist in Deutschland besonders ausgeprägt; ich habe manchmal das Gefühl, hier fühlen sich alle schon im Kollektiv schuldig.
Für mich ist erst mal nicht so wichtig, wo die Schuld herkommt, denn das zu ergründen ist furchtbar umständlich, langwierig und führt ja auch nicht dazu, dass die Schuld verschwindet. Ich suche lieber nach Lösungen, wie ich das übermäßige Schuldgefühl wieder wegbekomme, also sich für alles und jedes schuldig zu fühlen. Denn ein gesundes Schuldgefühl hilft mir ja zu erkennen, wann ich Verantwortung hätte übernehmen müssen, ist also nützlich und verhindert, dass ich anderen schade.
Andererseits lernen wir, dass es Nachteile bringt, die Schuld zuzugeben. Da brauchen wir ja nur in den Fernseher zu gucken; unsre Politiker machen es uns vor:
„Und ich versichere Ihnen, dass nichts an dem, was hier über mich behauptet wird, wahr ist!“ So langsam kommt es dann aber doch alles ans Licht und dann dankt der Politiker eben ab. Politiker sind natürlich immer auch Vorbilder und Personen, mit denen sich viele Jugendliche identifizieren.
Schon beim Führerschein lernen wir: „Bei einem Unfall auf keinen Fall irgendwelche Schuld zugeben. Denn das kann teuer werden.“ Vor Gericht bekommen wir ebenfalls nicht unbedingt „recht“, sondern der, der sein Anliegen am besten begründen kann, gewinnt das Verfahren und hat damit „recht“. Schuld zuzugeben heißt also Verantwortung übernehmen und die Folgen tragen. Es heißt aber auch, dass es Geld kostet, dass es Nachteile haben kann, die sich durch ein Leugnen vielleicht umgehen lassen.
Nun aber wieder zu dem Feedback, das dieses Schuldbewusstsein tief in unserem Herzen verankert.
Kinder sind die erste Zeit rund um die Uhr auf die Großen angewiesen. Mit der Zeit können sie immer mehr allein leisten, aber sie benötigen Rückhalt, Wärme, Geborgenheit und natürlich Nahrung, Kleidung Wohnung usw.
Kinder kommen aber schon mit einem Päckchen auf die Welt:
- Sie entsprechen nicht den Erwartungen der Eltern.
- Sie sind nicht geplant.
- Sie haben das falsche Geschlecht.
- Sie sind zwar geplant, aber verhalten sich nicht so wie erwartet.
- Sie sind anstrengend.
- Sie sind teuer.
- Sie brauchen Platz.
Sie sind gewollt, wurden sehnsüchtig erwartet, alle freuen sich, aber sie schlafen nicht durch und schreien jede Nacht vier- bis fünfmal oder noch mehr. Das sind alles gute Gründe, um den Kindern kritisch gegenüberzustehen. Bloß die Kinder trifft keine Schuld an der ganzen Angelegenheit. Und trotzdem fühlen sie sich schuldig.
Wie schon weiter oben beschrieben, merkt der klein...