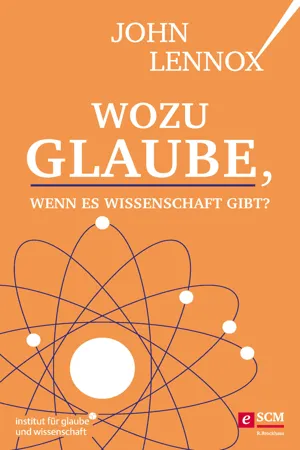
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt?
Über dieses Buch
Ist christlicher Glaube in einer Welt der Wissenschaft, die uns das Universum erklärt, überhaupt noch zeitgemäß? Wofür brauchen wir noch einen Gott, wenn wir (fast) alles wissen und selbst erschaffen können? Ist Gott ein Auslaufmodell?
John Lennox sieht das anders: Glaube und Wissenschaft widersprechen sich nicht - sie ergänzen sich sogar! Wissenschaft muss nicht von Gott wegführen, sondern weist auf ihn hin. Es gibt gute und stichhaltige Argumente für den Glauben an Gott. Man kann auch "rational glauben".
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt? von John Lennox im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Christian Denominations. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1
Kann man Wissenschaftler sein und an Gott glauben?
»Sie können heutzutage doch wohl nicht Wissenschaftler sein und an Gott glauben?«
Diese Ansicht habe ich im Laufe der Jahre von vielen Menschen gehört. Doch ich habe den Verdacht, dass es vielmehr die unausgesprochenen Zweifel sind, die Menschen davon abhalten, sich ernsthaft mit ernst zu nehmenden Denkern über Wissenschaft und Gott auseinanderzusetzen.
Ich entgegne auf diesen Einwurf häufig, indem ich die sehr wissenschaftliche Frage stelle: »Warum nicht?«
»Na ja«, erwidert dann mein Gegenüber, »die Wissenschaft erklärt doch das Universum wunderbar und zeigt uns damit, dass Gott nicht notwendig ist. An Gott zu glauben ist altmodisch. Dieser Glaube gehört in die Zeit, als die Menschen das Universum noch nicht verstanden haben und denkfaul behaupteten: ›Das war Gott.‹ Diese ›Lückenbüßer-Gott-Logik‹ funktioniert heute nicht mehr. Je früher wir Gott und Religion über Bord werfen, desto besser.«
Ich seufze innerlich und mache mich auf ein langes Gespräch gefasst, in dem ich versuche, die vielen Mutmaßungen, Missverständnisse und Halbwahrheiten zu entwirren, die man kritiklos aus der kulturellen Suppe, in der wir schwimmen, aufgesogen hat.
Ein verbreiteter Standpunkt
Es überrascht kaum, dass dieser Standpunkt so verbreitet ist, dass er für viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen zum Standard geworden ist. Es ist ein Standpunkt, der von einflussreichen Stimmen unterstützt wird. Stephen Weinberg etwa, Träger des Physik-Nobelpreises, sagte:
Die Welt muss aus dem langen Albtraum der Religion aufwachen. Alles, was wir Wissenschaftler beitragen können, um uns aus dem Klammergriff der Religion zu lösen, sollte auch getan werden, und vielleicht ist das unser größter Beitrag zur Zivilisation.1
Ich hoffe, Ihnen ist das recht düster klingende, totalitäre Element dieser Aussage nicht entgangen: »Alles, was wir Wissenschaftler tun können …«
Dieser Standpunkt ist nicht neu. Zum ersten Mal bin ich ihm vor fünfzig Jahren begegnet, als ich an der Universität Cambridge studierte. Bei einem festlichen Bankett saß ich neben einem anderen Nobelpreisträger. Noch nie hatte ich einen Wissenschaftler solchen Ranges kennengelernt, und um so viel wie möglich aus dem Gespräch mitzunehmen, stellte ich ihm ein paar Fragen. So wollte ich zum Beispiel wissen, wie die Wissenschaft seine Weltanschauung präge – welches Bild er sich vom Universum und dessen Bedeutung mache. Insbesondere interessierte mich, ob ihn die intensive Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen dazu gebracht hatte, über die Existenz Gottes nachzudenken.
Die Frage bereitete ihm Unbehagen, das war deutlich zu sehen, und ich hakte nicht weiter nach. Als das Bankett zu Ende war, lud er mich ein, in sein Büro zu kommen. Auch zwei oder drei andere Wissenschaftler lud er ein, aber keine weiteren Studenten. Ich sollte mich hinsetzen, doch soweit ich mich erinnere, blieben die anderen stehen.
Er meinte: »Lennox, Sie streben eine wissenschaftliche Karriere an?«
»Ja, Sir«, entgegnete ich.
»Dann«, sagte er, »müssen Sie noch heute vor Zeugen diesen kindischen Glauben an Gott ablegen. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie zum intellektuellen Krüppel werden und im Vergleich zu Ihren Kommilitonen schlechter abschneiden. Sie werden es einfach nicht schaffen.«
Erzählen Sie mir jetzt mal was über Druck! So etwas hatte ich noch nie erlebt.
Wie gelähmt saß ich auf meinem Stuhl, war schockiert von diesem unverfrorenen und unerwarteten Angriff. Eigentlich wusste ich nicht, was ich sagen sollte, doch schließlich platzte ich heraus: »Sir, was können Sie mir anbieten, das besser ist als das, was ich habe?« Daraufhin erwähnte er das Konzept der »schöpferischen Evolution«, das der französische Philosoph Henri Bergson 1907 bekannt gemacht hatte.
Dank C.S. Lewis wusste ich ein wenig über Bergson und erwiderte, ich könne nicht erkennen, wie Bergsons Philosophie ein ausreichendes Fundament für eine ganze Weltanschauung sowie für Sinn, Moral und Leben liefern würde. Mit zitternder Stimme und so respektvoll, wie ich nur konnte, erklärte ich der Gruppe, die um mich herumstand, dass ich die biblische Weltsicht weitaus reichhaltiger und die Argumente, die für ihre Wahrheit sprachen, sehr viel einleuchtender fand und dass ich, bei allem Respekt, das Risiko eingehen und bei meiner Meinung bleiben würde.2
Es war eine beeindruckende Situation. Hier saß mir ein brillanter Wissenschaftler gegenüber, der mich einschüchtern und dazu bewegen wollte, das Christentum aufzugeben. Seitdem ist mir oft der Gedanke durch den Kopf gegangen, wie es wohl gewesen wäre, wenn die Situation sich genau andersherum dargestellt und ich als Atheist auf diesem Stuhl gesessen hätte, umgeben von christlichen Akademikern, die mich gedrängt hätten, meinen Atheismus aufzugeben. Das hätte ein Erdbeben in der gesamten Universität ausgelöst und wahrscheinlich zu Disziplinarmaßnahmen gegen die beteiligten Professoren geführt.
Dieser doch etwas unheimliche Zwischenfall stählte Herz und Verstand. Ich fasste den Entschluss, mein Bestes zu geben, um als Wissenschaftler so gut wie möglich zu werden, und – wenn sich mir die Gelegenheit bieten sollte – Menschen zu ermutigen, über die großen Fragen nach Gott und Wissenschaft nachzudenken, damit sie sich ein eigenes Urteil bilden können, ohne lächerlich gemacht oder unter Druck gesetzt zu werden. In den folgenden Jahren habe ich es als Privileg empfunden, mit vielen Menschen – alt und jung – ins Gespräch zu kommen, die freundschaftlich und ergebnisoffen waren. In diesem Buch habe ich einige der Gedanken und Vorstellungen zu Papier gebracht, die ich persönlich am hilfreichsten finde, wenn ich mit anderen Menschen spreche, sowie darüber hinaus die interessantesten und ungewöhnlichsten Gespräche, die ich führen durfte.
Die dunkle Seite der akademischen Welt
An jenem Tag habe ich noch eine weitere wertvolle Lektion gelernt: dass die akademische Welt eine dunkle Seite hat. Es gibt Wissenschaftler, die voreingenommen an diese Fragen herangehen, gar nicht wirklich über die Argumente diskutieren wollen und offensichtlich nicht die Wahrheit suchen. Stattdessen wollen sie nur ihre vorgefasste Meinung unter die Leute bringen, dass sich Gott und Wissenschaft nicht miteinander vereinbaren lassen und diejenigen, die an Gott glauben, einfach Ignoranten sind.
Doch das stimmt einfach nicht.
Mehr noch, man muss gar nicht lange nachdenken, um einzusehen, dass das falsch ist. Denken Sie zum Beispiel an den Physik-Nobelpreis. 2013 gewann ihn Peter Higgs, ein aus Schottland stammender Atheist, für seine bahnbrechenden Arbeiten zu subatomaren Teilchen und seine Vorhersage der Existenz des Higgs-Teilchens, die später nachgewiesen wurde. Einige Jahre zuvor war William Phillips, ein amerikanischer Christ, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden.
Wenn sich Wissenschaft und Gott nicht miteinander vereinbaren ließen, gäbe es keine christlichen Nobelpreisträger. Tatsächlich bezeichneten sich über 60 Prozent der Nobelpreisträger zwischen 1900 und 2000 als an Gott gläubig.3 Was die beiden Professoren Higgs und Philipps voneinander unterscheidet, ist meiner Meinung nach nicht ihre Physik oder ihr Status als Wissenschaftler – beiden wurde der Nobelpreis verliehen. Was sie unterscheidet, ist ihre Weltanschauung. Higgs ist Atheist und Philipps Christ. Folglich ist die Behauptung der Akademiker, die mich vor so vielen Jahren in Cambridge einzuschüchtern versuchten – dass man nämlich Atheist sein müsse, um ein angesehener Wissenschaftler werden zu können –, offensichtlich falsch. Es kann keinen grundlegenden Konflikt darin geben, gleichzeitig Wissenschaft zu betreiben und an Gott zu glauben.
Es gibt allerdings tatsächlich einen Konflikt zwischen den beiden Weltanschauungen, die von diesen beiden brillanten Wissenschaftlern vertreten werden: Atheismus und Theismus.
Was genau ist Atheismus?
Genau genommen bedeutet Atheismus einfach, nicht an Gott zu glauben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Atheisten keine Weltanschauung hätten. Man kann die Existenz Gottes nicht verneinen, ohne nicht eine ganze Reihe von Grundannahmen über das Wesen der Welt zu postulieren. Darum ist Richard Dawkins’ Buch Der Gotteswahn auch kein einseitiges Flugblatt, in dem er erklärt, dass er nicht an Gott glaubt. Vielmehr handelt es sich um ein ausführliches Buch, das sich um seine atheistische Weltanschauung dreht, den Naturalismus. Dieser besagt, dass das Universum bzw. Multiversum alles ist, was existiert, und dass das, was Wissenschaftler »Masse und Energie« nennen, der elementare Stoff ist, aus dem das Universum gemacht ist. Darüber hinaus gebe es nichts.
Der Physiker Sean Carroll erklärt in seinem Bestseller The Big Picture, wie der Naturalismus den Menschen sieht:
Wir Menschen sind strukturierte Schlammpfropfen. Durch das unpersönliche Wirken natürlicher Strukturen haben wir die Fähigkeit entwickelt, über die Ehrfurcht einflößende Komplexität der Welt um uns herum nachzudenken, sie wertzuschätzen und in sie einzugreifen … Der Sinn, den wir im Leben finden, ist nicht transzendent …4
Das ist die Weltanschauung, der viele Atheisten glauben.
Meine Weltanschauung entspricht dem christlichen Theismus. Ich glaube, dass es einen intelligenten Gott gibt, der das Universum geschaffen und geordnet hat und es aufrechterhält. Er schuf die Menschen nach seinem Bild. Das bedeutet, dass er den Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet hat, nicht nur das Universum um sich herum zu verstehen, sondern auch Gott selbst kennenzulernen und sich an der Gemeinschaft mit ihm zu freuen. Für Christen hat das Leben einen herrlichen transzendenten Sinn. Ich möchte zeigen, dass die Wissenschaft diesen Standpunkt keineswegs untergräbt, sondern vielmehr untermauert. Später werden wir dann sehen, dass die Wissenschaft im Gegensatz dazu kaum Argumente für den Atheismus liefert. Vorher möchte ich aber den Grund dafür bereiten, indem ich den geschichtlichen Hintergrund aufzeige, der zu der seltsamen Auffassung führte, dass sich Wissenschaft und Gott nicht miteinander vertragen würden.
Einige Lektionen aus der Geschichte
Sprachen lernen ist mir immer leichtgefallen – sprachliche und mathematische Begabung gehen oft Hand in Hand. Als junger, mittelloser Akademiker in Cardiff verdiente ich mir durch das Übersetzen wissenschaftlicher Artikel vom Russischen ins Englische etwas zusätzliches Geld, um meine wachsende Familie zu versorgen.
Durch eine Reihe seltsamer Umstände saß ich einige Jahre später in einem wackeligen russischen Flugzeug im Anflug auf Nowosibirsk. An der dortigen Universität wollte ich einen Monat lang forschen und lehren.
Technologisch war das Land, damals noch unter kommunistischer Herrschaft, im großen Rückstand. Doch einige russische Mathematiker gehörten zu den besten der Welt. Die Begegnung mit ihnen war ein Privileg und ich verbrachte viel Zeit mit den Angehörigen der Fakultät und den Studierenden. Eins aber erstaunte sie zutiefst: dass ich an Gott glaubte!
Schließlich lud mich der Rektor der Universität ein, in einer Vorlesung zu erklären, warum ich als Mathematiker an Gott glaube. Offenbar war dies seit 75 Jahren die erste Vorlesung zu diesem Thema. Das Auditorium war bis auf den letzten Platz gefüllt mit Studenten und Professoren. In meinem Vortrag sprach ich unter anderem über die Geschichte der modernen Wissenschaft und erzählte, dass die großen Pioniere – Galileo, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday und Clerk-Maxwell – alle überzeugte Christen waren.
Als ich das sagte, spürte ich, wie sich ein gewisser Ärger im Publikum breitmachte. Und weil ich es nicht mag, wenn sich Zuhörer in meinen Vorlesungen ärgern, fragte ich nach, was sie denn so aufgebracht hätte. Ein Professor in der ersten Reihe antwortete: »Wir ärgern uns, weil wir hier zum ersten Mal hören, dass diese berühmten Wissenschaftler, auf deren Schultern wir stehen, an Gott glauben. Warum hat man uns das nicht gesagt?« »Ist es nicht offensichtlich«, entgegnete ich ihnen, »dass diese historische Tatsache nicht zum ›wissenschaftlichen Atheismus‹ passt, den man Ihnen beigebracht hat?«
Dann zeigte ich auf, dass der Zusammenhang zwischen der biblischen Weltsicht und der Entstehung der modernen Naturwissenschaft allgemein anerkannt war. Edwin Judge, ein anerkannter australischer Althistoriker, schreibt:
Die moderne Welt ist das Ergebnis einer Revolution in der wissenschaftlichen Methodik … Sowohl das wissenschaftliche Experiment als auch das Zitieren von Quellen als historisches Beweismittel ergeben sich aus der Weltsicht Jerusalems – nicht Athens –, von Juden und Christen – nicht von den Griechen.5
C.S. Lewis fasst das gut zusammen: »Die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur Gesetze gäbe; und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten.«6
Gegenwärtige Wissenschaftshistoriker wie etwa Peter Harrison formulieren es zwar noch differenzierter, wie das Christentum das intellektuelle Klima beeinflusst hat, in der die moderne Naturwissenschaft ihren Anfang nahm, doch sie kommen zu demselben Schluss: Das Christentum habe den Aufstieg der modernen Wissenschaft keineswegs verlangsamt, sondern sogar vielmehr vorangetrieben. Daher betrachte ich es als Privileg und Ehre, sowohl Wissenschaftler als auch Christ zu sein – nichts, das mir irgendwie peinlich wäre.
Hier nun einige Beispiele von den Überzeugungen dieser großen Wissenschaftler. Johannes Kepler (1571-1630), der Entdecker der nach ihm benannten keplerschen Gesetze über die Planetenbewegung, schrieb:
Das wichtigste Ziel aller Erforschung der äußeren Welt sollte sein, die vernünftige Ordnung zu entdecken, die Gott ihr auferlegt und die er uns in der Sprache der Mathematik offenbart hat.
Dies war keinesfalls Ausdruck einer deistischen Überzeugung, denn an anderer Stelle bekennt er sich deutlich zum christlichen Glauben: »Ich glaube einzig und allein an das, was Christus für uns getan hat. In ihm finde ich Zuflucht und Trost.«
Michael Faraday (1791-1867), der vielleicht bedeutendste Experimentalphysiker überhaupt, war ein Mann mit zutiefst christlicher Überzeugung. Als er im Sterben lag, besuchte ihn ein Freund und fragte ihn: »Sir Michael, über welche Spekulationen denken Sie gerade nach?« Für einen Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, zu einer großen Bandbreite naturwissenschaftlicher Themen Spekulationen anzustellen, manche davon zu verwerfen und andere weiterzuentwickeln, fiel seine Antwort bemerkenswert selbstbewusst aus: »Spekulationen, Mann, habe ich keine einzige! Ich habe Sicherheiten. Ich danke Gott, dass ich mein sterbendes Haupt nicht auf Spekulationen betten muss, denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin überzeugt, dass er bewahren kann, was ich ihm in Blick auf jenen Tag anvertraut habe.«
Im Angesicht der Ewigkeit empfand Faraday dieselbe Sicherheit, die dem Apostel Paulus Jahrhunderte zuvor Kraft gegeben hatte.
Galileo
»Aber wurde Galileo nicht von der Kirche verfolgt?«, fragte jemand aus meiner sibirischen Zuhörerschaft. »Das zeigt doch ganz klar, dass Wissenschaft und Glaube an Gott nicht übereinstimmen.«
In meiner Antwort wies ich darauf hin, dass Galileo fest an Gott und die Bibel glaubte, und zwar sein ganzes Leben lang. Einmal sagte er, dass die »Naturgesetze von der Hand Gottes in der Sprache der Mathematik geschrieben« seien und dass »der menschliche Verstand ein Werk Gottes ist, und zwar eines seiner besten«.
Darü...
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Haupttitel
- Impressum
- Stimmen zu diesem Buch
- Widmung
- Inhalts
- Über den Autor
- Vorwort
- Einführung: Kosmische Chemie
- 1 Kann man Wissenschaftler sein und an Gott glauben?
- 2 Die Entwicklung bis heute: Von Newton bis Hawking
- 3 Entzauberte Mythen I: Religion braucht Glauben, Wissenschaft aber nicht
- 4 Entzauberte Mythen II: Wissenschaft basiert auf Vernunft, der christliche Glaube nicht
- 5 Können wir die Bibel in einer wissenschaftlich geprägten Welt wirklich ernst nehmen?
- 6 Wunder: Ein Schritt zu weit?
- 7 Kann man dem trauen, was man liest?
- 8 Wie man das Christentum widerlegt
- 9 Die persönliche Dimension
- 10 Im Labor: Das Christentum auf dem Prüfstand
- Weitere Bücher von John C. Lennox
- Andere Bücher
- Danksagung
- Anmerkungen
- Leseempfehlungen